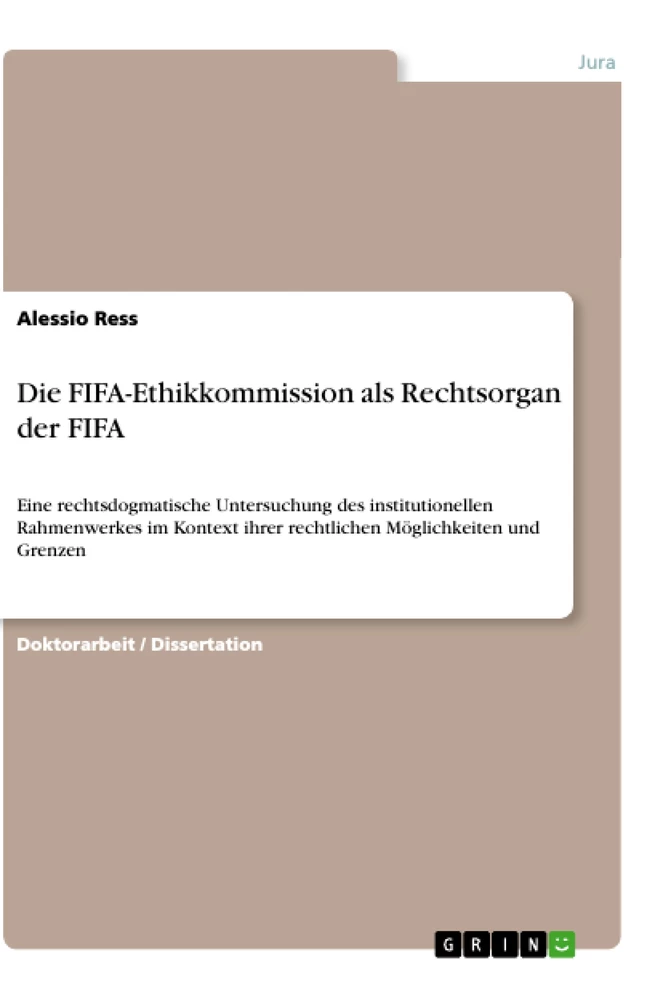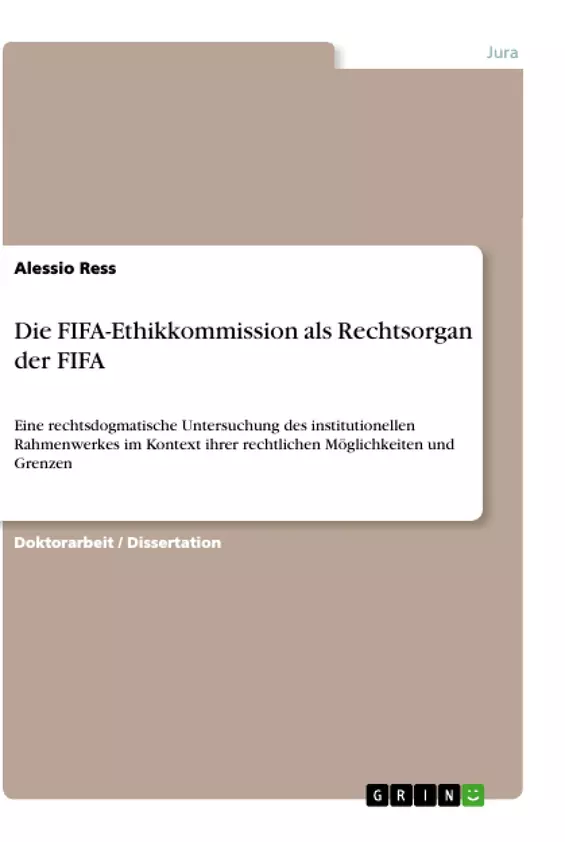Das Ziel der Arbeit ist es, die Aufgaben und Befugnisse der FIFA-Ethikkommission erstmals systematisch zu erfassen. Diese Strukturen sind nämlich zugleich Anknüpfungspunkte für die erhebliche Kritik an deren Arbeitsweise. Des Weiteren ist das institutionelle Rahmenwerk im Kontext privatrechtlicher Normensetzung einzuordnen und herauszuarbeiten, welche Anforderungen das Recht an die FIFA-Ethikkommission und sein Verfahren stellt. Anhand ausgewählter rechtlicher Vorgaben gilt es schließlich dessen Umsetzung einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Der Sport prägt einen bedeutenden Teil unserer gesellschaftlichen Lebensrealität. Als Folge einer stetigen Professionalisierung und Kommerzialisierung verfügen einzelne nationale wie internationale Verbände über ein bedeutendes ökonomisches Gewicht. Im Zuge der gewachsenen wirtschaftlichen Bedeutung und der erheblichen finanziellen Interessen wächst die Gefahr vor Korruption und anderen missbräuchlichen Handlungen der eingebundenen Beteiligten.
Der von Korruptionsskandalen heimgesuchte Weltfußballverband (FIFA) will der Korruption innerhalb der Fußballwelt endgültig den Kampf ansagen und andere Sportspitzenverbände ziehen nach. Um dieser anspruchsvollen Aufgabe im global organisierten Fußball nachzukommen, hat die FIFA durch die Implementierung des FIFA-Ethikreglements und Schaffung der FIFA-Ethikkommission ein in weiten Teilen wirksames Sanktionsverfahren geschaffen. Die Ethikkommission ist zuständig für die Untersuchung und Entscheidung bei Verstößen gegen das FIFA-Ethikreglement.
Doch auch wenn eine effektive Aufgabenwahrnehmung durch die FIFA-Ethikkommission gewährleistet werden soll, kann sie - aufgrund der mächtigen Strafgewalt der FIFA als Dach- und Monopolverband - nicht ohne eine gesetzliche Bindung erfolgen und muss dabei fundamentale rechtsstaatliche Grundsätze wahren. Die Akzeptanz einer solchen Institution und damit die Glaubwürdigkeit des gesamten organisierten Fußballsports finden nicht zuletzt auch Ausdruck in einem gesetzmäßigen, transparenten und öffentlichen Verfahren, das verfassungsmäßig verbürgte Rechte als Grenze achtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- A. Einleitung
- B. Stand der Forschung
- C. Fragestellung und Untersuchungsziel
- D. Skizzierter Gang der Untersuchung
- 1. Teil: Die FIFA
- A. Normative Grundlagen und juristische Natur
- B. Struktur und Aufbau
- I. Mitgliederstruktur
- II. Aufbau und Organe
- C. Reformprozess
- 2. Teil: Die FIFA-Ethikkommission
- A. Historie
- I. Gründung
- II. Reformprozess
- III. Mediale Kritik
- IV. Football Leaks Enthüllungen
- V. Prominente Fälle
- B. Normative Grundlagen und Rechtsquellen
- I. Verbandsautonomie und schweizerisches Vereinsrecht
- II. FIFA-Statuten
- III. FIFA-Ethikreglement
- C. Anwendungsbereich und Zuständigkeit
- I. Sachlicher Anwendungsbereich
- III. Personeller und zeitlicher Anwendungsbereich
- III. Zuständigkeit der FIFA-Ethikkommission
- D. Materielles Recht
- I. Grundlage für Sanktionen
- II. Disziplinarmaßnahmen
- III. Strafzumessung
- IV. Verjährung
- V. Verhaltensregeln
- E. Organisation und Zusammensetzung
- I. Zweiteilung der FIFA-Ethikkommission
- II. Zusammensetzung und Struktur
- III. Ausschließung und Ablehnung
- IV. Öffentlichkeit und Schweigepflicht
- F. Verfahren
- I. Allgemeine Verfahrensbestimmungen
- II. Untersuchungsverfahren
- III. Rechtsprechendes Verfahren
- G. Rechtsweg und Überprüfbarkeit der Entscheide
- I. Berufung
- II. Revision
- 3. Teil: Rechtliche Anforderungen an die FIFA-Ethikkommission
- A. Vorfrage: Grundlegende Charakteristika der FIFA-Ethikkommission
- I. Einordnung als Vereins- bzw. Verbandsgericht
- II. Wesen des FIFA-Ethikverfahrens
- B. Maßstäbe des geltenden Rechts
- I. Selbstgesetztes Recht: FIFA-Regelwerke
- II. Schweizerische Vereinsrecht
- III. Rechtsstaatliche Gebote und Verfahrensgrundsätze
- 4. Teil: Praktische Ausgestaltung der rechtlichen Anforderungen
- A. Anfechtungsmöglichkeit nach Schweizerischem Vereinsrecht
- B. Unabhängigkeit der FIFA-Ethikkommission
- I. Institutionelle und administrative Unabhängigkeit
- IIII. Sachliche Unabhängigkeit
- III. Persönliche Unabhängigkeit
- IV. Ablehnung von Mitgliedern
- V. Zwischenergebnis
- C. Rechtliches Gehör
- I. Informations- und Mitteilungspflichten
- II. Recht auf Akteneinsicht
- III. Möglichkeit der Stellungnahme und des Beweisantrags
- IV. Recht auf mündliche Verhandlung
- V. Rechtlicher Beistand
- VI. Zwischenergebnis
- D. Bestimmtheitsgrundsatz
- I. Anwendungsbereich
- II. Rechtsgrundlage für den Sanktionsausspruch
- E. Garantie des gesetzlichen Richters
- F. Gewaltenteilung
- G. Beweisverfahren und Öffentlichkeitsgrundsatz
- I. Beweisführung, Beweismaß und Beweislast
- II. Öffentlichkeitsgrundsatz
- H. Mitteilungs- und Begründungserfordernis
- I. Verhältnismäßigkeitserfordernis
- I. Verbandsrechtlicher Niederschlag
- II. Rechtsprechungspraxis
- J. Verschulden und Unschuldsvermutung
- I. Verschuldenserfordernis
- II. Unschuldsvermutung und in dubio pro reo
- K. Grundsatz des nemo tenetur se ipsum accusare
- I. Regelungen der Mitwirkungspflicht im FIFA-Ethikreglement
- II. Bewertung mit Blick auf die Anforderungen der Selbstbelastungsfreiheit
- III. Zwischenergebnis
- L. Verbot der Doppelbestrafung und ne bis in idem
- I. Verbandsebene
- II. Verhältnis zum staatlichen Strafverfahren
- 5. Teil: Ergebnisse und Empfehlungen
- A. Zusammenfassung in Thesen
- I. Verbandsrechtlicher Zusammenhang: FIFA
- II. Grundlagen der FIFA-Ethikkommission
- III. Verfahren der FIFA-Ethikkommission
- IV. Rechtliche Anforderungen an die FIFA-Ethikkommission und deren Umsetzung
- B. Schlussbetrachtungen und Entwicklungsperspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die FIFA-Ethikkommission als Rechtsorgan im Kontext ihrer rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen. Sie untersucht, inwiefern die Ethikkommission den Anforderungen des Rechts und insbesondere des schweizerischen Vereinsrechts gerecht wird. Dabei werden die normativen Grundlagen und die Struktur der FIFA sowie die Historie, die normative Grundlage und die Funktionsweise der FIFA-Ethikkommission beleuchtet.
- Die FIFA-Ethikkommission als Rechtsorgan der FIFA
- Rechtliche Anforderungen an die FIFA-Ethikkommission
- Reformprozess der FIFA und der FIFA-Ethikkommission
- Anwendungsbereich und Zuständigkeit der FIFA-Ethikkommission
- Verfahren der FIFA-Ethikkommission
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Stand der Forschung, die Fragestellung und das Untersuchungsziel. Der erste Teil widmet sich der FIFA als Institution und analysiert ihre normativen Grundlagen, ihre Struktur, ihren Aufbau und ihren Reformprozess. Der zweite Teil befasst sich mit der FIFA-Ethikkommission, ihrer Historie, ihren normativen Grundlagen, ihrem Anwendungsbereich, ihren Zuständigkeiten, dem materiellen Recht, ihrer Organisation, ihrer Zusammensetzung und ihren Verfahren. Der dritte Teil analysiert die rechtlichen Anforderungen an die FIFA-Ethikkommission im Kontext des schweizerischen Vereinsrechts, des selbstgesetzten Rechts und der Rechtsstaatlichkeit. Der vierte Teil betrachtet die praktische Ausgestaltung dieser rechtlichen Anforderungen in Bezug auf Unabhängigkeit, rechtliches Gehör, Bestimmtheit, Garantie des gesetzlichen Richters, Gewaltenteilung, Beweisverfahren, Verhältnismäßigkeit, Verschulden, Unschuldsvermutung, Selbstbelastungsfreiheit und das Verbot der Doppelbestrafung. Der fünfte Teil fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und gibt Empfehlungen zur Weiterentwicklung der FIFA-Ethikkommission.
Schlüsselwörter
FIFA-Ethikkommission, Rechtsorgan, FIFA, Schweizerisches Vereinsrecht, Verbandsautonomie, Ethikreglement, Verfahrensgrundsätze, Unabhängigkeit, Rechtliches Gehör, Bestimmtheit, Garantie des gesetzlichen Richters, Gewaltenteilung, Beweisverfahren, Verhältnismäßigkeit, Verschulden, Unschuldsvermutung, Selbstbelastungsfreiheit, Doppelbestrafung, Reformprozess.
- Citar trabajo
- Alessio Ress (Autor), 2020, Die FIFA-Ethikkommission als Rechtsorgan der FIFA, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030789