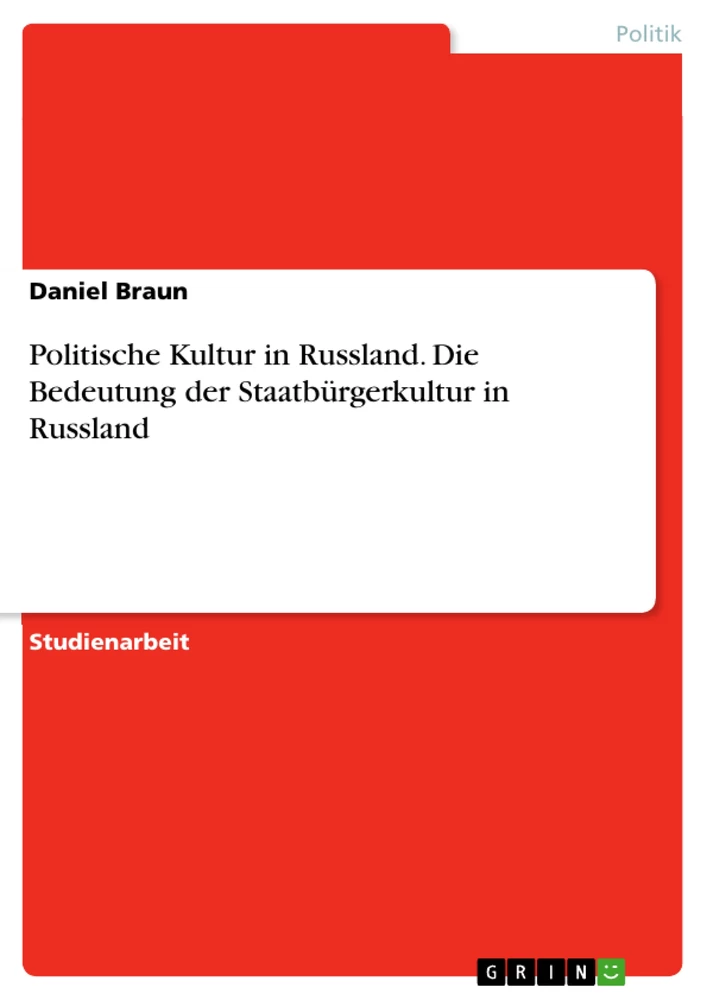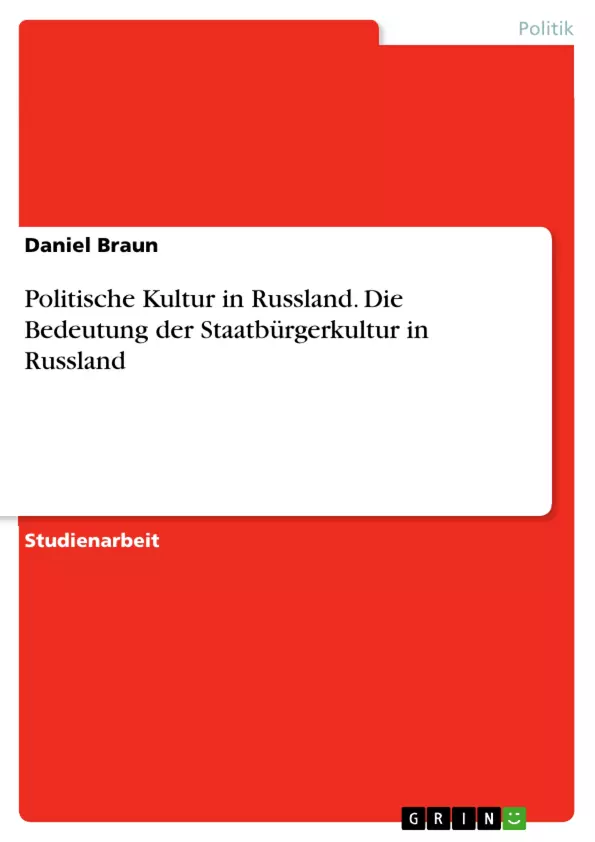Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Warum bringt Russland nicht die Qualitäten mit sich, um eine Demokratie effektiv umzusetzen und wie steht die politische Kultur damit in Verbindung? Im Rahmen dieser Ausarbeitung soll jedoch nicht noch einmal herausgestellt werden, ob die Russische Föderation eine (funktionierende) Demokratie oder doch vielmehr ein autoritäres System ist. Vielmehr liegt der Fokus im Folgenden auf der politischen Kultur des Landes und ob dieses dadurch eine generelle Fähigkeit zur Demokratie aufweist. Hierbei sind vor allem die Ereignisse der aktuellen Geschichte von Bedeutung, da sich das Land so wie man es heute kennt und wahrnimmt, erst 1991 gebildet hat. Um den momentanen Zeitgeist der politischen Lage und Kultur Russlands besser zu verstehen, soll jedoch auch auf relevante historische Kontexte eingegangen werden.
Nachdem zunächst der Begriff politische Kultur eingeführt und dargestellt wird, dient das Konzept der Civic Culture von Almond und Verba (1963) als theoretische Grundlage, um die politische Kultur in Russland in der folgenden Analyse zu betrachten. Des weiteren werden Konzepte der Systemtransformation und der damit einhergehenden Demokratiekonsolidierung beschrieben, um im Zusammenhang mit der politischen Kultur Russlands Aussagen über die Konsolidierung der Demokratie treffen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG.
- 2. THEORIE
- 2.1 POLITISCHE KULTUR – EINE BEGRIFFSDEFINITION
- 2.2 CIVIC CULTURE - KONZEPTUALISIERUNG VON ALMOND UND VERBA.
- 2.3 DEMOKRATIEKONSOLIDIERUNG – KONZEPTE NACH WOLFGANG MERKEL
- 3. ANALYSE...
- 3.1 POLITISCHES SYSTEM IM ALLGEMEINEN.
- 3.2 INPUT-OBJEKTE
- 3.3 OUTPUT-OBJEKTE.
- 3.4 DAS SELBST ALS POLITISCHER AKTEUR.
- 4. FAZIT...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die politische Kultur Russlands und ihre Bedeutung für die Demokratie im Land. Sie analysiert, ob Russland trotz formaldemokratischer Strukturen und der aktuellen historischen Entwicklung eine generelle Fähigkeit zur Demokratie aufweist. Hierzu werden relevante Konzepte der politischen Kultur, insbesondere die Civic Culture von Almond und Verba, sowie Theorien der Systemtransformation und Demokratiekonsolidierung herangezogen. Der Fokus liegt dabei auf der postkommunistischen Ära Russlands und der Frage, inwieweit die politische Kultur die Entwicklung und Festigung der Demokratie beeinflusst.
- Die Bedeutung der politischen Kultur für die Demokratie
- Die Analyse der russischen politischen Kultur im Kontext der Civic Culture
- Die Rolle der Systemtransformation und Demokratiekonsolidierung
- Die historische Entwicklung Russlands und ihre Auswirkungen auf die politische Kultur
- Die aktuelle politische Situation und der Einfluss der politischen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas der politischen Kultur Russlands im Kontext der gegenwärtigen europäischen und globalen Entwicklungen dar. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen der formalen Demokratie in Russland und der realen politischen Praxis. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, ob die russische politische Kultur eine generelle Fähigkeit zur Demokratie aufweist und wie sich die aktuelle Geschichte auf die politische Kultur auswirkt.
- Theorie: Dieses Kapitel behandelt die zentrale Definition des Begriffs "politische Kultur" und beleuchtet seine Rezeptionsgeschichte. Dabei werden die klassischen Ansätze von Almond und Verba sowie die Forschung von Bettina Westle herausgestellt. Der Fokus liegt auf der Veranschaulichung der Civic Culture als theoretische Grundlage für die anschließende Analyse der russischen politischen Kultur. Zudem werden Konzepte der Systemtransformation und Demokratiekonsolidierung nach Wolfgang Merkel vorgestellt, um im Zusammenhang mit der politischen Kultur Russlands Aussagen über die Konsolidierung der Demokratie treffen zu können.
- Analyse: Dieses Kapitel analysiert die politische Kultur Russlands im Licht der vorgestellten theoretischen Konzepte. Es untersucht die Rolle der politischen Kultur im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Es werden die relevanten Faktoren der politischen Kultur wie Einstellungen, Werte und Orientierungen der Bevölkerung sowie die Auswirkungen der Geschichte auf die politische Kultur beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die politische Kultur Russlands und ihre Bedeutung für die Demokratie. Zentrale Begriffe sind: politische Kultur, Civic Culture, Systemtransformation, Demokratiekonsolidierung, postkommunistische Entwicklung, Demokratiefähigkeit, Russlands Geschichte, aktuelle politische Situation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept der „Civic Culture“?
Es beschreibt eine politische Kultur, die durch eine Mischung aus aktiver Teilhabe, Loyalität zum System und Vertrauen in Institutionen eine stabile Demokratie ermöglicht.
Warum hat Russland Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Demokratie?
Die Arbeit untersucht, ob historische Prägungen und eine spezifische politische Kultur die Entwicklung einer effektiven Demokratie behindern.
Welche Rolle spielt die postkommunistische Ära ab 1991?
Die Umbrüche nach dem Zerfall der Sowjetunion prägten das heutige politische System und die Wahrnehmung der Bürger als politische Akteure.
Was versteht man unter Demokratiekonsolidierung?
Es ist der Prozess der Verfestigung demokratischer Strukturen auf institutioneller, repräsentativer und kultureller Ebene.
Was sind „Input-Objekte“ in der politischen Systemtheorie?
Sie bezeichnen die Kanäle und Prozesse, durch die Forderungen und Unterstützung der Bürger in das politische System gelangen.
- Quote paper
- Daniel Braun (Author), 2020, Politische Kultur in Russland. Die Bedeutung der Staatbürgerkultur in Russland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1031714