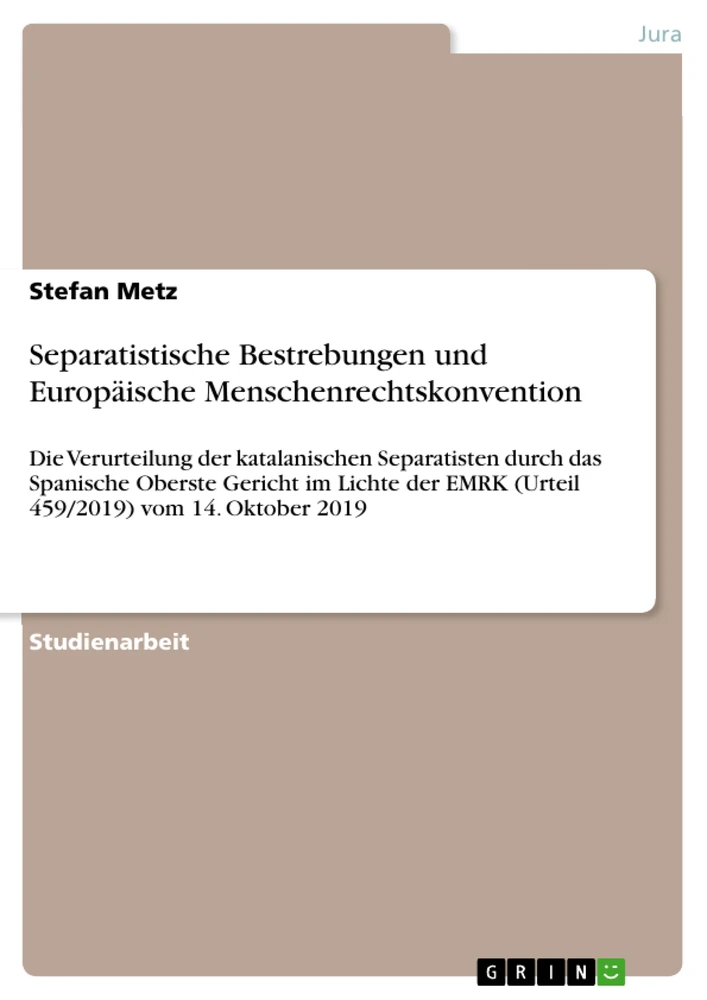Ziel dieser Seminararbeit ist es, die Urteile des Spanischen Obersten Gerichts aus einer völkerrechtlichen Perspektive im Lichte der Europäischen Menschenrechtskonvention – insbesondere der Menschenrechte der freien Meinungsäußerung sowie der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit – zu beurteilen. Demnach werden im nachfolgenden Kapitel die Artikel 10 und 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention durchleuchtet und dabei Präzedenzfälle wie "the case of Stankov and the United Macedonian Organisation,Ilinden v. Bulgaria" herangezogeen. Es soll anhand von exemplarischen Urteilen, die zusammenfassend dargestellt werden, sich des aktuellen Stands der bisherigen Rechtssprechung des EGMR vergegenwärtigt werden. Im Anschluss daran wird im Hauptteil der vorliegenden Seminararbeit das Urteil des Spanischen Obersten Gerichts (Urteil 459/2019) im Lichte dieser beiden Artikel untersucht. In der Stellungnahme zum Urteil wird die Urteilsbegründung kritisch durchleuchtet, bevor im abschließenden Kapitel ein kurzes Fazit die Seminararbeit abrundet.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung: Separatistische Bestrebungen in Katalonien
- B. Europäische Menschenrechtskonvention
- I. Die Freiheit der Meinungsäußerung
- II. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
- III. Einschränkungen der Artikel 10 und 11 der EMRK
- a. Art. 10
- b. Art. 11
- C. Rechtssprechung des EGMR in Bezug auf Art. 10 und 11
- I. EGMR-Urteil über das Parteiverbot der kurdischen DTP
- II. Fall von Stankov und der UMO Ilinden gegen Bulgarien
- D. Der Unabhängigkeitsprozess in Katalonien und die juristischen Folgen
- I. Hintergründe des Unabhängigkeitsprozesses im „,Heißen Herbst“ 2017
- II. EGMR-Urteil (75147/17) vom 28.05.2019
- III. Urteil des Spanischen Obersten Gerichts vom 14. Oktober 2019
- IV. Stellungnahme zum Urteil
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verurteilung katalanischer Separatisten durch das Spanische Oberste Gericht im Kontext der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Sie analysiert, ob die Urteile mit den in der EMRK verankerten Grundrechten auf Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit vereinbar sind.
- Separatistische Bestrebungen in Katalonien
- Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) in Bezug auf Artikel 10 und 11 der EMRK
- Der Unabhängigkeitsprozess in Katalonien und die juristischen Folgen
- Die Rolle der EMRK bei der Wahrung von Grundrechten im Spannungsfeld zwischen staatlicher Sicherheit und individueller Freiheit
- Die Interpretation und Anwendung von Grundrechten durch nationale Gerichte im Kontext von separatistischen Bewegungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der separatistischen Bestrebungen in Katalonien dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Kapitel B erläutert die relevanten Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention, insbesondere die Artikel 10 und 11, welche die Meinungsfreiheit sowie die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit schützen. In Kapitel C wird die Rechtssprechung des EGMR zu diesen Artikeln anhand zweier exemplarischer Fälle beleuchtet. Kapitel D analysiert den Unabhängigkeitsprozess in Katalonien, einschließlich der Hintergründe und der relevanten Gerichtsentscheidungen, insbesondere das Urteil des Spanischen Obersten Gerichts vom 14. Oktober 2019. Kapitel E bietet ein Fazit und fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Europäischen Menschenrechtskonvention, insbesondere den Grundrechten auf Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Sie analysiert die rechtlichen Folgen des Unabhängigkeitsprozesses in Katalonien und die Interpretation von Grundrechten durch nationale Gerichte im Kontext separatistischer Bewegungen. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind: Rechtssprechung des EGMR, Urteil des Spanischen Obersten Gerichts, katalanische Separatisten, Grundrechte, staatliche Sicherheit, individuelle Freiheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie beurteilt das Völkerrecht die Verurteilung katalanischer Separatisten?
Die Arbeit untersucht die Urteile im Lichte der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), insbesondere hinsichtlich der Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Welche Artikel der EMRK sind für separatistische Bestrebungen zentral?
Zentral sind Artikel 10 (Freiheit der Meinungsäußerung) und Artikel 11 (Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit).
Darf der Staat die Versammlungsfreiheit einschränken?
Ja, Einschränkungen sind gemäß EMRK möglich, wenn sie gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft zur Wahrung der nationalen Sicherheit notwendig sind.
Welche Präzedenzfälle gibt es zur Parteienfreiheit beim EGMR?
Genannt werden unter anderem Urteile zum Verbot der kurdischen DTP oder der Fall Stankov gegen Bulgarien.
Was war der Hintergrund des „Heißen Herbstes“ 2017 in Katalonien?
Es handelt sich um den Höhepunkt des Unabhängigkeitsprozesses mit einem umstrittenen Referendum und der anschließenden juristischen Verfolgung der Anführer.
- Citation du texte
- Stefan Metz (Auteur), 2020, Separatistische Bestrebungen und Europäische Menschenrechtskonvention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1031975