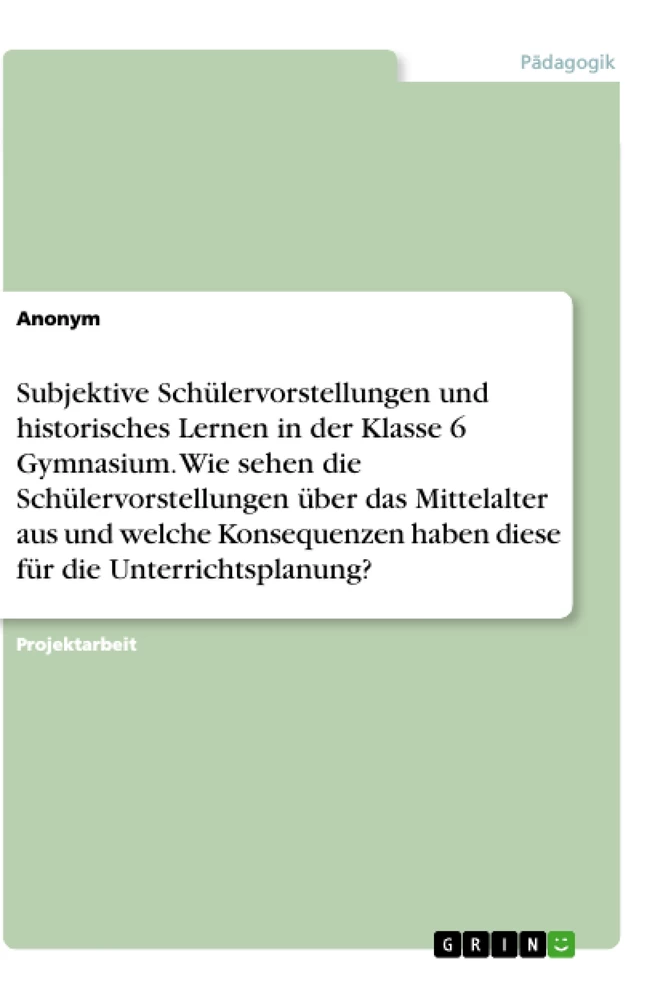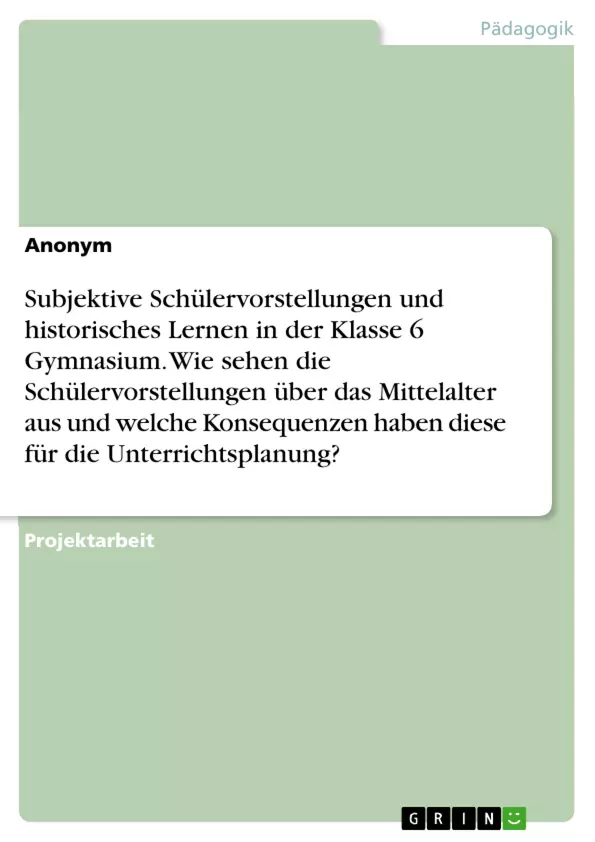Im Folgenden wird zunächst eine theoretische Einordnung des Themas vorgenommen, um davon ausgehend das Projektvorhaben zu generieren. Im Anschluss an die Vorstellung der Untersuchung und ihrer Ergebnisse wird ein Abgleich mit den Hypothesen vollzogen. Ziel ist es abschließend, Handlungsnotwendigkeiten für den Geschichtsunterricht zum Mittelalter abzuleiten, um existierenden „Fehlvorstellungen“ vorzubeugen, vorhandenes Geschichtsbewusstsein zu fördern, sowie bereits vorhandenes Wissen und das Interesse als Ressource nutzen zu können. Es sollen keine konkreten Vorschläge erbracht werden, sondern lediglich Perspektiven aufgezeigt werden, die bei einer Planung von Geschichtsunterricht zum Mittelalter beachtet werden sollten.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Schülervorstellungen evaluiert und Konsequenzen für die weitere Planung des Geschichtsunterrichts zum Mittalter ausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Forschungsdesign
- Datenerhebung
- Datenauswertung
- Ergebnisse
- Ausblick: Perspektiven für die Unterrichtsplanung
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die subjektiven Schülervorstellungen über das Mittelalter und deren Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung im Geschichtsunterricht. Ziel ist es, Handlungsnotwendigkeiten abzuleiten, um Fehlvorstellungen zu korrigieren, das Geschichtsbewusstsein zu fördern und vorhandenes Wissen und Interesse als Ressource zu nutzen. Es werden keine konkreten Unterrichtsvorschläge präsentiert, sondern lediglich Perspektiven für die Unterrichtsplanung aufgezeigt.
- Schülervorstellungen über das Mittelalter
- Einfluss der Populärkultur auf das Geschichtsbewusstsein
- Konsequenzen für die Unterrichtsplanung
- Förderung von Geschichtsbewusstsein und nachhaltigem Lernen
- Reflexion der verwendeten Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
Zusammenfassung: Diese Zusammenfassung bietet eine theoretische Einordnung des Themas und generiert das Projektvorhaben. Anschließend werden die Untersuchung und ihre Ergebnisse vorgestellt und mit den Hypothesen abgeglichen. Das Ziel ist es, Handlungsnotwendigkeiten für den Geschichtsunterricht zum Mittelalter abzuleiten, um Fehlvorstellungen vorzubeugen, das Geschichtsbewusstsein zu fördern und vorhandenes Wissen und Interesse zu nutzen. Es werden keine konkreten Vorschläge erbracht, sondern lediglich Perspektiven für die Unterrichtsplanung aufgezeigt, die bei der Planung von Geschichtsunterricht zum Mittelalter beachtet werden sollten. Die Arbeit evaluiert Schülervorstellungen und erarbeitet Konsequenzen für die weitere Planung des Geschichtsunterrichts zum Mittelalter. Das hohe Interesse der Schülerinnen und Schüler soll durch die Quantität und Qualität des Wissens gefördert werden, auch wenn dieses hauptsächlich aus der Populärkultur stammt. Diese bedeutenden Interpretationen des Mittelalters sollten in den Unterricht eingebaut werden, um Interesse und Wissen nachhaltig zu sichern.
Einleitung: Die Einleitung stellt die gegensätzlichen Sichtweisen auf das Mittelalter vor – einerseits als Zeit der Rückständigkeit und Finsternis, andererseits als Fantasiewelt. Sie thematisiert die Präsenz von Stereotypen und fragt nach dem Umgang von Lehrpersonen damit. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie sehen die Schülervorstellungen über das Mittelalter aus und welche Konsequenzen haben diese für die Unterrichtsplanung? Zusätzliche Fragen betreffen Vorwissen, Möglichkeiten der Einbringung von Schüler Vorstellungen, die Aufklärung von Fehlvorstellungen und die Sicherung eines nachhaltigen Geschichtsunterrichts. Das Interesse an diesem Projekt entstand aus der Suche nach einem didaktisch relevanten Projekt, das die persönliche Präferenz des Themas „Mittelalter“ mit der späteren Praxis im Lehrberuf verbindet. Die Arbeit untersucht Stereotype, Fehlinterpretationen und vorhandenes Wissen, um Konsequenzen für die Unterrichtsplanung abzuleiten, wobei die Entwicklung des Geschichtsbewusstseins und die Nachhaltigkeit des Unterrichts im Vordergrund stehen.
Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Mustern im Denken und Handeln und deren Einfluss auf den Wissenserwerb. Es wird der Conceptual Change Ansatz erläutert, der im Konstruktivismus verwurzelt ist und das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Strukturen und individuellem Lernen verbindet. Der Begriff „Schülervorstellungen“ wird definiert und verschiedene Perspektiven auf Schülervorstellungen (im Vergleich zu denen von Lehrkräften und Historikern) werden diskutiert. Die Bedeutung von Vorwissen für den Aufbau von Geschichtsbewusstsein und die Entwicklung schülerorientierter Konzepte für nachhaltigen Geschichtsunterricht werden hervorgehoben. Die Tragfähigkeit von Lernprozessen hängt von der langfristigen Motivation ab, die durch Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit gefördert werden kann.
Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt die Datenerhebung und -auswertung. 27 Schülerinnen und Schüler einer 6. Klasse wurden aufgefordert, ihre Vorstellungen zum Mittelalter zeichnerisch darzustellen. Die Zeichnungen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, wobei ein Kategoriensystem entwickelt und die Ergebnisse in Prozentangaben zusammengefasst wurden. Die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität wurden berücksichtigt. Das entwickelte Kategoriensystem umfasst die Aspekte, die die Schülerinnen und Schüler bereits wissen oder glauben zu wissen, und konzentriert sich nicht auf alle Aspekte des Mittelalters. Die gewählte Methode des Zeichnens wird als motivierend und inklusiv für alle Schüler, inklusive DaZ-Lerner, beschrieben.
Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Auswertung der Schülerzeichnungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schülervorstellungen überwiegend von der Populärkultur geprägt sind, was sich in den gezeichneten Motiven (z.B. Drachen, Hexen) zeigt. Die Hypothese, dass Schüler ohne Vorkenntnisse Wissen aus der Populärkultur verwenden, wird bestätigt. Die Ergebnisse werden detailliert in Tabellen im Anhang dargestellt und im Kapitel 5 erläutert.
Ausblick: Perspektiven für die Unterrichtsplanung: Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung der Ergebnisse für die Entwicklung des Geschichtsbewusstseins und die Nachhaltigkeit des Geschichtsunterrichts. Es wird betont, dass die Schülerinnen und Schüler bereits viel Wissen und ein hohes Interesse zum Thema haben. Die Populärkultur wird als Ausgangspunkt für den Unterricht genutzt, wobei historische Romane oder Filme eingesetzt werden können. Reflektiertes und selbstreflexives Geschichtsbewusstsein soll durch die Auseinandersetzung mit Populärkultur und Geschichtswissenschaft gefördert werden. Der Umgang mit der von der Populärkultur geprägten Vergangenheit soll reflektiert und ein Conceptual Change angestrebt werden. Falsche Interpretationen sollen thematisiert und das Interesse der Schüler an Aspekten wie dem Königshaus, Rittern, Burgleben etc. aufgegriffen werden. Die Notwendigkeit, die Nachhaltigkeit des Interesses in höheren Klassenstufen zu sichern, wird angesprochen.
Reflexion: Dieses Kapitel reflektiert die im Projekt angewandten Methoden und deren Eignung. Die Methode der Schülerzeichnung wird als geeignet für die unteren Klassenstufen bewertet. Die Notwendigkeit von ergänzenden Interviews zur genaueren Interpretation wird hervorgehoben. Die Autorin beschreibt ihre Absicht, die Methode der Schülerzeichnung im späteren Lehrberuf beizubehalten und andere Methoden für höhere Klassenstufen zu verwenden. Die Bedeutung der Erhebungskompetenz von intuitivem Wissen und Interesse der Schüler für die Unterrichtsplanung wird betont.
Schlüsselwörter
Schülervorstellungen, Mittelalter, Geschichtsunterricht, Populärkultur, Geschichtsbewusstsein, Conceptual Change, nachhaltiges Lernen, qualitative Inhaltsanalyse, Unterrichtsplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Schülervorstellungen über das Mittelalter und deren Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die subjektiven Schülervorstellungen über das Mittelalter und deren Auswirkungen auf die Unterrichtsplanung im Geschichtsunterricht. Ziel ist es, Handlungsnotwendigkeiten abzuleiten, um Fehlvorstellungen zu korrigieren, das Geschichtsbewusstsein zu fördern und vorhandenes Wissen und Interesse als Ressource zu nutzen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie sehen die Schülervorstellungen über das Mittelalter aus und welche Konsequenzen haben diese für die Unterrichtsplanung? Zusätzliche Fragen betreffen Vorwissen, Möglichkeiten der Einbringung von Schüler Vorstellungen, die Aufklärung von Fehlvorstellungen und die Sicherung eines nachhaltigen Geschichtsunterrichts.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung verwendet?
27 Schülerinnen und Schüler einer 6. Klasse wurden aufgefordert, ihre Vorstellungen zum Mittelalter zeichnerisch darzustellen. Die Zeichnungen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, wobei ein Kategoriensystem entwickelt und die Ergebnisse in Prozentangaben zusammengefasst wurden.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigen, dass die Schülervorstellungen überwiegend von der Populärkultur geprägt sind, was sich in den gezeichneten Motiven (z.B. Drachen, Hexen) zeigt. Die Hypothese, dass Schüler ohne Vorkenntnisse Wissen aus der Populärkultur verwenden, wird bestätigt. Die Ergebnisse werden detailliert in Tabellen im Anhang dargestellt.
Welche Konsequenzen für die Unterrichtsplanung werden gezogen?
Die Arbeit betont, dass die Schülerinnen und Schüler bereits viel Wissen und ein hohes Interesse zum Thema haben. Die Populärkultur wird als Ausgangspunkt für den Unterricht genutzt. Reflektiertes und selbstreflexives Geschichtsbewusstsein soll durch die Auseinandersetzung mit Populärkultur und Geschichtswissenschaft gefördert werden. Falsche Interpretationen sollen thematisiert und das Interesse der Schüler an Aspekten wie dem Königshaus, Rittern, Burgleben etc. aufgegriffen werden.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit befasst sich mit dem Conceptual Change Ansatz, der im Konstruktivismus verwurzelt ist und das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Strukturen und individuellem Lernen verbindet. Die Bedeutung von Vorwissen für den Aufbau von Geschichtsbewusstsein und die Entwicklung schülerorientierter Konzepte für nachhaltigen Geschichtsunterricht werden hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst die Kapitel: Zusammenfassung, Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Forschungsdesign (inkl. Datenerhebung und -auswertung), Ergebnisse, Ausblick: Perspektiven für die Unterrichtsplanung und Reflexion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schülervorstellungen, Mittelalter, Geschichtsunterricht, Populärkultur, Geschichtsbewusstsein, Conceptual Change, nachhaltiges Lernen, qualitative Inhaltsanalyse, Unterrichtsplanung.
Wie wird die Methode der Schülerzeichnung bewertet?
Die Methode der Schülerzeichnung wird als geeignet für die unteren Klassenstufen bewertet. Die Notwendigkeit von ergänzenden Interviews zur genaueren Interpretation wird hervorgehoben. Die Autorin beschreibt ihre Absicht, die Methode der Schülerzeichnung im späteren Lehrberuf beizubehalten und andere Methoden für höhere Klassenstufen zu verwenden.
Gibt die Arbeit konkrete Unterrichtsvorschläge?
Nein, die Arbeit präsentiert keine konkreten Unterrichtsvorschläge, sondern lediglich Perspektiven für die Unterrichtsplanung, die bei der Planung von Geschichtsunterricht zum Mittelalter beachtet werden sollten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Subjektive Schülervorstellungen und historisches Lernen in der Klasse 6 Gymnasium. Wie sehen die Schülervorstellungen über das Mittelalter aus und welche Konsequenzen haben diese für die Unterrichtsplanung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1032992