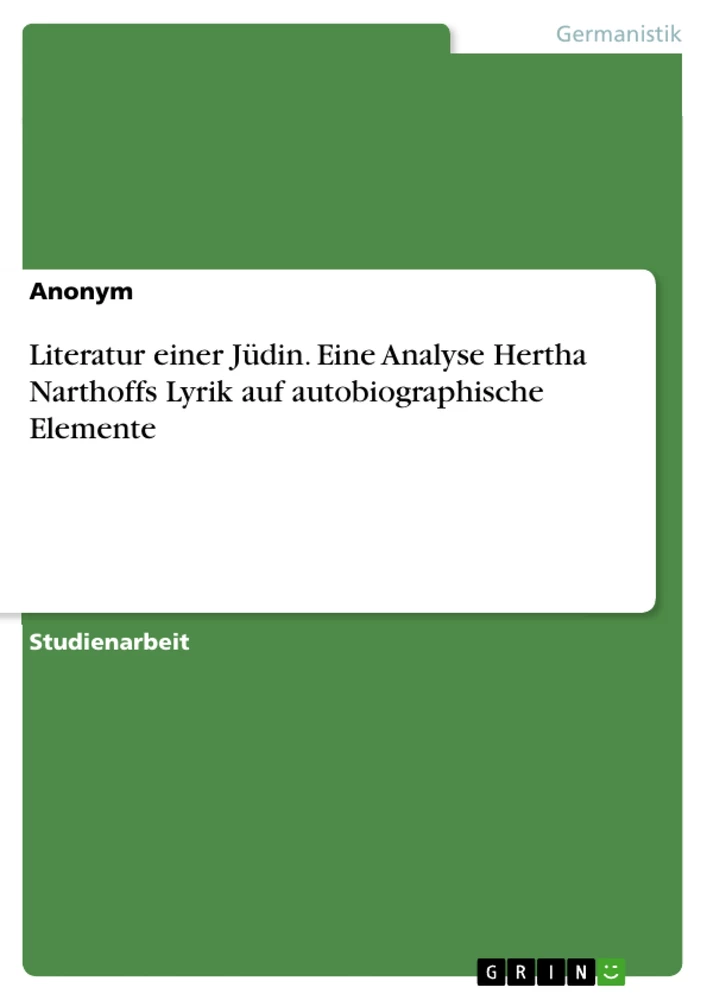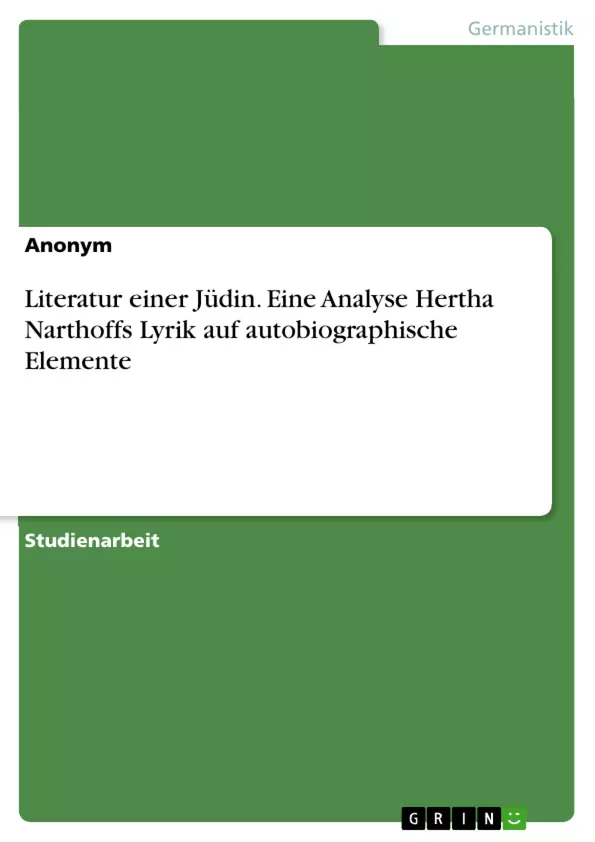Die Jüdin Hertha Nathorff, die von 1895 bis 1993 lebte, war in ihrem Leben vordergründig Ärztin und dazu nebenbei Dichterin. Getrieben durch die Ängste und Sorgen, die ihr Leben nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 beschwerten, begann sie vermehrt über dieses Thema zu schreiben. In ihren veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen von 1933 bis 1945 verarbeitete sie die erlebten Grausamkeiten und machte sie für die Nachwelt zugänglich. Ihre hinterlassenen Gedichte, Kurzgeschichten und Zeitungsartikel bezeugen ein Leben, welches eine Kehrtwendung von einem glücklichen Leben hin zu großem Leid durchlebte und erzählen aus der Sicht einer Frau, die sich zeitlebens nie als Lyrikerin verstand. Vielmehr hatte sie immer den Drang das Leben anderer Menschen zu verbessern und opferte sich in ihrer Arbeit und sozialem Engagement der Menschheit.
Die wiederkehrenden Problematiken, entstanden durch die Vertreibung aus Deutschland und dem Leben im Exil, sollen im Folgenden in ihren Gedichten analysiert werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit ihre Lyrik autobiografisch gelesen werden kann und wie sich diese Annahme bestätigen lässt. Verändert sich dadurch die Sichtweise auf das Lebensschicksal von Hertha Nathorff und damit vielleicht die Wahrnehmung des Schicksals von Jüdinnen, die die Zeit des Nationalsozialismus überlebten? Dieser Frage wird bei der Analyse und Interpretation einiger ausgewählter Gedichte nachgegangen. Dazu müssen Parallelen zur Biografie und historischen Ereignissen hergestellt werden. Zuerst soll Hertha Nathorffs Lebensgeschichte erzählt werden, da sie bei der Bezugnahme im späteren Verlauf immer wieder eine Rolle spielen wird. Dann werden die Tagebuchaufzeichnungen und die darin integrierten Gedichte näher betrachtet. An ausgewählten Gedichten wird eine Analyse und Interpretation vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lebensgeschichte
- Das Tagebuch der Hertha Nathorff
- Gedichte im Tagebuch
- Autobiografischer Zusammenhang
- Gedicht vom 2. Juni 1933
- Gedicht vom 20. Mai 1934
- Gedicht vom 3. Februar 1939
- Gedichtband „Stimmen der Stille“
- An den Leser:
- An meinen Mann Heimat - wo?
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit widmet sich der Analyse der Lyrik von Hertha Nathorff, einer jüdischen Ärztin und Dichterin, die während der NS-Zeit Erfahrungen von Verfolgung und Exil machte. Ziel der Untersuchung ist es, die autobiografischen Bezüge in ihren Gedichten aufzudecken und zu beleuchten, wie diese die Sichtweise auf das Schicksal von Hertha Nathorff und den Holocaust verändern.
- Die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf das Leben von Hertha Nathorff
- Die Rolle von Literatur als Ausdruck persönlicher Erfahrungen und Leidens
- Die Beziehung zwischen Biografie und Lyrik
- Die Rezeption von Nathorffs Werk im Kontext des Holocaust
- Die Auseinandersetzung mit Themen wie Flucht, Exil und Verlust
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über das Leben und Werk von Hertha Nathorff und die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit ihrer Lebensgeschichte und beschreibt ihren Werdegang als Ärztin, ihre Erfahrungen unter dem Nationalsozialismus und die Emigration in die Vereinigten Staaten. Das dritte Kapitel befasst sich mit Nathorffs Tagebuch, in dem sie die Ereignisse und ihre Gedanken festhielt. Es werden einzelne Gedichte aus dem Tagebuch analysiert und ihr autobiografischer Kontext beleuchtet. Das vierte Kapitel widmet sich dem Gedichtband „Stimmen der Stille“ und untersucht die Themen und Motive, die in ihren Gedichten zum Ausdruck kommen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe, die in dieser Arbeit behandelt werden, sind: Hertha Nathorff, jüdische Dichterin, Lyrik, Autobiografie, Nationalsozialismus, Holocaust, Verfolgung, Exil, Flucht, Verlust, „Stimmen der Stille“, Tagebuch, „Aufbau“, Deutsch-Amerikanische Hausfrauenstunde, deutschsprachige Literatur im Exil.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Literatur einer Jüdin. Eine Analyse Hertha Narthoffs Lyrik auf autobiographische Elemente, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1033322