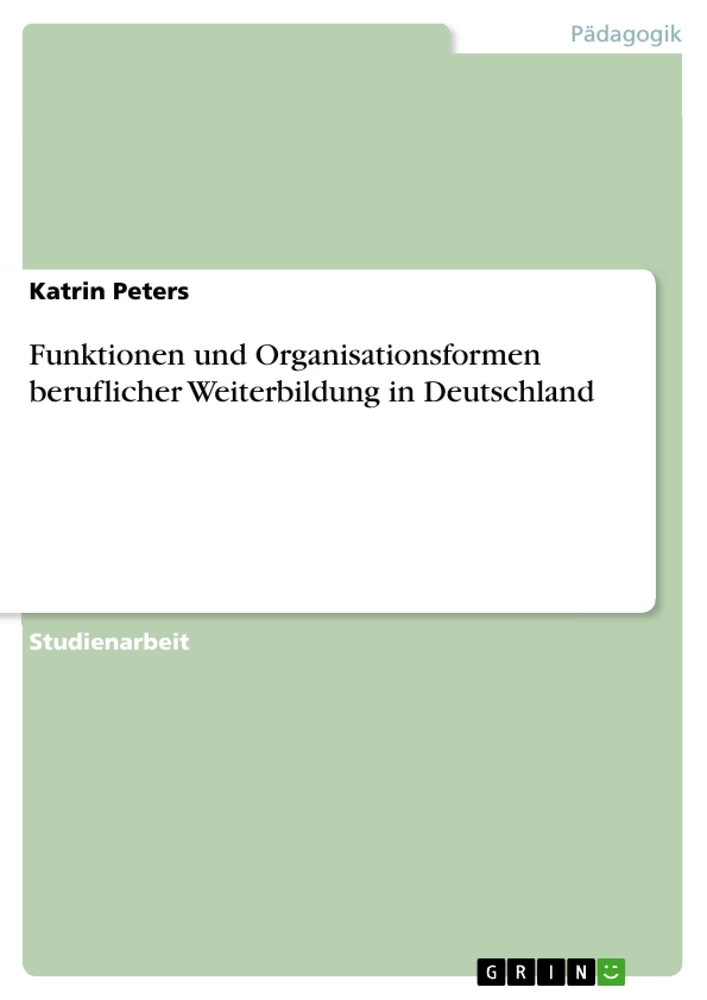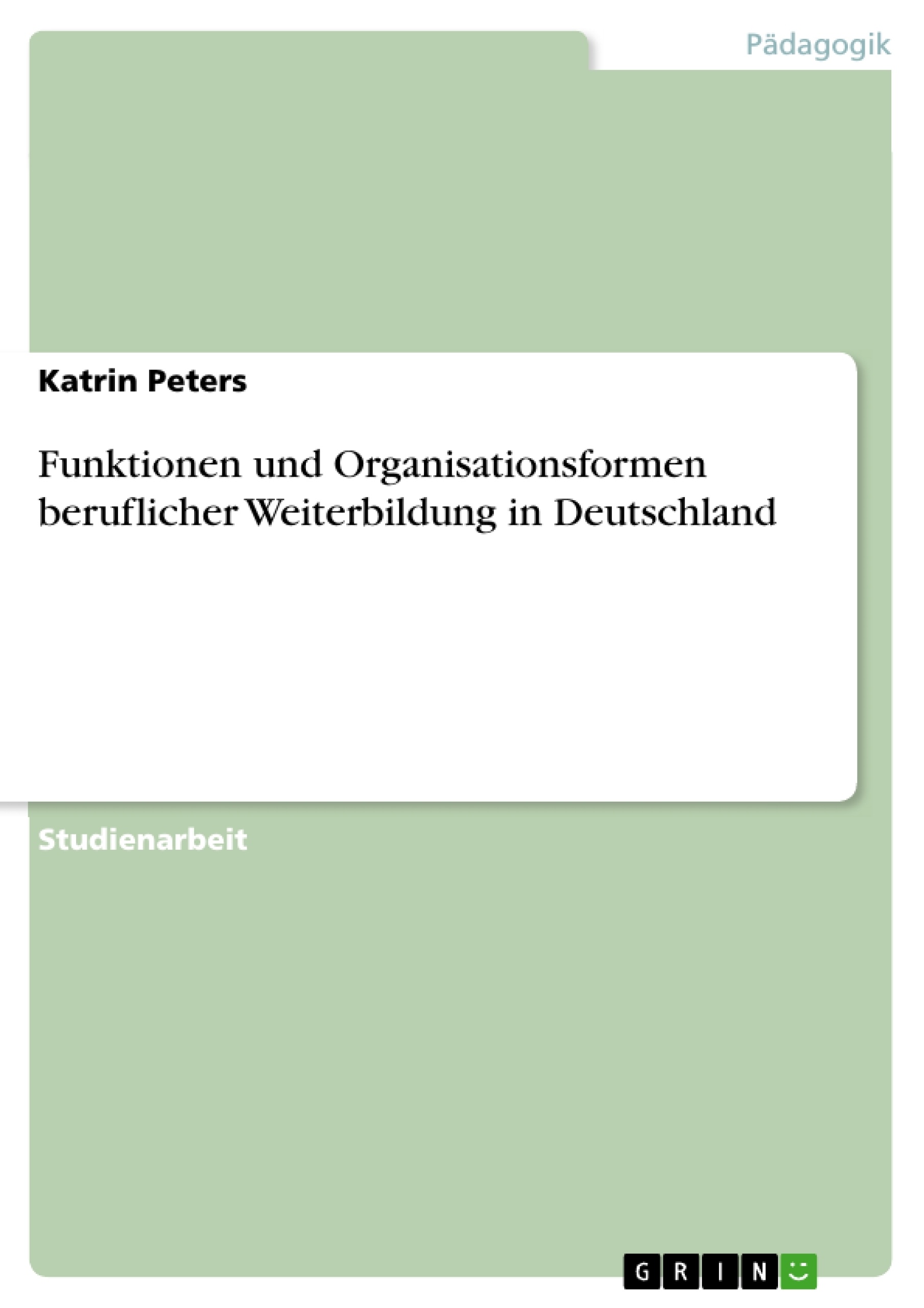Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
- Einführung in das Thema
- Aktuelle Situation in Deutschland
2. Merkmale beruflicher Weiterbildung und Stellung im deutschen Bildungssystem
- Strukturübersicht
- Anbieterpluralismus
- Marktwirtschaftliche Organisation
- Subsidiäre Rolle des Staates
3. Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die berufliche Weiterbildung
- Der technologische Wandel
- Demographische Entwicklungen
- Gesellschaftlicher Wertewandel und ökologische Neuorientierung
- Veränderungsprozesse im Rahmen der deutschen Vereinigung
- Arbeitslosigkeit
- Wissenschaftliche Auseinandersetzung
- Internationalisierung
- Einstellung der Unternehmensführungen
- Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft
4. Anforderungen an die berufliche Weiterbildung als Konsequenz der expansiven Entwicklung
- Planmäßige Qualifizierungsstrategien
- Aufbau des beruflichen Bildungssystems
- Verrechtlichung
- Finanzierungs- und Budgetierungsnormen
- Personalqualifizierung
5. Qualifizierungszwecke der beruflichen Weiterbildung
- Funktionsbereiche
- Umschulung
- Fortbildung
- Der Erwerb von Schlüsselqualifikationen
6. Die AFG- geförderte Weiterbildung
- Ziele des Arbeitsförderungsgesetzes
- Tabelle Eintritte und Ausgaben
- Die Randgruppen des Arbeitsmarktes
7. Die betriebliche Weiterbildung
- Strukturübersicht
- Untersuchung der betrieblichen Weiterbildung im Rahmen des Force- Programms 1997
- Die betriebliche Einarbeitung
- Lernförderung am Arbeitsplatz
8. Die individuelle Weiterbildung
- Tabelle „Vor- und Nachteile“
- Fernunterricht
- CBT und telelernen
9. Bestehende Defizite der beruflichen Weiterbildung in Deutschland
- Zugangsbarrieren
- Die vier Schwachstellen
10. Innovative Weiterbildungskonzepte
- Berufliche Weiterbildung der Industrie- und Handelskammern
- Berufliche Weiterbildung der Deutschen Angestellten Akademie
- Volkshochschulen
11. Persönliche Anmerkungen zum Thema
12.Literaturliste
1. Einleitung
Bildung gilt heutzutage als Voraussetzung für jeden Menschen, um sich als selbstbewusstes Mitglied in der Gesellschaft zu entfalten und ebenso als Bedingung um zur Entwicklung zur demokratischen und ökonomischen Gesellschaft beitragen zu können.
Allerdings gewinnt erst seit den siebziger Jahren die Vorstellung von der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens für alle Menschen an Bedeutung und geht dadurch ein in die deutsche Bildungspolitik. Zur Entfaltung der Persönlichkeit und der Sicherung des gesellschaftlichen Fortschritts entsteht ein gesamtgesellschaftliches Interesse an beruflicher, politischer und wissenschaftlicher Weiterbildung. Dieses öffentliche Interesse wird erstmals 1970 im Kontext der Bildungsreform vom Deutschen Bildungsrat im Strukturplan für das Bildungswesen formuliert:
„Immer mehr Menschen müssen durch organisiertes Lernen neue Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerben können, um den wachsenden und wechselnden beruflichen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden“ (Deutscher Bildungsrat 1972, S.51)
Die Bund- Länder- Kommission für Bildungsplanung definiert Weiterbildung als „Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase“ (Bund- Länder- Kommission für Bildungsplanung 1974, S.11)
Nach den Vorstellungen des Strukturplans bezeichnet Weiterbildung als Bildungssystembegriff einen eigenständigen Bereich des Bildungswesens, somit greift der Strukturplan auch das bildungspolitische Ziel auf, die traditionelle Trennung von beruflicher und allgemeiner Weiterbildung zu überwinden.
Weiterbildung ist der jüngste Teilbereich unseres Bildungssystems. Ihre Entwicklung zum integralen Bestandteil, zur vierten Säule (Quartärbereich) des Gesamtsystems ist noch nicht abgeschlossen. Sie wurde und wird immer noch von zahlreichen Entwicklungstrends in der deutschen Gesellschaft geprägt. In Kapitel 3 stelle ich diese näher vor, um Ihnen einen groben Überblick über die Entwicklung insgesamt und um Ihnen die daraus resultierenden Funktionen, die die berufliche Weiterbildung erfüllt bzw. erfüllen sollte, nachvollziehbar darzustellen.
Allgemein bahnt sich auf allen Ebenen unseres Bildungssystems ein Wandel an, der sich im Bereich der beruflichen Bildung bereits sehr deutlich vollzieht. An die Stelle der „Bildung auf Vorrat“ für die späteren Rollen in Beruf und Gesellschaft tritt im Bereich der Berufsbildung, aber nicht nur dort, zunehmend die Weiterbildung als eine Form der „just-in-time“
-Qualifizierung. Dabei verliert der Beruf mehr und mehr seine Funktion als kalkulierbares Muster für die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. Eine berufliche Erstausbildung stellt nur noch selten eine Vorbereitung für den Lebensberuf dar.
„Wer berufliche Weiterbildung einschränkt, verhält sich wie jemand, der die Uhr anhält, um Zeit zu sparen.“ (Döring, K. 1991, S.?)
Nicht mehr die Ausbildung in der Schule, in der Hochschule oder in der Lehre produziert heute das Bildungskapital, sondern, und diese Tendenz wird sich nach vielen Autorenmeinungen noch verstärken, die (berufliche) Weiterbildung. Sozialer Status, Einkommen, gesellschaftliche Privilegien und Anerkennung hängen dann weniger von der Ausbildung als von der Weiterbildung ab.
Erwachsensein kann somit nicht mehr verstanden werden als ein Entwachsensein aus gesellschaftlichen Lernanforderungen, sondern als ständige Erweiterung von Fachkompetenzen und Qualifikationen, wobei der Erwerb von Schlüsselqualifikationen (überfachlichen Qualifikationen) eine besonders wichtige Rolle spielt, deren Funktion ich in Kapitel 5 darstelle.
Die berufliche Weiterbildung hat in den letzten Jahren, gemessen an der Beteiligung und den finanziellen Aufwendungen, erheblich expandiert. Weiterbildung ist zu einem zentralen Faktor der Innovation und Produktivität geworden.
Die Darstellung der Weiterbildung in Deutschland kann sich nur auf eine uneinheitliche und zum Teil sehr schmale Datenbasis stützten, denn es gibt keine umfassende „amtliche“ Weiterbildungsstatistik, soweit ich das in meiner Literaturrecherche herausgefunden habe.
2. Merkmale beruflicher Weiterbildung und Stellung im deutschen Bildungssystem
Eine einheitliche Definition über die berufliche Weiterbildung existiert nicht. In der Literatur gibt es jedoch eine Aussage, die die berufliche Weiterbildung als „Lehr- und Lernprozesse..., die das Ziel haben, auf der Grundlage eines erlernten oder ausgeübten Berufes berufsspezifische und berufswichtige Kenntnisse, Fertigkeiten, Einsichten und/oder Verhaltensweisen zu festigen, zu vertiefen oder zu erweitern“ definiert. (Schmiel, 1977, S.5)
In der Gesetzgebung des Bundes umfasst die berufliche Weiterbildung sowohl die berufliche Fortbildung als auch die berufliche Umschulung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Strukturübersicht entspricht nicht ganz den rechtlich fixierten Grundsätzen des Berufsbildungsgesetzes, erfasst aber dennoch die bestehenden Weiterbildungsformen.
Auf der einen Seite steht der Bereich der hier nicht zu behandelnden Erwachsenenbildung, die sich ihrerseits noch einmal in politische Weiterbildung und in eine Erweiterung der Grundbildung unterteilen lässt. Auf der anderen Seite steht die berufliche Weiterbildung mit ihren Teilgebieten der Fortbildung, Umschulung und dem Lernen am Arbeitsplatz.
Hier handelt es sich um eine Mischform aus verschiedenen in der Literatur existierenden Strukturübersichten. Einige Autoren unterscheiden die politische von der allgemeinen Weiterbildung und/oder erwähnen bei der beruflichen Weiterbildung nicht das Lernen am Arbeitsplatz.
Die Weiterbildung unterscheidet sich von anderen Teilen des Bildungssystems durch die folgenden 3 hervorstechenden Merkmale:
1. Anbieterpluralismus
Weiterbildung findet nicht nur in ganz unterschiedlichen Bereichen statt, sondern es besteht auch eine große Vielzahl von Anbietern, weswegen von einem bestehenden Anbieterpluralismus gesprochen wird.
Zu den Anbietern gehören zum Beispiel:
- Betriebe
- Staatliche, kommunale und öffentliche Träger
- Arbeitgeber und Gewerkschaften
- Berufsverbände, Fachverbände
- Private, kommerzielle/ gemeinnützige Träger
2. Marktwirtschaftliche Organisation
Es besteht ein offener Weiterbildungsmarkt, der durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, d.h. dass die Entscheidung, ob an einer Bildungsmaßnahme teilgenommen wird oder nicht, von den Kosten und von der Leistung des Anbieters abhängt. Somit stehen die Weiterbildungsanbieter in einem Konkurrenzverhältnis zueinander.
3. Subsidiäre Rolle des Staates
Es bestehen nur wenige Gesetze und Normierungen, die das Weiterbildungssystem regeln. Der Staat wird nur dann tätig, wenn seine Sozialpflicht angesprochen wird, d.h. er wird nur subsidiär tätig. Wie schon in der Einleitung erwähnt, hat die Bedeutung der Weiterbildung in den letzten Jahren enorm zugenommen. Wenn in dieser Situation gesellschaftliche Randgruppen weder die finanzielle Kraft, noch das Engagement besitzen, um dieser gesellschaftlichen Anforderung gerecht zu werden, tritt der Staat ein. (Siehe auch Afg- geförderte Weiterbildung)
Weiter lassen sich noch folgende Merkmale nennen:
- Multifunktionalität,
- Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern, die daraus resultierende Zersplitterung der Rechtsgrundlagen und die unterschiedliche finanzielle Förderung,
- Intransparenz für alle Beteiligten,
- fehlender Konsens durch Interessenskonflikte der Sozialparteien
- und Mischfinanzierung zwischen Wirtschaft und Staat
3. Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die berufliche Weiterbildung
„Weiterbildung wird von motivationalen Faktoren, sozio- demographischen Faktoren, wirtschaftsstrukturellen Faktoren und beschäftigungsbezogenen Rahmenbedingungen beeinflusst.“ (Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, 1993)
Der technologische Wandel
„Durch technische Entwicklungen verändern sich die Anforderungen an Fähigkeiten und Fertigkeiten der Erwerbstätigen; dabei lassen wissenschaftlich-technischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum insgesamt einen vermehrten Bedarf an hohen Qualifikationen erwarten.“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S.54)
Es entsteht eine sich immer rascher vollziehende Wissensexplosion, die im Zusammenhang mit dem rasanten technologischen Wandel gesehen werden kann.
Der technologische Wandel wird als wesentlicher Antrieb der beruflichen Weiterbildung gesehen.
Die enormen Fortschritte im wissenschaftlich-technischen Bereich aufgrund einer immer stärkeren Spezialisierung und Professionalisierung der Forschung haben zu einer ständig kürzer werdenden Halbwertzeit von beruflichem Fachwissen geführt.
Die sich ständig ändernden Arbeitsbedingungen führen zu einem erhöhten Qualifikationsbedarf.
Demographische Entwicklungen
Die quantitative und qualitative Entwicklung der Bevölkerungsstruktur bildet eine Schlüsselgröße für die berufliche Weiterbildung.
Alle demographischen Prognosen weisen auf einen geradezu dramatischen Bevölkerungsrückgang mit einer entsprechend stark anwachsenden „Vergreisung“ unserer Gesellschaft hin. So wird sich beispielsweise der Anteil der 65 jährigen von heute etwa 20 % auf voraussichtlich 25% im Jahre 2030 erhöhen. Hinzu kommen sozialkulturelle Wandlungstendenzen, wie etwa der erhebliche Rückgang der Eheschließungen, die steigende Zahl der Einpersonenhaushalte, die weiter abnehmende Geburtenrate etc..
Die wachsende Erwerbsbeteiligung der Frauen, die anhaltende Zuwanderung von Aussiedlern und der abnehmende, aber weiterhin erhebliche Anteil von Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung beeinflussen ebenfalls das Weiterbildungsverhalten und die Weiterbildungsbeteiligung der Gesamtbevölkerung durch die Veränderung der Bevölkerungsstruktur.
Gesellschaftlicher Wertewandel und ökologische Neuorientierung
Der Wertewandel, wie man heute gern sagt, in der „postindustriellen“ Gesellschaft schreibt materiellen Werten wie Einkommen, Besitz und Verbrauch einen zunehmend geringeren Wert zu. Demgegenüber erleben nichtmaterielle Werte wie ökologische Lebensqualität, individuelle Freiheit und Selbstständigkeit, Freude an einer sinnvollen Arbeitstätigkeit usw. eine spürbare Aufwertung.
Steigende Ansprüche an die Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel Handlungsspielraum, Zeitsouveränität und kommunikative Aspekte führen automatisch dazu, dass der persönlichen Bildung vermehrt Beachtung geschenkt wird.
Außerdem besteht ein zunehmender gesellschaftspolitischer Trend zu mehr Freizeit. Durch den Rückgang der realen Arbeitszeit werden mehr individuelle Bewegungsspielräume auch für Lernen und Bildung geschaffen.
Veränderungsprozesse im Rahmen der deutschen Vereinigung
Der noch nicht abgeschlossene Umstrukturierungsprozess von der Plan- zur Marktwirtschaft in den neuen Bundesländern bedingt einen enormen Weiterbildungsbedarf der Erwerbsbevölkerung.
Hohe und sich verhärtende Arbeitslosigkeit
Berufliche Weiterbildung ist zu einem zentralen Instrument aktiver Arbeitsmarktpolitik geworden. Die seit Jahren bestehende hohe Sockelarbeitslosigkeit von durchschnittlich 2 Millionen hat natürlich die Frage aufkommen lassen, ob nicht mit gezielten Weiterbildungsmaßnahmen und dem systematischen Aufbau professioneller betrieblicher Weiterbildungssysteme ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen bewirkt werden kann.
Wissenschaftliche Auseinandersetzung
Durch eine stärkere wissenschaftliche Beschäftigung mit Problemen der beruflichen Bildung und des Lernens Erwachsener und aufbauend auf die überraschend hohe Lern- und Leistungsfähigkeit des älter werdenden Menschen wird die enorme Bedeutung von Weiterbildung vielfach betont.
Internationalisierung der Wirtschaft
Die weltwirtschaftliche Integration ist für die berufliche Weiterbildung von Bedeutung, weil sie nicht zuletzt die Einkommens- und Beschäftigungschancen der Erwerbspersonen insgesamt sowie jede einzelne Person in Abhängigkeit von ihrer beruflichen Qualifikation beeinflusst.
Die Entwicklung einer „Europakompetenz“ im Rahmen eines fortschreitenden europäischen Einigungsprozesses ist dabei ebenfalls zu erwähnen. Dazu gehören nicht nur verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten im Sinne von mehr Fremdsprachenkenntnissen, sondern auch mehr Kenntnisse über die Geschichte und die Kultur der Nachbarn.
Veränderung der Einstellungen in den Unternehmensführungen
Es setzt sich in den Führungsetagen wandlungsfähiger Unternehmen zunehmend die Einsicht durch, das tayloristische, hocharbeitsteilige Strukturen nicht nur produktivitätshemmend sind, sondern in hohem Maße vorhandene Potentiale brachliegen lassen und demotivierend wirken. Eine effiziente Organisations- und Führungsstruktur, die im wesentlichen eine Dezentralisierung von Entscheidungen, einen Abbau von Hierarchiestufen, Integration und Gruppenarbeit beinhaltet, erzeugt wachsenden Qualifizierungsbedarf und eine erhöhte Lernbereitschaft auch für Beschäftigte in den operativen Bereichen.
Von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
Die Entwicklung zur größeren Bedeutung von Dienstleistungsberufen ist eindeutig. Es handelt sich überwiegend um technisch-produktionsorientierte Dienstleistungen und um personale und soziale Dienstleistungen.
Nach den Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesanstalt für Arbeit und des Prognos-Institut wandelt sich die Arbeitsgesellschaft langsam aber tiefgreifend. Handel, Banken, Versicherungen, Verkehrs- und Nachrichtenwesen, private und öffentliche Dienste gewinnen an Bedeutung.
Dieser Trend zum Anstieg der Dienstleistungsbereiche bedingt eine Höher- bzw. Andersqualifizierung und erfordert somit berufliche Weiterbildung.
4. Anforderungen an die berufliche Weiterbildung als Konsequenz der expansiven Entwicklung
Notwendigkeit zu planmäßigen Qualifizierungsstrategien
Es ist nicht mehr der Arbeitsmarkt allein, an dem sich Umfang, Art und Inhalt der beruflichen Qualifikation orientieren muss, vielmehr sollen die in einer Gesellschaft vorhandenen beruflichen Qualifikationen auf die Formen der Arbeit einwirken. Die Gestaltung der Arbeitsplätze ist abhängig von dem Tätigkeitsangebot, das beruflich qualifizierte machen können. Berufliche Weiterbildung darf sich folglich nicht nur an den gerade vorfindbaren Qualifikationsanforderungen orientieren und sich nicht nur auf die Vermittlung von Tüchtigkeit beschränken, sondern muss auch berufliche Mündigkeit der Menschen entwickeln. Mündig ist ein Mensch dann, wenn er seine berufliche Tätigkeit hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Vorraussetzungen und Folgen reflektieren kann und neben seinen Schlüsselqualifikationen auch über Kritikkompetenz verfügt.
Wenn sich die Arbeitsanforderungen im Zuge der technologischen Modernisierungsprozesse derartig schnell auf der inhaltlichen Seite ändern, muss ein wesentlicher Bestandteil der beruflichen Weiterbildung in der Vermittlung von Qualifikationen liegen, die den Arbeitnehmer dazu befähigen, genau diese Wandlungstendenzen bewältigen zu können.
Daher nehmen die erwähnten Schlüsselqualifikationen einen immer höheren Stellenwert ein.
Um den demographischen Entwicklungen entgegenzutreten wird eine stärkere Einbindung der älteren Arbeitnehmer in die Maßnahmen beruflicher Weiterbildung erforderlich, Frauen als Zielgruppe beruflicher Weiterbildung müssen verstärkt berücksichtigt werden und auch Ausländer müssen in die Weiterbildung mit eingebunden werden.
Notwendigkeit des Aufbaus des beruflichen Bildungssystems
Aufgrund des steigenden Qualifikationsniveaus und aufgrund der Tatsache, dass viele ihre Qualifikationen auffrischen bzw. erweitern müssen, muss auf ein hohes Maß an Qualität und Aktualität bei der beruflichen Weiterbildung geachtet werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält.
Was sind die Hauptthemen in diesem Dokument zur beruflichen Weiterbildung?
Die Hauptthemen umfassen: die Merkmale der beruflichen Weiterbildung, Entwicklungen und deren Auswirkungen, Anforderungen an die berufliche Weiterbildung, Qualifizierungszwecke, AFG-geförderte Weiterbildung, betriebliche Weiterbildung, individuelle Weiterbildung, bestehende Defizite und innovative Weiterbildungskonzepte.
Welche Entwicklungen haben Auswirkungen auf die berufliche Weiterbildung?
Der technologische Wandel, demographische Entwicklungen, gesellschaftlicher Wertewandel, ökologische Neuorientierung, Veränderungsprozesse im Rahmen der deutschen Vereinigung, Arbeitslosigkeit, wissenschaftliche Auseinandersetzung, Internationalisierung, veränderte Einstellungen in Unternehmensführungen und die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft.
Welche Qualifizierungszwecke hat die berufliche Weiterbildung?
Die berufliche Weiterbildung dient der Umschulung, Fortbildung und dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen.
Welche Merkmale hat die berufliche Weiterbildung im deutschen Bildungssystem?
Die berufliche Weiterbildung zeichnet sich durch Anbieterpluralismus, marktwirtschaftliche Organisation und eine subsidiäre Rolle des Staates aus.
Welche Anbieter gibt es im Bereich der beruflichen Weiterbildung?
Zu den Anbietern gehören Betriebe, staatliche, kommunale und öffentliche Träger, Arbeitgeber und Gewerkschaften, Berufsverbände, Fachverbände sowie private, kommerzielle und gemeinnützige Träger.
Welche Defizite gibt es in der beruflichen Weiterbildung in Deutschland?
Zu den Defiziten gehören Zugangsbarrieren und vier Schwachstellen, die im Dokument näher erläutert werden.
Welche innovativen Weiterbildungskonzepte werden erwähnt?
Die berufliche Weiterbildung der Industrie- und Handelskammern, der Deutschen Angestellten Akademie und der Volkshochschulen.
Warum wird die berufliche Weiterbildung als wichtig angesehen?
Bildung, insbesondere Weiterbildung, gilt als Voraussetzung für die persönliche Entfaltung und die Entwicklung der Gesellschaft. Sie ist ein zentraler Faktor für Innovation und Produktivität.
Welche Rolle spielt die AFG-geförderte Weiterbildung?
Die AFG-geförderte Weiterbildung zielt darauf ab, die Ziele des Arbeitsförderungsgesetzes zu erreichen und Randgruppen des Arbeitsmarktes zu unterstützen.
- Quote paper
- Katrin Peters (Author), 2000, Funktionen und Organisationsformen beruflicher Weiterbildung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103376