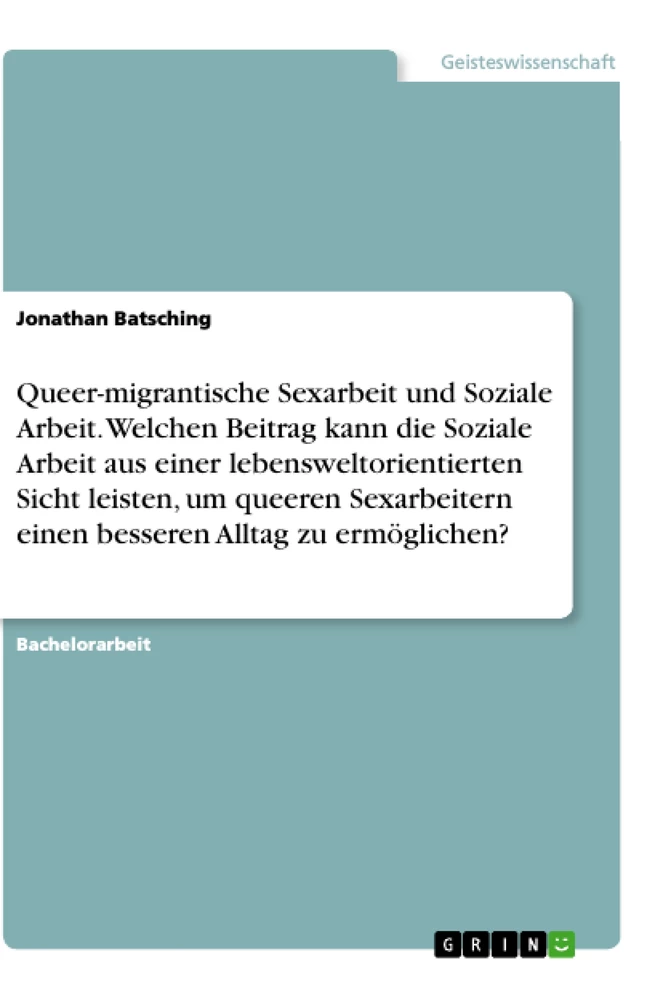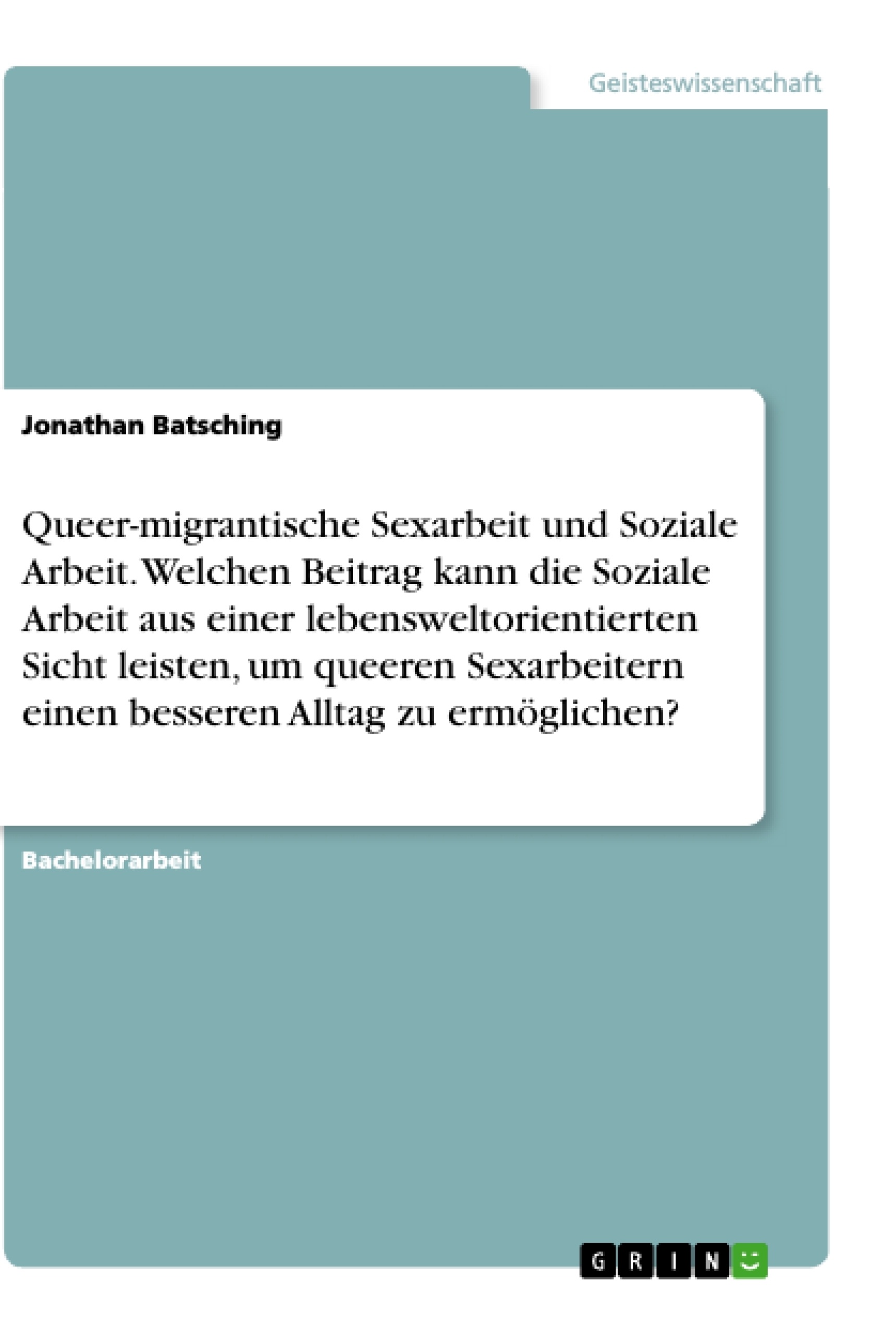Zu Beginn der Arbeit wird in Kapitel 2. ein Überblick über die zentralen Begriffe gegeben. Hierbei soll vor allem durch die Aufteilung der Begriffe "Queer", "Migration" und "Sexarbeit" ein erster Einblick für die Leser*innen geschaffen werden, um zu verstehen welche Personengruppe gemeint ist und welcher Tätigkeit diese nachgeht. Die Sexarbeit als Arbeit wird außerdem ausführlicher im 2. Kapitel ausgeführt, da der Bereich und die Szene der Sexarbeit ein komplexes und vielfältiges Feld ist.
In dieser Arbeit wird sich hauptsächlich der mann-männlichen Prostitution gewidmet. Hierbei wird zunächst ein kurzer Überblick über den Ursprung der mann-männlichen Prostitutionsszene gegeben. Anschließend wird auf die Sexarbeiter*innen und deren Kund*innen eingegangen, mit dem Versuch einer Definition.
Das 3. Kapitel widmet sich der rechtlichen und politischen Lage der Sexarbeit. In diesem Kapitel wird das im Jahre 2002 in Kraft getretene Prostitutionsgesetz, das in 2017 darauf aufbauende Prostituiertenschutzgesetz und das Infektionsschutzgesetz näher erläutert. Die Orte und Erscheinungsformen der Sexarbeit von Cis-Männern und queer-refugees werden in Kapitel 4. definiert.
Das 5. Kapitel setzt sich mit Queerness und Flucht auseinander. Zu Beginn wird darauf eingegangen, wie sich die Unterstützungsangebote seit dem Sommer der Migration in 2015 in Deutschland verändert haben. Weiter werden in diesem Kapitel die Gründe genannt, weshalb queere Menschen aus ihren Heimatländern fliehen und welche Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen die queer-refugees beim Ankommen in Deutschland machen. Dabei wird im letzten Abschnitt des Kapitels, die Erfahrung von Rassismus und Ethnosexismus genauer erläutert.
Im 6. Kapitel werden die Lebens- und Problemlagen von queer-migrantischen Sexarbeiter*innen aufgeführt. Die Problemlagen werden in diesem Kapitel ausführlicher beschrieben, da diese der Ansatzpunkt für die Soziale Arbeit sind und aufzeigen, wie die Soziale Arbeit die Sexarbeiter*innen unterstützen kann, um ihnen einen gelingenderen Alltag zu ermöglichen.
Abschließend wird im 7. Kapitel die Soziale Arbeit aus einer lebensweltorientierten Sicht betrachtet, wie diese die queer-migrantischen Sexarbeiter*innen unterstützen kann und welche Kompetenzen Sozialarbeiter*innen hierfür mitbringen sollten. Abschließend wird in diesem Kapitel auf die aktuelle Situation eingegangen und über die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie berichtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aufbau der Arbeit...
- 1.2 Sommer der Migration in 2015.
- 2. Begriffsbestimmung....
- 2.1 Queer.
- 2.2 Migration..........\li>
- 2.3 Sexarbeit.
- 2.3.1 Mann-männliche Prostitution....
- 2.3.2 Sexarbeiter*innen...........
- 2.3.3 Kund*innen...........
- 2.4 Queer-migrantische Sexarbeit...
- 3. Rechtliche und politische Rahmungen
- 3.1 Prostitutionsgesetz...
- 3.2 Prostituiertenschutzgesetz
- 3.3 Infektionsschutzgesetz ....
- 3.4 Rechtlicher Rahmen der queer-migrantischen Sexarbeit...
- 4. Orte und Erscheinungsformen der Sexarbeit von Cis-Männern und queer-refugees...\li>
- 4.1 Prostitution in öffentlichen Räumen....
- 4.2 Prostitution in halböffentlichen Räumen..\li>
- 4.3 Prostitution in virtuellen Räumen......
- 5. Queerness und Flucht.....
- 5.1 (Queer-)Refugees Unterstützung seit dem Sommer der Migration .........
- 5.2 Queerfeindlichkeit in den Herkunftsländern
- 5.3 Ethnosexismus und Rassismus als Erfahrung des Ankommens in Deutschland
- 6. Lebens- und Problemlagen von queer-migrantischen Sexarbeitenden..
- 6.1 Lebenslagen.........
- 6.1.1 Motivation der Sexarbeitenden…......
- 6.2 Problemlagen ......
- 6.2.1 Gesellschaftliche Aspekte.........
- 6.2.1.1 Heteronormativität..\li>
- 6.2.1.2 Stigmatisierung........
- 6.2.2 STI.......………………………….
- 6.2.3 Sucht...\li>
- 6.2.4 Gewalt..........\li>
- 6.2.5 Psychische Folgen
- 7. Soziale Arbeit im Bereich der queer-migrantischen Sexarbeit ................
- 7.1 Die lebensweltorientierte Theorie..\li>
- 7.2 Leitlinien für die lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit queer-migrantischen Sexarbeiter*innen ……......
- 7.3 Ziele der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit mit queer-migrantischen Sexarbeiter*innen
- 7.4 Gesundheitsfördernde und präventive Ansätze der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit mit queer-migrantischen Sexarbeiter*innen ......
- 7.5 Arbeitsbereiche und Methoden der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit mit queer-migrantischen Sexarbeiter*innen
- 7.6 Anforderungen an die Sozialarbeiter*innen.
- 7.7 Aktuelles
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Situation von queer-migrantischen Sexarbeiter*innen in Deutschland und analysiert den Beitrag, den die Soziale Arbeit aus einer lebensweltorientierten Perspektive leisten kann, um den Alltag dieser Menschen zu verbessern. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Lebens- und Problemlagen von queer-migrantischen Sexarbeiter*innen zu beleuchten und Lösungsansätze aus der Sozialen Arbeit aufzuzeigen.
- Diskriminierungserfahrungen von queer-migrantischen Sexarbeiter*innen
- Rechtliche und politische Rahmungen der Sexarbeit
- Lebenslagen und Problemlagen von queer-migrantischen Sexarbeitenden
- Potenziale der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit für queer-migrantische Sexarbeiter*innen
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beleuchtet die Bedeutung des Themas queer-migrantische Sexarbeit in der heutigen Gesellschaft. Sie führt den Leser*in in die Thematik ein und erläutert die Relevanz der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit in diesem Kontext.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Begriffsbestimmung von Queerness, Migration und Sexarbeit. Hier werden die zentralen Konzepte der Arbeit definiert und die relevanten wissenschaftlichen Diskurse beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen der Sexarbeit in Deutschland. Es werden verschiedene Gesetze und Regelungen betrachtet, die die Situation von Sexarbeiter*innen beeinflussen.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Orte und Erscheinungsformen der Sexarbeit von Cis-Männern und queer-refugees. Es werden verschiedene Formen der Prostitution, wie beispielsweise die in öffentlichen, halböffentlichen und virtuellen Räumen, dargestellt.
Das fünfte Kapitel untersucht die Schnittstelle von Queerness und Flucht und betrachtet die spezifischen Herausforderungen, denen queer-migrantische Menschen in Deutschland begegnen. Es beleuchtet die Unterstützung, die diese Menschen seit dem Sommer der Migration 2015 erhalten haben und diskutiert die Folgen von Queerfeindlichkeit in den Herkunftsländern und Ethnosexismus in Deutschland.
Das sechste Kapitel widmet sich den Lebens- und Problemlagen von queer-migrantischen Sexarbeitenden. Es werden die Lebenslagen und Motivationen dieser Menschen analysiert, sowie die Herausforderungen, die sie aufgrund der Stigmatisierung, Heteronormativität, sexuell übertragbaren Infektionen, Sucht, Gewalt und psychischer Folgen erleben.
Das siebte Kapitel thematisiert die Rolle der Sozialen Arbeit im Bereich der queer-migrantischen Sexarbeit. Es stellt die lebensweltorientierte Theorie vor und entwickelt Leitlinien für die lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit queer-migrantischen Sexarbeiter*innen. Es werden zudem die Ziele und Arbeitsbereiche der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit beleuchtet und Anforderungen an Sozialarbeiter*innen formuliert.
Schlüsselwörter
Queer-migrantische Sexarbeit, Soziale Arbeit, Lebensweltorientierung, Diskriminierung, Stigmatisierung, Heteronormativität, Prostitution, Rechtliche Rahmenbedingungen, Ethnosexismus, Sucht, Gewalt, Psychische Folgen, Unterstützung, Handlungsempfehlungen.
- Quote paper
- Jonathan Batsching (Author), 2021, Queer-migrantische Sexarbeit und Soziale Arbeit. Welchen Beitrag kann die Soziale Arbeit aus einer lebensweltorientierten Sicht leisten, um queeren Sexarbeitern einen besseren Alltag zu ermöglichen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1033784