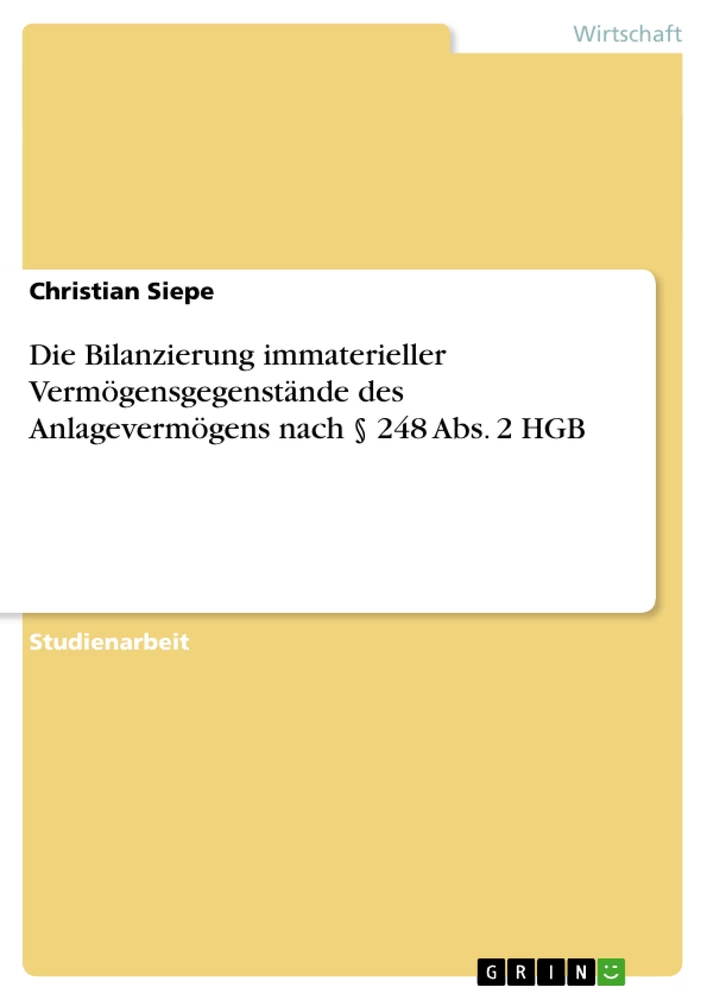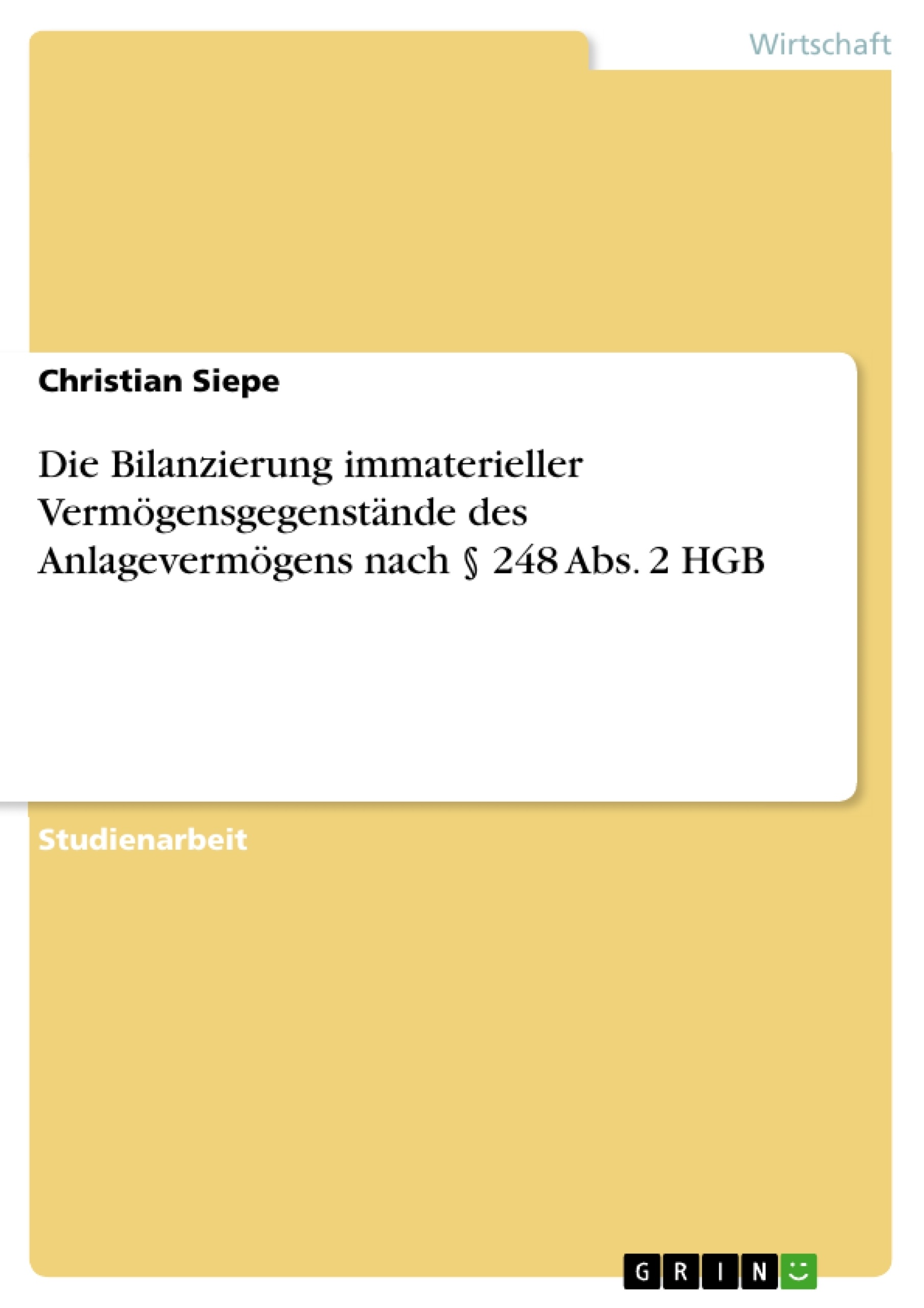Bereits im Jahre 1979 bezeichnete Moxter die immateriellen Anlagenwerte als ewige Sorgenkinder des Bilanzrechts.1 Diese Aussage hat bis heute Gültigkeit und gewinnt angesichts der zunehmenden Bedeutung immaterieller Vermögensgegenstände mehr denn je an Aktualität.2 Denn immaterielle Güter zeichnen sich durch besondere Unsicherheiten in bezug auf ihre Werthaltigkeit und ihren Nutzungsverlauf aus. Vielfältige Erscheinungsformen und die Entstehung immer neuer immaterieller Vermögensgegenstände verstärken die Problematik und lassen eine abschließende bilanzrechtliche Beurteilung nicht zu.3
Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit ist § 248 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) zu sehen. Durch das darin formulierte Aktivierungsverbot selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände, trägt der Gesetzgeber dem in den deutschen Rechnungslegungsvorschriften verankerten Vorsichtsprinzip Rechnung. Der Gläubigerschutz erfährt gegenüber dem Aktionärschutz eine höhere Wertigkeit.
[...]
1 Vgl. Moxter, A. (Immaterielle Anlagewerte im neuen Bilanzrecht, BB 1979, S. 1102 ff.) zit. nach: Niemann, U. (1999), S. 1
2 Vgl. Niemann, U. (1999), S. 1
3 Vgl. Glade, H.-J. (1991), S. 1
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Analyse des § 248 Abs. 2 HGB.
- 2.1 Begriffliche Grundlagen
- 2.1.1 Die Merkmale des Vermögensgegenstandes und seine Aktivierungsfähigkeit.
- 2.1.2 Die Abgrenzung von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen
- 2.1.3 Die Abgrenzung von Anlage- und Umlaufvermögen
- 2.2 Entgeltlicher Erwerb als Ausdruck des Vorsichtsprinzips
- 2.2.1 § 248 Abs. 2 HGB als Kompromiss zweier divergierender GOB
- 2.2.2 Die Objektivierung immaterieller Vermögensgegenstände.
- 2.2.3 Das BFH-Urteil zu den Transferentschädigungen im Lizenzfußball
- 3. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Jahresabschluss.
- 3.1 Ansatz und Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen
- 3.1.1 Arten von immateriellen Vermögensgegenständen
- 3.1.2 Der Geschäfts- oder Firmenwert
- 3.1.3 Ausnahmen von § 248 Abs. 2 HGB in der Praxis
- 3.2 Auswirkungen der Bestimmung des § 248 Abs. 2 auf den Jahresabschluss
- 3.2.1 § 248 Abs. 2 HGB als Nachfolgeregelung von § 153 Abs. 3 AktG 1965
- 3.2.2 Die Bedeutung von § 248 Abs. 2 HGB für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
- 3.2.3 Kritische Würdigung und bilanzpolitische Einordnung von § 248 Abs. 2 HGB
- 4. Schlussbetrachtung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit der komplexen Thematik der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach § 248 Abs. 2 HGB. Im Zentrum der Betrachtung stehen die begrifflichen Grundlagen, die aktivierungsrechtlichen Vorgaben und die Auswirkungen auf den Jahresabschluss. Die wichtigsten Themenschwerpunkte der Arbeit lassen sich wie folgt zusammenfassen:- Analyse der begrifflichen Grundlagen von Vermögensgegenständen und ihrer Aktivierungsfähigkeit, insbesondere im Hinblick auf immaterielle Vermögensgegenstände
- Bewertung des entgeltlichen Erwerbs als Ausdruck des Vorsichtsprinzips im Kontext von § 248 Abs. 2 HGB
- Untersuchung der Ansatz- und Bewertungsregeln für immaterielle Vermögensgegenstände im Jahresabschluss
- Diskussion der Auswirkungen von § 248 Abs. 2 HGB auf die Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
- Kritische Würdigung und bilanzpolitische Einordnung von § 248 Abs. 2 HGB
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Die Analyse des § 248 Abs. 2 HGB
- Kapitel 3: Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Jahresabschluss
Dieses Kapitel stellt die Problematik der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände dar und verdeutlicht die aktuelle Relevanz des Themas im Kontext des Vorsichtsprinzips im deutschen Bilanzrecht.
Dieses Kapitel befasst sich mit den begrifflichen Grundlagen des § 248 Abs. 2 HGB, indem es die Merkmale von Vermögensgegenständen, die Unterscheidung zwischen materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen sowie die Abgrenzung von Anlage- und Umlaufvermögen beleuchtet.
Des Weiteren wird der entgeltliche Erwerb als Ausdruck des Vorsichtsprinzips analysiert und § 248 Abs. 2 HGB als Kompromiss zwischen divergierenden Rechnungslegungsgrundsätzen betrachtet.
Dieses Kapitel befasst sich mit den Regeln für den Ansatz und die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen im Jahresabschluss.
Es werden unterschiedliche Arten von immateriellen Vermögensgegenständen, wie z.B. der Geschäfts- oder Firmenwert, diskutiert und Ausnahmen von § 248 Abs. 2 HGB in der Praxis vorgestellt.
Das Kapitel analysiert zudem die Auswirkungen der Bestimmung des § 248 Abs. 2 HGB auf die Bilanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagevermögen, § 248 Abs. 2 HGB, Bilanzierung, Vorsichtsprinzip, Entgeltlicher Erwerb, Ansatz, Bewertung, Geschäfts- oder Firmenwert, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Rechnungslegung, Harmonisierung.Häufig gestellte Fragen
Dürfen selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert werden?
Gemäß § 248 Abs. 2 HGB besteht für bestimmte selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ein Aktivierungswahlrecht, wobei der Gesetzgeber das Vorsichtsprinzip betont.
Warum gilt der entgeltliche Erwerb als Voraussetzung für viele Aktivierungen?
Der entgeltliche Erwerb dient der Objektivierung des Wertes. Er stellt sicher, dass ein Marktwert existiert und verhindert willkürliche Wertansätze in der Bilanz.
Was ist der Unterschied zwischen Anlage- und Umlaufvermögen bei immateriellen Gütern?
Entscheidend ist die Zweckbestimmung: Anlagevermögen dient dauerhaft dem Geschäftsbetrieb, während Umlaufvermögen zur Veräußerung oder zum kurzfristigen Verbrauch bestimmt ist.
Wie werden Forschungs- und Entwicklungskosten nach HGB behandelt?
Während Entwicklungskosten unter bestimmten Bedingungen aktiviert werden dürfen, unterliegen Forschungskosten einem strikten Aktivierungsverbot.
Was versteht man unter dem Vorsichtsprinzip im Bilanzrecht?
Das Vorsichtsprinzip besagt, dass Vermögenswerte eher niedriger und Schulden eher höher bewertet werden sollten, um den Gläubigerschutz zu gewährleisten.
- Citar trabajo
- Christian Siepe (Autor), 2002, Die Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach § 248 Abs. 2 HGB, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10341