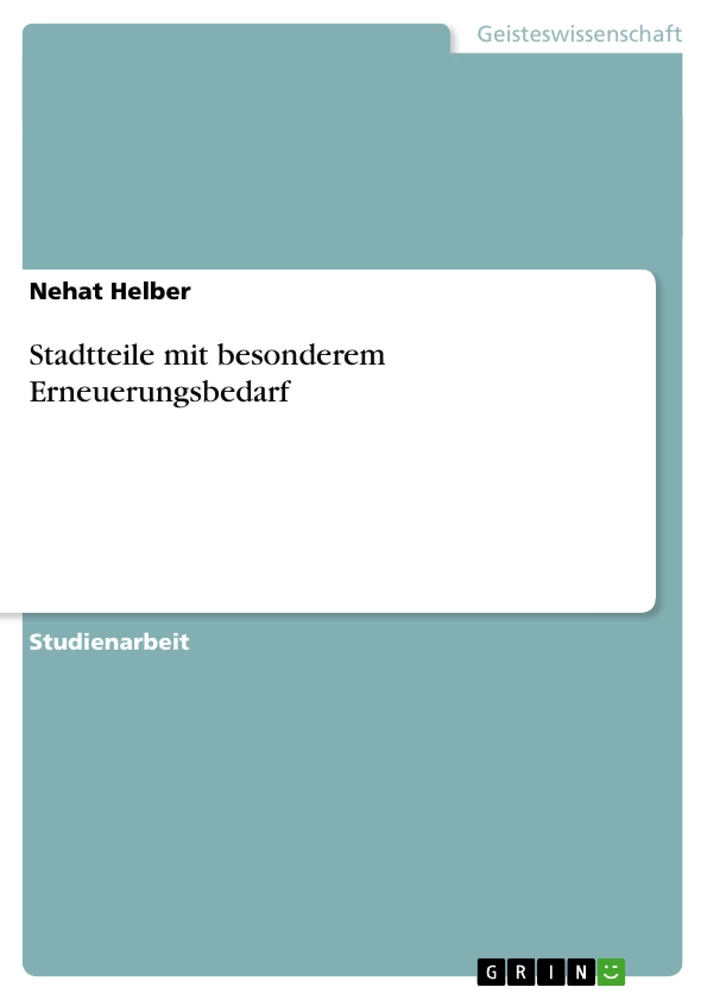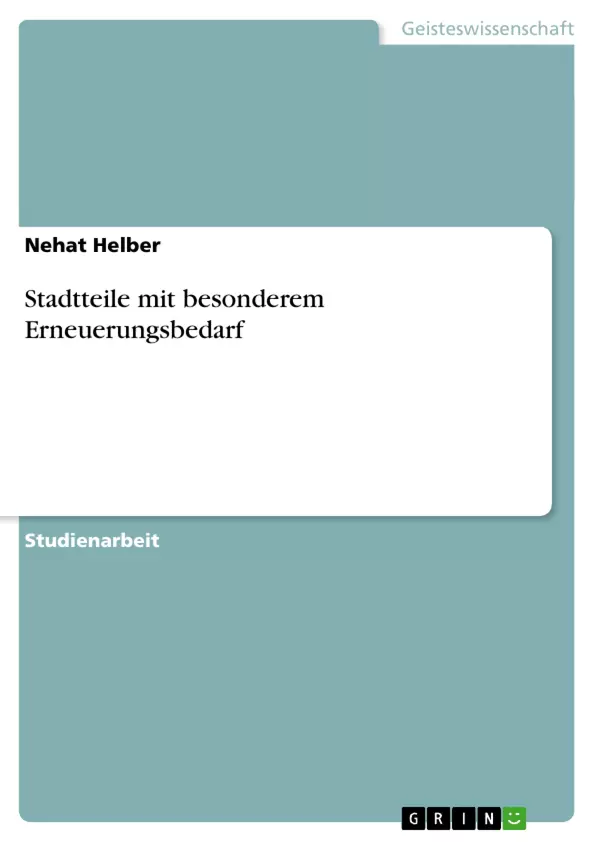Inhalt
1. Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf
1.1 Das Landesprogramm: Ursachen und Ziele
1.2 Städtetypen
1.3 Handlungsfelder
2. Essen- Altendorf
12.1 Sozialraumentwicklung und Handlungsbedarf
12.2 Kommunikations- und Organisationsstrukturen
12.3 Jugendarbeit im Stadtteil
2.3.1 Allgemein
2.3.2 Handlungsfelder
2.3.3 Projekte
3. Fazit
4. Anhänge
4.1 Schaubild 1 ( zu 2.2 )
4.2 Literatur
1. Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf
1.1 Das Landesprogramm: Ursachen und Ziele
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert seit 1993 mit einem ressortübergreifenden und integrierten Handlungsprogramm stadtteilbezogene innovative Prozesse in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf. Das Land reagiert mit diesem Programm auf die strukturellen Umbrüche, die sich infolge des gesamtwirtschaftlichen Strukturwandels in Nordrhein-Westfalen und vor allem in den industriellen Ballungsräumen widerspiegeln. Durch die Krise der Großindustrien, die Schließung von Zechen und Stahlwerken und vor allem durch den Rückzug von produzierendem Gewerbe, kam es in vielen Städten zu einem enormen Verlust von Arbeitsplätzen. Insbesondere die altindustriellen Arbeiterstadtteile waren von diesen Entwicklungen stark betroffen. Gleichzeitig bedeutete die Schließung der Großbetriebe auch den Verlust sozialer Bindungen, denn neben der täglichen Arbeit war auch das gesellschaftliche Leben größtenteils durch die Großbetriebe bestimmt und spielte sich in den Stadtteilen, in den Quartieren, in den Werkssiedlungen und in Vereinen ab. Als Folge dieser Entwicklungen war und ist auch heute häufig eine rückläufige bzw. fehlende Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Stadtteil erkennbar. Hohe Arbeitslosigkeit, eine daraus resultierende "Neue Armut", eine stigmatisierende Außenwahrnehmung und die durch weiche Standortfaktoren bedingten Segregationstendenzen führen bei vielen Betroffenen zu Resignation und zu Desinteresse, das öffentliche Leben in den Stadtteilen aktiv mit zu gestalten. Mit Hilfe des Programms soll nun den Städten die Möglichkeit gegeben werden, durch Kombination vorhandener Investitions- und Förderhilfen, auf lokaler Ebene Projekte zu initiieren, die - orientiert an den jeweiligen Problemlagen im Stadtteil - möglichst viele Handlungsfelder gleichzeitig abdecken und vernetzen und somit Synergieeffekte nutzen. Voraussetzung für die ressortübergreifende Förderung ist die Entwicklung stadtteilbezogener integrierter, d.h. mehrzieliger Handlungskonzepte durch die Kommunen. Gegenwärtig sind 33 Stadtteile in 25 Städten in das Programm des Landes aufgenommen. Die Federführung des Programms liegt beim Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Abstimmung mit den fachlich beteiligten Ressorts auf Landesebene erfolgt über eine eigens eingerichtete "Interministerielle Arbeitsgruppe". Die Städte haben integrierte Handlungskonzepte - orientiert an den jeweiligen Problemlagen im Stadtteil- aufzustellen, um als förderungswürdig in das Landesprogramm aufgenommen zu werden. Diese Konzepte sollten möglichst alle Handlungsfelder der Stadtentwicklungspolitik umfassen. Ziel des Programms soll es sein, die langfristige, nachhaltige Stabilisierung dieser Stadtteile zu gewährleisten. Dabei geht es vor allem um die Aktivierung und Einbindung des endogenen Potentials d. h. aller im Stadtteil und seiner Umgebung lebenden und arbeitenden Akteure ( Kommune und deren verschiedene Fachämter und Dezernate, Wirtschaft, intermediäre Organisationen, Wohlfahrtsverbände und vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner ). Dieser Prozess kann durch vor Ort agierende intermediäre Organisationen koordiniert werden. Langfristig soll durch die soziale Integration und Partizipation der Bewohnerinnen und Bewohner vermieden werden, dass es zur sozialen Ausgrenzung ganzer Stadtteile innerhalb einer Stadt kommt. Es sollen mit und durch die Bewohner (neue) soziale Netze, Selbsthilfepotentiale und Organisationsstrukturen entstehen, die die Prozesse im Stadtteil tragen. Zusammenfassend könnte man sagen, dass ,,Integration und Zusammenleben im Stadtteil wesentliche Voraussetzungen sind, um zukünftig Entwicklungen sozialräumlicher Segregation zu vermeiden." (Vgl. ILS, 2000, Forum für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf)
1.2 Städtetypen
Zwei Gebietstypen, in denen Investitionen in die Instandhaltung der Gebäude und Ausbau von öffentlicher und privater Infrastruktur aus unterschiedlichen Gründen über einen längeren Zeitraum sehr stark zurückgegangen bzw. vollständig ausgeblieben sind, sind typisierend innerhalb des Programms:
- Altindustrielle Innenstadt- bzw. Innenstadtrandlagen, die baulich-städtebauliche Defizite aufweisen und besonderen Umweltbelastungen (Lärm, Schadstoffe) ausgesetzt und dichtbesiedelt sind, wie beispielsweise Stadtteile oder Siedlungen, die durch Zechen- (z. B. Gelsenkirchen - Bismarck) oder Stahlstandorte (z. B. Essen - Altendorf) geprägt sind, bzw. waren .
- Wohnsiedlungen ( Trabantenstädte ) der 60er und 70er Jahre, die meist am Stadtrand liegen und nur über eine begrenzte öffentliche Infrastruktur verfügen. Dies sind in der Regel Großsiedlungen wie z. B. Dortmund - Scharnhorst - Ost.
1.3 Handlungsfelder Die Komplexität dieser Aufgabe erfordert ein integriertes Vorgehen auf der Ebene der Kommunen und des Landes sowohl bei der Konzeptentwicklung als auch bei der Umsetzung im Hinblick auf die heterogenen Handlungsfelder. Die Handlungsfelder betreffen innerhalb der Gesamtbevölkerung verschieden spezielle Zielgruppen (auch wenn dies z.T. von den Stadtteilkoordinatoren, zumindest offiziell, bestritten wurde), die es in die Stadtteilerneuerung einzubeziehen gilt:
- Alte Menschen
- Kinder und Jugendliche
- Migranten und Migrantinnen
- Arbeitslose
- Alleinerziehende
Die Handlungsfelder der integrierten Stadtteilentwicklung:
-Zusammenleben im Stadtteil( soziale Netze + Identität );Migration / Integration; Schule / Bildung; Kultur
-Wohnen( Wohnungswirtschaft );Wohnumfeld und Infrastruktur( Städtebau )
-Lokale Ökonomie( Einzelhandel, Gewerbe, Wohnungswirtschaft, etc.)
-Arbeitsmarkt - und Strukturpolitik( Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen )
-Gesundheit
-Ökologie
Dabei sollen die schon vorhandenen Projekte und Strukturen berücksichtigt und die Handlungsfelder je nach Priorität und Entwicklungsstand eingebunden werden. Die Handlungsfelder sind somit, wie wir bei Betrachtung der verschiedenen Referatbeiträge im Seminar ,,Armutsquartiere" erkennen konnten, in den verschiedenen Handlungskonzepten der Stadtteilprojekte unterschiedlich gewichtet oder berücksichtigt.
2. Essen- Altendorf
2.1 Sozialraumentwicklung und Handlungsbedarf
Altendorf liegt westlich der Essener Innenstadt und zählt zu den dichtbesiedelten und dichtbebauten Stadtteilen Essens.
Infrastruktur: Anschluss findet Altendorf zur Innenstadt über das gewerblich geprägte, wenig strukturierte Krupp - Gelände im Osten. Das Gebiet des Stadtteils wird durch Eisenbahntrassen begrenzt und von einer stillgelegten Güterbahnstrecke im Norden durchquert. Diese Bahntrassen und zwei Hauptverkehrsstraßen zerschneiden das Siedlungsgebiet. Ein hohes Verkehrsaufkommen von und zur Essener City belasten Altendorf mit verkehrsbedingten Immissionen ( Lärm, Schmutz ). Große Teile des Wohngebietes wurden aber schon in der 70er Jahren verkehrsberuhigt. Im Bereich des Personennahverkehrs ist Altendorf relativ gut erschlossen.
Öffentliche Räume: Eine mangelhafte Gestaltung, fehlende Durchgrünung und z.T. konfliktbeladene Nutzung der öffentlichen Räume sind auffällig ( z.B. Vandalismus und Schmutz ) und mitunter der niedrigen Identifikation mit dem Stadtteil zuzuschreiben. Konflikte im Wohnbereich zwischen Deutschen und Nichtdeutschen werden kleinräumlich von den Bewohnern als belastend empfunden. Zu den sozialraumbezogenen Daten ist zu sagen, dass wir punktuell die Entwicklung der Gesamtstadt in Klammern vergleichend anführen.
Wohnen: Der Wohnraumbestand liegt bei insgesamt 12.132 Wohnungen. Knapp Dreiviertel des Bestandes entstand zwischen 1949 - 1968. Auffällig ist auch, dass etwas mehr als die Hälfte aller Wohnungen mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden (Stadt: 37%). Entsprechend dem verstärkt betriebenen sozialen Wohnungsbau in den 50 - 60er Jahren. Hier ist ein bereits stattgefundenes oder ein baldiges Auslaufen der Sozialbindungen zu vermuten, was eine zusätzliche Belastung der einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen ( gerade Familien und Alleinerziehende ) nach sich zieht. Die Investitionsneigungen ( im Bereich des Neubaus ) sind niedrig und durch wenige Freiraumflächen auch begrenzt und wenig sinnvoll. Vorherrschend im Stadtteilgebiet sind kleinere Wohnungen von durchschnittlich 59qm (Stadt 71qm).
Wirtschaft: In diesem Bereich ist Altendorf eng mit der Entwicklungsgeschichte der Fa. Krupp verbunden. Fabriken der Fa. Krupp befanden sich im Nord- und Westviertel. Auch Wohnsiedlungen der ,,Kruppianer" hatten hier ihren Standort, sind aber teilweise abgerissen worden. Durch kriegsbedingte Zerstörungen und Demontagen der Krupp -Anlagen ist auch Altendorf stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Krupp - Anlagen sind bis heute nicht vollständig wiederbesiedelt worden und befinden sich immer noch in einer Umstrukturierungsphase ( geplant ist ein Gründerviertel in dem Jungunternehmen und Neugründungen angesiedelt und durch sogenanntes ,,Coaching" beraten werden sollen ). Insgesamt fehlen der Stadt aber präzise Daten zum Zustand der Wirtschaft in Altendorf. Es wurden knapp 500 Betriebe im Einzelhandel, in der Dienstleistung und im Gewerbe ermittelt. Die Zahl der Beschäftigten ist im Zeitraum von 1970- 1987 um 21% (Stadt:16%) gesunken und dies nahezu ausschließlich im verarbeitenden Gewerbe und im Handel. Der Anteil der arbeitslosen Personen im erwerbsfähigen Alter beträgt 12% (Stadt: 9%).
Bevölkerungsstruktur: Die Einwohnerzahl betrugt 22.684 im Jahr 1996, davon waren 17,3% nicht - deutscher Herkunft. Doppelt so viele im Vergleich zum übrigen Stadtgebiet (9%). Die Anzahl der nicht - deutschen Haushaltsvorstände nahm um 64% (Stadt: 39%) zu (1987-96). Die Zahl der deutschen Haushaltsvorstände im gleichen Zeitraum nahm um 9% ab (Stadt: -7%). Der Anteil der nicht - deutschen Kinder im Stadtteil lag bei 35%. In Kindertageseinrichtungen aber durchschnittlich nur bei 25%, in einzelnen Einrichtungen jedoch bis zu 93% im kleinräumlichen Vergleich. Die Zahlen lassen vermuten, dass erhöhte Integrationsprobleme und Konflikte durch, in relativ kurzem Zeitraum entstandene, kleinräumliche Ballung verschiedener Kulturen entstehen. 12 % der Einwohner Altendorfs waren Betroffene von Leistungen der Sozialhilfe, fast doppelt so viele im Vergleich zur Gesamtstadt (7%). Insgesamt heißt das: 2700 Betroffene, davon 1100 Kinder u Jugendliche unter 18 Jahren. 27% der Kinder und Jugendlichen wachsen hier unter Bedingungen der Einkommensarmut auf (Stadt:16%). Von allen Einwohnern waren 17,5% Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, 23,4% 60 Jahre und älter und 2,6% AussiedlerInnen. Es fand ein starkes Absinken der Bevölkerung um 23% (Stadt: -13%) zwischen 1970-87 statt. Dies wurde von dem Zuzug von eher einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen seit 1990 wieder aufgefangen. Ein Anstieg von Alleinerziehenden auf insgesamt 27% aller Haushalte mit Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (1987-96) ist zu verzeichnen und ein weiterer Anstieg ist zu befürchten. Der gleicher Trend gilt in zunehmenden Maße auch für nichtdeutsche eheliche Bindungen. Der Anstieg der Anzahl der Haushalte Alleinerziehender ist besonders brisant, da diese in besonderem Maße von Armut bedroht sind. Kennzeichnend ist hier auch eine Verjüngung statt Überalterung im Stadtteil. Die Zahl der Haushalte mit Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nahm entgegen dem gesamtstädtischen Trend zu (+4% / Stadt -2%).
Sozial- und Infrastruktur sowie die Gesundheitsvorsorge: Im Vergleich zu gesamtstädtischen Quoten ist beides als eher schlecht einzustufen. Es fehlen Kindertagesstätten und im Stadtteil und Bezirk existieren keine Angebote nach § 32 KJHG (Erziehung in einer Tagesgruppe). Schuleingangsuntersuchungen belegen eine nur unterdurchschnittliche Nutzung von Vorsorgemöglichkeiten von Seiten der Eltern. Problematisch ist vor diesem Hintergrund, dass die jungen Menschen in ihren Bildungschancen von Benachteiligung geprägt sind. Es ist kein Gymnasium in Altendorf vorhanden. 49% der Jugendlichen wechseln beim Übergang zur Sekundarstufe I zwar an die Gesamtschule, die Möglichkeit zur Fachhochschul- und Hochschulreife nutzen aber nur wenige. Positiv zu vermerken sind die bei eingeschränkten Haushaltsmitteln aufgestockten Aufwendungen der öffentlichen Hand in bezug auf die Einrichtungen der öffentlichen Jugendarbeit. 1991 wurden pro Jugendlichen 55,- DM , 1995 67,- DM pro Jugendlichen aufgebracht. ( Vgl. Zentraler Steuerungsdienst, 1997 ) Anhand der Zahlen zu Entwicklungen des Sozialraums ist deutlich zu erkennen, dass gerade die Jugend im Stadtteil direkt oder indirekt von Benachteiligung betroffen ist, da sie eine heterogene Zielgruppe bildet, die zusätzlich ihre sozio- kulturellen Lebensverhältnisse, Lebensräume und Zukunftschancen nur bedingt beeinflussen ( kann oder darf ). Deshalb machen gerade hier integrierte und mehrzielige Ansätze und eine Einbeziehung und Aktivierung besonderen Sinn, wenn von Nachhaltigkeit gesprochen werden soll.
2.2 Kommunikations- und Organisationsstrukturen
Die Stadtteilarbeit in Altendorf richtet sich nach den Arbeitsprinzipien, die vom Rat der Stadt Essen 1997 unter dem Titel ,,Ansätze integrativer Kommunalpolitik" verabschiedet wurden und orientiert sich stark, in der praktischen Umsetzung, am benachbarten Stadtteil Katernberg. Die Aktivitäten in den Handlungsfeldern konnten Aufgrund der statistischen Grundlagen, die von der Stadt Essen 1997 (s.o.) vorlegt wurden, konkretisiert werden und wurden ab 1998 umgesetzt. Die statistischen Zahlen wurden bekräftigt durch zwei aktive, mobilisierende Bürgerbefragungen von 1100 Haushalten und später noch einmal von 250 Haushalten im Rahmen eines Projektes. Die Organisation der Stadtteilarbeit lehnt sich an hierarchische Verwaltungsschemata an, zeigt aber eine stärkere Vernetzung der Beteiligten und eine Dezentralisierung der Verwaltungsstrukturen ( siehe Schaubild 1 ). Auf kommunaler Ebene wurde eine ,,Lenkungsgruppe Altendorf" gebildet, in der Vertreter der Bezirksvertretung, des Stadtteilprojekts (vertreten durch das ISSAB), der Personalrat und die Essener Wirtschaftförderungsgesellschaft sitzen. Die ,,Lenkungsgruppe" ist kein Entscheidungsgremium, sondern übt lediglich Steuerungsfunktionen bezogen auf das Verwaltungshandeln aus. Auf Stadtteilebene leisten die Kooperationspartner ISSAB, als intermediäre Organisation, das Diakoniewerk und die Stadt Essen Gemeinwesenarbeit im Stadtteilprojekt, die von mobilisierenden Befragungen über die Planung bis zur konkreten Durchführung von Projekten reicht und jeweils von einem öffentlichen oder freien Träger ( hier meist: Diakoniewerk ) praktisch umgesetzt werden. Im Stadtteilprojekt interagieren die Aktionskreise und Projektgruppen der Bewohner mit den Fachämtern, ebenso die Bezirksjugendkonferenz und die Stadtteilkonferenz im Rahmen von ,, runden Tischen", ,,Arbeitskreisen" und ,,Projektgruppen". Die Kooperationspartner haben ihren Sitz im Stadtteilbüro in Altendorf. Dieses ist auch der Versammlungs- und Veranstaltungsort und das Organisations- und Informationszentrum für Bewohneraktivitäten. Dort wird informiert, beraten, Kritik entgegengenommen und unter Umständen Opposition gegen die Stadt organisiert. (Vgl. Handlungskonzept für Essen- Altendorf, 1999) Dieses Netzwerk der Kooperationen, das für sich betrachtet recht nüchtern die Verwaltung- und Machtstrukturen beschreibt, hat im Stadtteil schon allein durch die personelle Verflechtung ( nicht immer negativ ) durchaus nachhaltige Effekte erzielt. Wir konnten darüber mit der Stadteilkoordinatorin Fr. Wittekopf (ISSAB) sprechen und wollen kurz zwei positive Entwicklungen beschreiben, die sich dort aus der praktischen Arbeit ergeben haben: · Ein Ableger des Stadtteilbüros soll im Norden Altendorfs eingerichtet werden, um dort den durch die Hautverkehrsstraße ,,abgeschnittenen" Bürgern die Möglichkeit zu geben, aktiver an den Projekten des Stadtteilbüros teilzunehmen oder diese zu initiieren. Die betroffenen Bürger haben diese Möglichkeit vorgeschlagen, da ihnen die Partizipation an Projekten und der Zugang zu Informationen durch die räumliche Trennung erschwert schien ( gerade bei älteren Bürgern zu berücksichtigen ). Zudem werden wiederum die Informationswege zusätzlich verkürzt und dem Umfeld angepasst. Dort wird momentan für ein Projekt der Wohnumfeldverbesserung und interkulturellen Arbeit am Jahnplatz mobilisiert und geplant. · Die Verhinderung der einseitigen Nutzung einer neuen - aus Landesmitteln - geförderten Trendsporthalle durch den Sportbund wurde nur durch neue, vor Beginn des Stadtteilprojektes noch nicht bestehende Kommunikationsstrukturen ermöglicht. Fr. Wittekopf lobte besonders die aufmerksame und kritische Arbeit der BV und deren Einsatz und Intervention bei den entsprechenden Ämtern und Gremien. Die Vernetzung und personelle Verflechtung hatte hier den Effekt eines Frühwarnsystems. So war es möglich eine Teilnutzung durch Projektgruppen und planerische Einbeziehung der Bewohner - und gerade auch der Jugendlichen - zu ermöglichen, die unter ,,regulären" Umständen vom Bauherren (Sportbund) durchaus umgangen worden wäre. Hier möchten wir kurz auf einen Faktor hinweisen, den man leicht übersehen kann, wenn man sich abstrakt und planerisch mit praktischer, sozialer Arbeit auseinandersetzt. Das ,,subjektive" ,,sozialisationsbestimmte Einzelhandeln" kann bei ,,objektiv" strukturierten Rechtsquellen und Verwaltungsvorschriften erhebliche Unterschiede bei gleicher Ausgangsposition hervorrufen.( Vgl. Kreft, Münder, 1994 ) Hier steht und fällt ein erfolgreiches Projekt mit der zielorientierten und kritischen Betrachtung des Einzelnen ( Sozialarbeiter, Mitglied der BV, etc. ) gegenüber den weiteren lokalen Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung und Bevölkerung. Der positive, persönliche Einsatz in Hinsicht auf die Zielgruppe und das Projekt ist somit nicht zu unterschätzen.
2.3 Jugendarbeit im Stadtteil
2.3.1 Allgemein
Die statistischen Daten zur Bevölkerungszusammensetzung und der hohe Anteil Jugendlicher und Kinder, die direkt von Armut bedroht und betroffen sind, machen den Handlungsbedarf im Jugendbereich Altendorfs besonders deutlich. Des weiteren macht auch hier nur ein Ansatz Sinn, der Jugendliche in die Planung und Durchführung mit einbezieht. In der Literatur findet man die ,,Individualisierung der Jugend" mit der Vorstellung verknüpft, dass Lebensrealitäten von Kinder und Jugendlichen - ohne ihre Einbeziehung - nicht zu definieren sind ( Vgl. z.B. Olk, 1988). Individualisierung muss nicht eine Vereinzelung oder Vereinsamung der Individuen charakterisieren, sondern die Erosion sozialer Milieus ( Kirchen, Parteien, Verwandtschaften, etc.) einerseits und eine wachsende Institutionalisierung andererseits (Vgl. Stork 1995). Durch Partizipation der Kinder und Jugendlichen und eine nachfrageorientierte Ausrichtung der Jugendarbeit rückt auch ein politischer Effekt in den Vordergrund, der die Demokratisierung der Gesellschafts- und Steuerungsform betrifft. ,,Kommunikation- und Aushandlungsprozesse sind nicht allein mit der Klientel, sondern auch mit den Instanzen der lokalen Politik zu etablieren, (...) die die Fragen nach dem Umfang und der Qualität der Leistungen, die zukünftig bereitgestellt werden sollen, repolitisieren" (Vgl. Flösser, 1996). Durch das Miteinbeziehen der Betroffenen in das Problemfeld, die Planung und die Durchführung von Projekten ist zudem der Prozess der Aktivierung von Selbsthilfepotentialen in Gang gebracht, eine Stück ,,Basisdemokratie" würde umgesetzt und eine weiterer inhaltlicher Bezug zum Subsidiaritätsprinzip in der Jugendarbeit ist in diesem Punkt auch zu erkennen. Denn wenn man die Hilfen zur Erziehung - und den Stellenwert der Familie und der Eltern als eigentliche Hilfeempfänger im KJHG - berücksichtigt und als subsidiäre Faktoren bezeichnet, so ist die direkte Einbeziehung der Jugendlichen noch wesentlich zielorientierter ( und auch subsidiärer ).
2.3.2 Handlungsfelder
Allgemein: Das Querschnittsressort der Kinder- und Jugendarbeit erfordert schon in der Ausführung der Jugendhilfeplanung eine ganzheitliche Sichtweise der Lebens- und Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien, die sich allgemein aus dem § 1 KJHG, ,,Verbesserung der Lebensbedingungen junger Menschen durch Verbesserung der sozialen Infrastruktur", ergeben, die auch Fragen der Schul-, Ausbildungs-, Arbeitsmarkt-, Umwelt-, Wohnungs- und Entwicklungspolitik betreffen und deshalb ressortübergreifend sein müssen. Durch die Zweiteilung des Jugendamtes ( JA ) in Jugendhilfeausschuss (JHA) und Verwaltung, das sich hiermit von anderen kommunalen Verwaltungsbehörden mit reinen Verwaltungsstrukturen unterscheidet, erhält das JA einen gestaltenden und verwaltenden Auftrag ( § 70 Abs.1 KJHG ). Die Gestaltung bzw. die Möglichkeit dazu liegt im Wesentlichen beim JHA im Rahmen der Jugendhilfe ( §§ 11- 41 KJHG ): · Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 11- 15); Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16- 21); Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§§ 22- 26); Hilfe zur Erziehung (§§ 27- 41) und den anderen Aufgaben der Jugendhilfe ( §§ 42- 62 KJHG ). (Vgl. Gries, 1994) In Bezug auf das Stadtteilprojekt bekommt die ganzheitliche Sichtweise und der Bezug zur sozialräumlichen Orientierung der Jugendhilfe eine mögliche, neue Qualität. Die Umsetzung der weiteren Dezentralisierung von Jugendarbeit und die Möglichkeit der Vernetzung von Ressorts, die Nutzung vorhandener Ressourcen im Stadtteil, die mehrzielige Ausrichtung der Projektplanung und die Koordination der Stadtteilaktivitäten im Stadtteilprojekt mit Einbindung aller wichtigen Akteure lässt vermuten, dass sich der Anspruch, der sich aus § 1 KJHG ergibt, zielorientierter Umsetzen lässt ( Vgl. SGB VIII, KJHG, §§ 1 - 41 )
2.3.3 Projekte
Auf der Suche nach geeigneten Beispielen für die verschiedenen Bereiche der Jugendarbeit haben wir 2 Projekte, die bereits vorhandene Angebote und Ressourcen bündeln und vernetzen, hervorgehoben, um innovative Vorgehensweisen zu dokumentieren und kritisch zu betrachten: Die Schülerfirmen: An der Gesamtschule Bockmühle, die von 49% der Jugendlichen in Altendorf beim Übergang zur Sekundarstufe I gewählt wird, haben sich seit einigen Jahren vier verschiedene Schülerfirmen etabliert, die uns als innovative Projekt aufgefallen sind, um einen mehrzieligen Anspruch umzusetzen und vorhandene Ressourcen zu nutzen. Die erste Schülerfirma begann 1997 im Rahmen eines Wahlkurses des regulären Unterrichts praxisorientierte Arbeit mit Unterrichtsinhalten zu verknüpfen. Die Schüler gründeten den "Schul - Laden", der sein Startkapital aus Anteilsscheinen bezog und in der Schule die kurzfristige Bedarfsdeckung der Schüler im Bereich der Schreib- und Büroartikel in den Schulpausen deckt. Die gesamte Geschäftsführung mit kaufmännischen, logistischen und planerischen Aufgaben liegt, unter Begleitung von Lehrern und eines Sozialpädagogen, bei den Schülern. In ähnlicher Form organisierten sich die anderen Schulfirmen, die sich der Bereiche Gastronomie, Garten- und Landschaftsbau / Floristik und Haustechnik annahmen. Schüler können Unterrichtsinhalte durch die praktische Umsetzung besser verstehen, lernen verschieden Berufsbilder in der Praxis kennen ( nicht nur durch punktuelle Eindrücke in Praktika und Besichtigungen ) und erlangen Schlüsselqualifikationen (Teamarbeit, Verantwortung, etc.). Hier wird jedoch nicht nur der Bereich ,,Übergang Schule / Beruf" angesprochen. Die Gartenbaufirma wirkt aktiv bei der Umgestaltung des Schulhofes mit und trägt zur Wohnumfeldverbesserung bei (die Öffnung und außerschulische Nutzung des Schulhofes und des Schulgebäudes ist ein weiteres Handlungsfeld im Stadtteilprojekt. Auch das Jugendhaus ist im Schulgebäude angesiedelt.). Eine stärke Identifikation der Schüler mit dem von ihnen gestalteten Umfeld ist die Folge ( auch im Sinne der ,,Broken Windows" - Theorie ). Der, der den eher polemische Einwand macht, dass Schüler hier zu ,,Reinigungsarbeiten" herangezogen werden und eine finanzielle Entlastung der Kommune auf dem Rücken der betreffenden Schüler stattfindet, vergisst, dass integrative Ansätze solche Schlussfolgerungen im Grund implizieren. Damit wäre das gesamte Ansatz der Bürgermobilisierung und der Aktivierung von Selbsthilfepotentialen ad absurdum geführt und man könnte dann auch gleich zur ,,gewohnten" Tagesordnung ( im reaktionären Sinn ) übergehen und warten, dass ,,von oben" die Misere gelöst wird, in der sich die betreffende Kommune befindet. Wir fanden aber keine Ausgebeuteten, sondern es tat sich in diesem Jahr eine Geldquelle neben der bisherigen Landesförderung auf. Die Krupp- Stiftung beteiligt sich mit 239.000 DM an den Projekten der Schülerfirmen und sichert so zusätzlich die Planung neuer Vorhaben, die im nächsten Absatz erläutert werden. Des weiteren ist die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure ebenfalls positiv auffällig. Sowohl das Stadtteilprojekt mit dem Aktionskreis Wohnumfeldverbesserung, das Grünflächenamt, das Jugendamt, das Schulverwaltungsamt und ein Sponsor aus der Wirtschaft planen und arbeiten unter Einbeziehung der Schüler aus den Firmen an dem Projekt (Vgl. http://members.aol.com/gsbsan/welcome.html, 1999). Wie oben erwähnt wird ab dem nächsten Schuljahr den Schülern eine ganz neue Perspektive, bezogen auf den Einblick in ein Berufsfeld durch die zusätzliche Förderung des Projektes durch die Krupp - Stiftung ermöglicht. Der geplante Bau eines Gartenhauses für die Aktivitäten der ,,Garten" - Schülerfirma wird nicht von einem Bauunternehmen, sondern im Rahmen der überbetrieblichen Schulung durch freie Trägern übernommen. Hier werden Auszubildende im Bauhandwerk mit den Schülern unter Anleitung eines Meisters ein Gartenhaus errichten. Vor dem Hintergrund, das bundesweit rund ein Viertel aller Auszubildenden ihre Lehre abbrechen, und sicher nicht ein unerheblicher Teil aufgrund einer mangelnden Berufwahlorientierung, ist dies unserer Meinung nach ein nicht nur integrativer sondern auch innovativer Ansatz. Probleme hinsichtlich der Akzeptanz durch die Schüler, des Durchhaltevermögens bei längerfristigen Projekten und der Chancen bei der Ausbildungsplatz- und Arbeitsplatzsuche können von uns nicht eindeutig beurteilt werden, aber bei Betrachtung der momentanen Aussichten der Abgangsstufen, kann eine Aufwertung des Selbstvertrauens der Jugendlichen aus pädagogischer Sicht nur begrüßt werden. Des weiteren wirkt sich ein ,,sicht- und greifbares" Ergebnis der eigenen Arbeit meist nicht nur positiv auf das Schul- und Wohnumfeld aus, sondern steigert u.U. die Motivation gerade bei schulmüden und lernschwachen Schülern, für die die Lage auf dem Arbeitsmarkt durch einen Wegbrechen der niedrigqualifizierten Arbeitsplätze besonders schwierig ist.
,,Basketball um Mitternacht": En weiteres, durchaus innovatives Projekt fanden wir im Bereich der offenen Jugendarbeit. Viele kommerzielle Angebote am Wochenende können die Jugendlichen in Altendorf aufgrund mangelnder finanzieller Mittel nicht nutzen. Da kostenlose Angebote nicht ausreichend zur Verfügung stehen, bilden Plätze unter freiem Himmel meist die einzige Alternative sich an Wochenenden bis in die Nacht treffen zu können. Hier ergeben sich wiederum aus der dichten Besiedlung und Bebauung des Stadtteils Probleme in Hinsicht auf das Zusammenleben. Die Ballung der meist cliquenorientierten Treffpunkte der Jugendlichen auf den wenigen größeren Plätzen, auf denen ausreichend Platz vorhanden ist um sportlichen Aktivitäten nachzugehen und sich in größeren Gruppen zu treffen, verursachte starke Konflikte zwischen den verschiedenen kulturellen Gruppen und mit den älteren Anwohnern, da diese Plätze sich direkt in Wohngebieten befinden. Auffällig war hier auch eine erhöhte Sachbeschädigung. Anhand von Befragungen der beteiligten Anwohner und der Jugendlichen war es möglich ein Projekt zu initiieren, das die Situation deutlich entschärfte ( auch noch 3 Jahre nach Beginn des Projekts ). 1998 begann man hier ( über die Sportjugend Essen als Träger unter Beteiligung des Jugendamtes, des Schulamtes und der Kriminalpolizei ) ein nichtkommerzielles Freizeitangebot an Wochenenden auf die Beine zu stellen, das einen Treffpunkt und sportliche Aktivitäten miteinander verbindet. Die u.U. durchaus bedenkliche Miteinbeziehung der Kriminalpolizei in das Projekt, wurde von Seiten der Stadtteilkoordinatorin dahingehend relativiert, dass hier lediglich mögliche Fördergelder ausgeschöpft werden, indem man hier auch die Polizei ,,mit ins Boot nimmt". ,,Basketball um Mitternacht" hatte für uns folgende, anhand von Daten nachvollziehbare Erfolge: 60 - 70 Jugendliche nutzen regelmäßig dieses einmal wöchentliche Angebot. Die Turnhallen konnten erstmals in Essen über 22 Uhr hinaus genutzt werden( denn das Projekt läuft Freitags von 22 bis 2 Uhr ). Die konfliktbeladene Nutzung der bisherigen Plätze hat deutlich nachgelassen. Eine zusätzliche aufsuchende, cliquenorientierte Jugendarbeit wird durch ein regelmäßiges Angebot im Bereich der offenen Jugendarbeit begünstigt. Es ist ein Aggressionsabbau durch sportliche Aktivität nachzuweisen. Der Integration verschiedener sozialer Schichten und Cliquen wird ein weiterer ,,kontrollierter" Raum gegeben und eine halbe Trainerstelle konnte geschaffen werden. Auch hier werden wieder vorhandene Ressourcen genutzt, indem die Multisporthalle der Gesamtschule zu bisher nicht nutzbaren Zeiten belegt wurde, ohne an anderer Stelle Einschränkungen machen zu müssen.
3. Fazit
Bei kritischer Würdigung konnten wir aufgrund unserer Recherche natürlich nach drei Jahren ,,Stadtteilprojekt Altendorf" auch einige Bereiche der Jugendarbeit ausmachen, die weiterhin lückenhaft, nicht klientenorientiert und schlecht ausgebaut sind. Hier sind besonders hervorzuheben:
- die bedenkliche Situation der Kindertagesstätten und eine fehlende Abdeckung im Bereich ,,Erziehung in einer Tagesgruppe" für Grundschüler, die starke Defizite in der psycho- sozialen Entwicklung haben und wo ein verstärkter Handlungsbedarf besteht.
- Im Bereich der offenen Jugendarbeit fehlt ein weiteres Jugendhaus, z.Zt. ist lediglich eines in der Gesamtschule vorhanden und dieses wurde uns als überlastet beschrieben.
- Die aufsuchende, cliquenorientierte Jugendarbeit (Streetwork) ist ebenfalls unterentwickelt und kann nur partiell, bezogen auf spezielle, kleinräumliche Projekte, als zufriedenstellend bezeichnet werden. Hier ist zwar ein ,,Jugendcafe" im Stadtteil geplant, das eine solche Arbeit in der Projektbeschreibung vorsieht, die Umsetzung ist aber nicht in Sicht.
- Eine ,,Jobbörse" soll jungen Arbeitslosen mit zeitlich befristeten Arbeitsstellen den Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt vermitteln oder den Kontakt wiederherstellen, dieses ist aber noch nicht umgesetzt worden. Im Bereich einer ,,Stadtteilwerkstatt" wird seit drei Jahren ein bündelndes Projekt geplant, das Beschäftigung- und Qualifizierungsmaßnahmen für Jugendliche im zweiten Arbeitsmarkt vorsieht und in Kooperation mit dem Arbeitsamt eine Berufsberatung und -betreuung integrieren soll.
Man könnte noch weiter fortfahren Defizite ähnlicher Art zu lokalisieren. Ein Problem von Jugendpolitik ( und auch anderer Handlungsfelder von Sozialpolitik ) wird durch die Vorgehensweise bedingt, hauptsächlich aktuelle, zugespitzte und durch Medien hervorgehobene Problemfelder zu bedienen. Eingeschränkte Haushaltsmittel (gerade der hochverschuldeten Kommunen ) führen zu temporär stärker geförderten Bereichen, wobei andere weniger berücksichtigt werden. Die von uns vorgestellten Projekte lassen hoffen, dass hier auch die Öffnung der Institution Schule noch einige Perspektiven zulässt, um gerade Jugendlichen, die den Übergang ins Erwachsenen- und Berufleben vor sich haben, die Chance zu geben, früher Orientierungsmöglichkeiten zu nutzen und somit vielleicht etwas weniger verunsichert den Übergang Schule / Beruf zu bewältigen. Eine stärkere Vernetzung von Jugendamt, Arbeitsamt, Schule, offener Jugendarbeit und Erziehungsberatung könnte hier noch Potentiale eröffnen, die so in Altendorf nicht vorzufinden waren, die aber ( auch durch das KJHG ) durchaus gerechtfertigt wären, wenn entsprechende Mittel frei wären, die u.U. noch an anderer Stelle ,,eingefroren" sind. Eine durch globale Prozesse hervorgerufene Strukturkrise des Arbeitsmarktes und die persönlich erlebte oder befürchtete Arbeitslosigkeit muss nicht zwangsläufig zur Resignation führen, wenn in solchen Projekten wirkliche Selbsthilfepotentiale eröffnet werden, Institutionen noch massiver zusammenarbeiten, Jugendliche aktiv mit einbezogen werden und eine entsprechende Finanzierung gewährleistet wäre.
4. Anhang
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen des Dokuments "Inhalt"?
Das Dokument befasst sich hauptsächlich mit Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, wobei ein Fokus auf Essen-Altendorf liegt. Es behandelt Themen wie Sozialraumentwicklung, Jugendarbeit, Kommunikations- und Organisationsstrukturen im Kontext von Stadtteilerneuerungsprogrammen.
Was sind die Ziele des Landesprogramms zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf?
Das Landesprogramm Nordrhein-Westfalens zielt darauf ab, stadtteilbezogene innovative Prozesse in benachteiligten Stadtteilen zu fördern. Dies soll durch die Kombination von Investitions- und Förderhilfen geschehen, um Projekte zu initiieren, die verschiedene Handlungsfelder gleichzeitig abdecken und Synergieeffekte nutzen. Langfristig soll die Stabilisierung dieser Stadtteile gewährleistet werden.
Welche Städtetypen werden im Programm unterschieden?
Es werden zwei Hauptgebietstypen unterschieden: altindustrielle Innenstadt- bzw. Innenstadtrandlagen mit baulich-städtebaulichen Defiziten und Wohnsiedlungen (Trabantenstädte) der 60er und 70er Jahre am Stadtrand mit begrenzter Infrastruktur.
Welche Handlungsfelder werden in der integrierten Stadtteilentwicklung berücksichtigt?
Die Handlungsfelder umfassen: Zusammenleben im Stadtteil, Migration/Integration, Schule/Bildung, Kultur, Wohnen, Wohnumfeld und Infrastruktur, lokale Ökonomie, Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik, Gesundheit und Ökologie.
Was sind die besonderen Herausforderungen in Essen-Altendorf?
Altendorf ist geprägt durch eine hohe Bevölkerungsdichte, eine zerschneidende Infrastruktur, verkehrsbedingte Immissionen, mangelhafte Gestaltung öffentlicher Räume, einen hohen Anteil an geförderten Wohnungen, eine hohe Arbeitslosigkeit und einen hohen Anteil an nicht-deutscher Bevölkerung. Es gibt Integrationsprobleme und eine Einkommensarmut bei Kindern und Jugendlichen.
Welche Kommunikations- und Organisationsstrukturen sind in Altendorf vorhanden?
Die Stadtteilarbeit in Altendorf orientiert sich an den "Ansätzen integrativer Kommunalpolitik" der Stadt Essen. Es gibt eine "Lenkungsgruppe Altendorf" auf kommunaler Ebene und Kooperationspartner wie das ISSAB, das Diakoniewerk und die Stadt Essen, die Gemeinwesenarbeit leisten. Das Stadtteilbüro dient als Versammlungs-, Veranstaltungs-, Organisations- und Informationszentrum.
Welche Projekte gibt es im Bereich Jugendarbeit in Altendorf?
Es gibt verschiedene Projekte, wie z.B. Schülerfirmen an der Gesamtschule Bockmühle (Schul-Laden, Gastronomie, Garten- und Landschaftsbau/Floristik, Haustechnik) und das Projekt "Basketball um Mitternacht", das ein nichtkommerzielles Freizeitangebot an Wochenenden bietet.
Welche Defizite gibt es in der Jugendarbeit in Altendorf?
Es gibt Lücken im Bereich der Kindertagesstätten und der "Erziehung in einer Tagesgruppe" für Grundschüler, ein fehlendes Jugendhaus, eine unterentwickelte aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork) und Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten wie einer "Jobbörse" und einer "Stadtteilwerkstatt".
Welche Potentiale gibt es für die Zukunft der Jugendarbeit in Altendorf?
Es gibt Potentiale durch die Öffnung der Institution Schule, eine stärkere Vernetzung von Jugendamt, Arbeitsamt, Schule, offener Jugendarbeit und Erziehungsberatung. Die Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, die stärkere Einbeziehung von Jugendlichen und eine entsprechende Finanzierung sind wichtig.
- Quote paper
- Nehat Helber (Author), 2001, Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103431