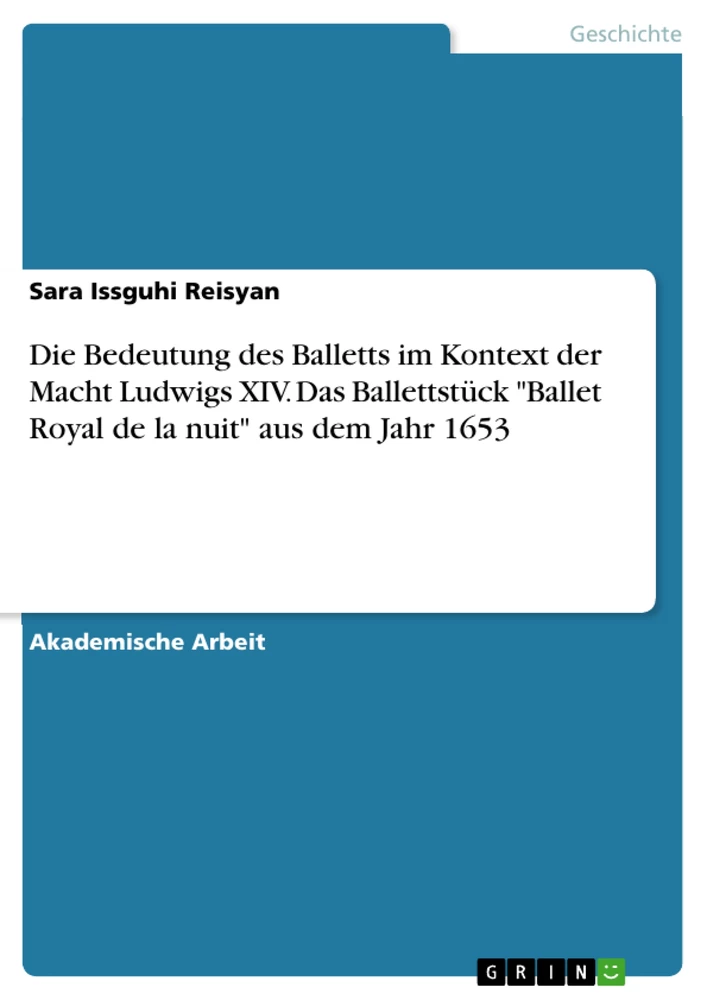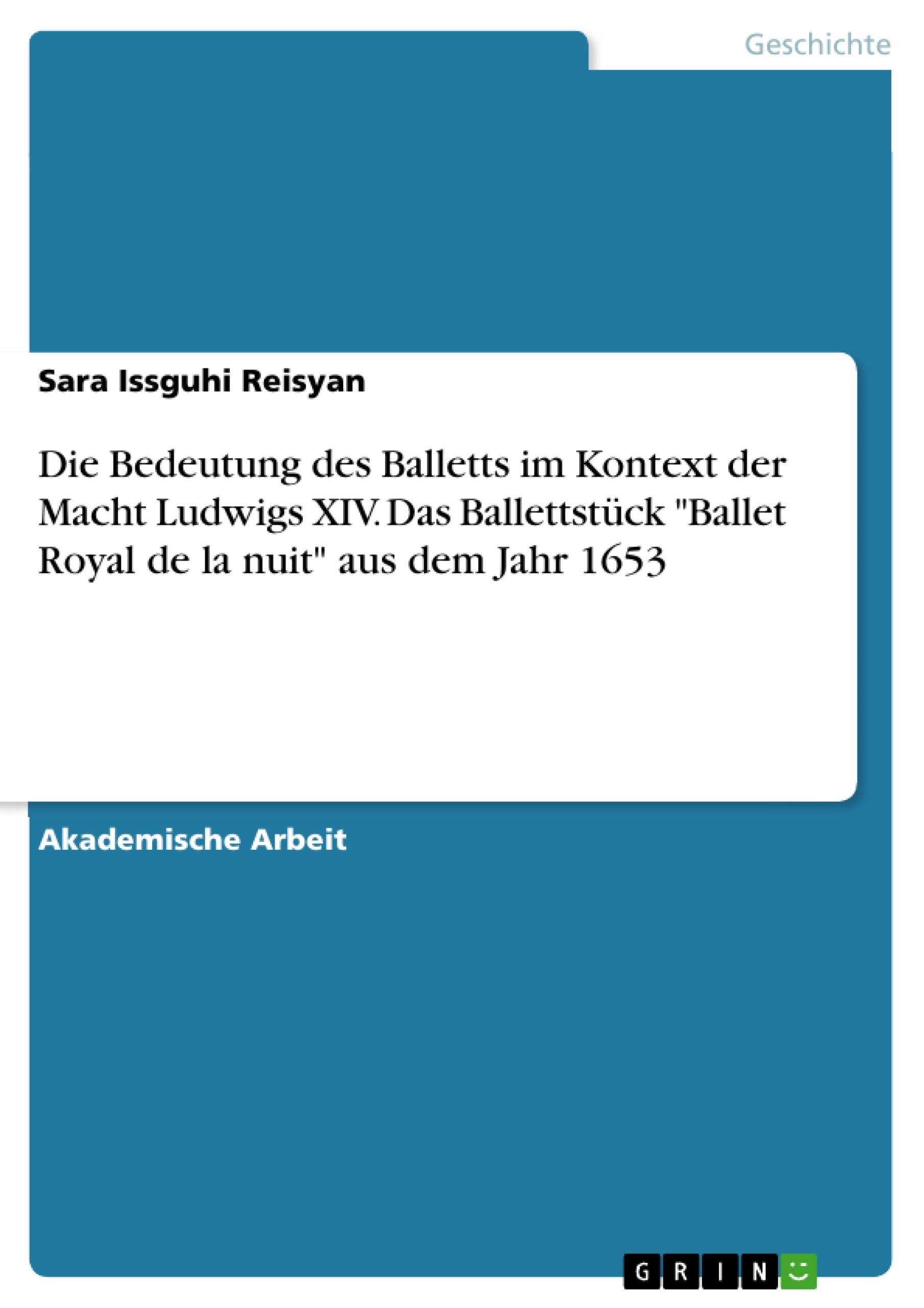In diesem Aufsatz wird untersucht, inwiefern dem Monarchen Ludwig XIV. seine Rolle im Zentrum des Ballettstücks "Ballet Royal de la nuit" aus dem Jahr 1653 bei der Ausübung und Demonstration absolutistischer Macht half. Bereits in früher Kindheit begann Ludwig XIV., Ballett zu tanzen. Im Alter von vier Jahren wurde er zwar zum König gekrönt, doch mangelte es ihm an Regierungsfähigkeit. Daher übernahmen zunächst seine Mutter und anschließend ein Minister und Kardinal seine Vormundschaft. In dieser Zeit musste der junge König mehrfach aus Paris fliehen und es gab große Probleme bei der Machtausübung. Entscheidungen des Königshauses wurden teilweise nicht befolgt und seine Regierungsfähigkeit wurde vehement infrage gestellt.
Die dieser Arbeit zugrunde liegende Hypothese ist, dass sich dies mit seinem Auftritt im "Ballet Royal de la nuit", worin er eine zentrale Rolle innehatte, änderte. Bei der Überprüfung dieser Hypothese werden zum Beispiel die Rolle des Monarchen als Sonnengott Apollon im "Ballet Royal de la nuit" und deren Symbolik untersucht. Besonderes Augenmerk wird auf den Einfluss von Ballett auf die öffentliche Meinung über Ludwig XIV. gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrundinformationen
- Biographische Eckinformationen zu Ludwig XIV.
- Absolutismus
- Ludwig XIV. als absolutistischer Herrscher
- Ballet royal de la nuit
- Institutionalisierung des Balletts und des Tanzes durch Ludwig XIV.
- Analyse
- Die Symbolik der Sonne und des Apollon
- Auswirkung der Institutionalisierung von Ballett und Tanz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz befasst sich mit der Rolle von Ludwig XIV. im Ballet Royal de la nuit von 1653 und untersucht, wie er diese Rolle zur Ausübung und Demonstration seiner absolutistischen Macht nutzte. Die Arbeit analysiert die Symbolik des Monarchen als Sonnengott Apollon im Ballett und untersucht den Einfluss von Ballett auf die öffentliche Meinung über Ludwig XIV.
- Die Bedeutung des Balletts im Kontext der Macht Ludwigs XIV.
- Die Rolle des Monarchen als Sonnengott Apollon im Ballet Royal de la nuit
- Die Symbolik des Ballettstücks und die Inszenierung von Macht
- Die Institutionalisierung von Ballett und Tanz durch Ludwig XIV.
- Die Auswirkung des Balletts auf die öffentliche Meinung über Ludwig XIV.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema des Aufsatzes vor und beleuchtet die historische Bedeutung des Balletts zur Zeit Ludwigs XIV. Sie erläutert die Hypothese der Arbeit, wonach Ludwig XIV. seine Rolle im Ballet Royal de la nuit zur Stärkung seiner Macht einsetzte.
Das Kapitel "Hintergrundinformationen" liefert biographische Informationen zu Ludwig XIV. und seinem Aufstieg zur Macht, erläutert das Konzept des Absolutismus und beleuchtet die Herrschaft Ludwigs XIV. als absolutistischer Monarch. Es stellt auch das Ballet Royal de la nuit vor und beleuchtet die Institutionalisierung von Ballett und Tanz durch Ludwig XIV.
Das Kapitel "Analyse" befasst sich mit der Symbolik der Sonne und des Apollon im Ballet Royal de la nuit und interpretiert diese Symbolik im Kontext der Macht Ludwigs XIV. Es untersucht auch die Auswirkungen der Institutionalisierung von Ballett und Tanz auf die öffentliche Meinung über den König.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Ludwig XIV., Ballett, Absolutismus, Ballet Royal de la nuit, Macht, Symbolik, Sonne, Apollon, Institutionalisierung, öffentliche Meinung.
- Quote paper
- Sara Issguhi Reisyan (Author), 2019, Die Bedeutung des Balletts im Kontext der Macht Ludwigs XIV. Das Ballettstück "Ballet Royal de la nuit" aus dem Jahr 1653, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1034490