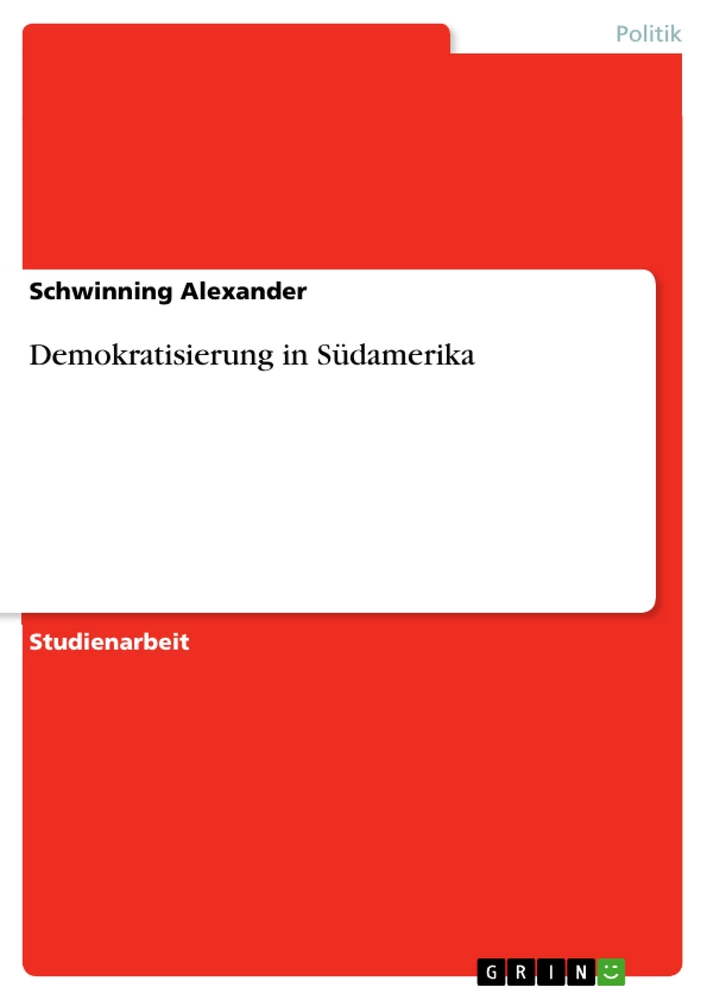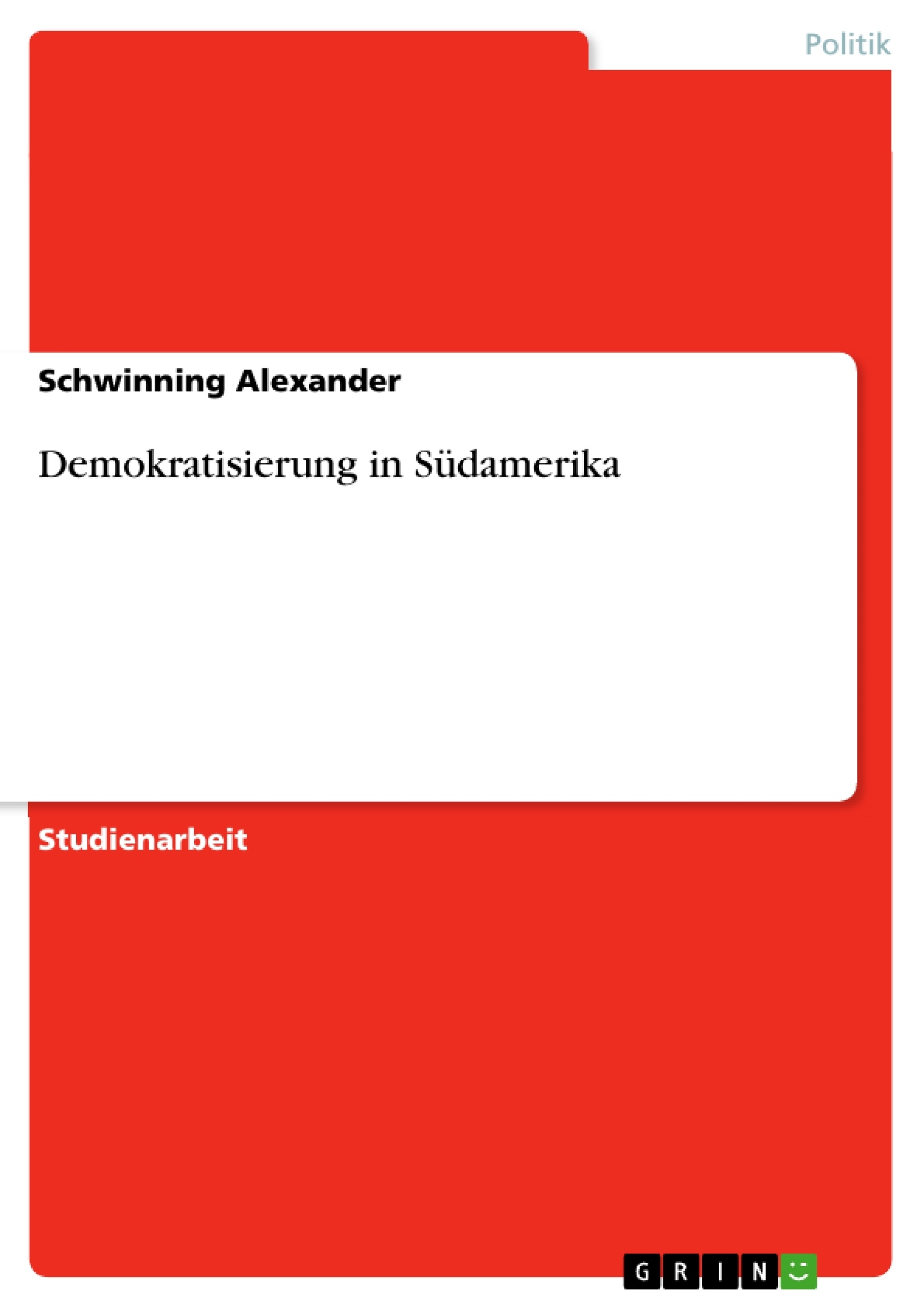1. Einleitung
Nach ersten Demokratisierungsversuchen in den 60er und 70er Jahren erlebte der südamerikanische Kontinent am Ende der 80er Jahre eine neue Welle von liberalen Revolutionen. Bis auf Kuba, wo Castro auch weiterhin die absolute Kontrolle ausüben kann, haben mittlerweile alle Länder Lateinamerikas ihre ehemaligen autoritären Machthaber verjagt und durch gewählte zivile Regie- rungen ersetzt, auch wenn das Militär als der „große Bruder“ im Hintergrund wacht und immer noch nach der Macht greifen könnte, ohne daß ein ernsthafter Widerstand zu erwarten wäre. Dabei sind sämtliche neue Regierungen nicht durch gewaltsame Aktionen, sondern durch mehr oder wenig ruhig verlaufene und relativ demokratische Prozesse an ihre heutige Ämter gelangt.
In dieser Hausarbeit sollen deshalb einige Aspekte der Umschwünge in den verschiedenen Staaten näher untersucht werden. Dazu gehören unter ande- rem: Wieso war die Zeit reif für eine Revolution ? Welche Faktoren wirtschaftli- cher, sozialer und politischer Art trugen letztendlich dazu bei, daß ein Um- schwung in einem Land stattfinden konnte ? Mit welchen Schwierigkeiten, die eine Stabilisierung eines demokratischen Systems auf Dauer gefährden könnten, haben auch die neuen Führer zu kämpfen ? Ebenfalls beleuchtet werden soll die Rolle der Opposition, die als Alternative zu einer autoritären Regierung eine wichtige Position bei der Realisierung einer demokratischen Verfassung innehat, gleichzeitig aber aufpassen muß, daß sie erstens nicht ihr Ziel aus den Augen verliert, und zweitens, daß sie nicht von der Regierung für deren Pläne mißbraucht wird und so im Endeffekt ihre Funktion als Opposition verliert.
2. Ursachen für einen Umschwung
Zu den politischen Umschwüngen in den Staaten Lateinamerikas trugen zahlreiche unterschiedliche Faktoren bei. Neben sozialen Aspekten waren es vor allem die wirtschaftlichen Gründe, die eine Atmosphäre der Transition vom autoritären Regime zu demokratischen Verhältnissen begünstigten.
Viele Diktatoren waren mit dem Anspruch an die Macht gekommen, die katastrophalen ökonomischen Bedingungen in dem von ihnen übernommenen Land zu stabilisieren und im Anschluß daran zu verbessern (Fanger 1994: S. 85). Außerdem standen die Regierungen der verarmten Länder Lateinamerikas vielfach unter dem Druck internationaler Kreditgeber wie der Weltbank, die als Gegenleistung für eine finanzielle Unterstützung demokratische Reformen und wirtschaftliche Liberalisierungsmaßnahmen einforderten. Durch diese Mißerfolge wiederum könnten bei den Verantwortlichen vieler militärisch gelenkter Länder Zweifel an dem eigenen Machtanspruch entstanden sein, was zum Teil in eine nachträglichen Rechtfertigung der Übernahme durch Wahlen oder nur in eine scheinbare Legitimierung durch die Kooperation mit zivilen Personen mündete (Fanger 1994: S. 86). Auf der anderen Seite konnte auch eine Lage entstehen, in der der Konflikt zwischen den eher autoritär eingestellten Militärs und den eher gemäßigten Kräften nur dadurch entschärft werden konnte, daß man sich zu einem Verzicht auf die Regierungsgewalt zugunsten demokratisch legitimierter Herrscher einigte. Die Einsicht ihrer eigenen beschränkten Herrschaftsfähigkeit kann die Militärjunta unter Umständen also dazu bewogen haben, einen unbluti- gen Umschwung zu erlauben, ohne ihr Gesicht zu verlieren..
2.1. Wirtschaftliche Aspekte
Hinzu kommen weitere Faktoren: In den 50er Jahren ereigneten sich zahlreiche wirtschaftliche und soziale Veränderung in Süd- und besonders Zent- ralamerika. Die Bevölkerungsanzahl explodierte regelrecht und die Arbeit verla- gerte sich stärker von der Landwirtschaft in den Dienstleistungs- und Produkti- onssektor: der Mittelstand wuchs (vgl. Booth 1991: S. 38). Grund dafür waren Bemühungen der jeweiligen Regierungen, den Wirtschaftsprozeß anzukurbeln, und zwar durch die Kultivierung von Getreide und Baumwolle sowie durch in- tensive Viehzucht. Dadurch nahmen die Regierungen jedoch in Kauf, daß ihre Wirtschaft sich stark exportorientiert entwickelte. Verschiedenen Theorien über soziale Umschwünge und Ursache der Unzufriedenheit der Landbevölkerung zufolge, liegt hier ein wichtiger Grund für die Entstehung von Revolten und Um- stürzen (vgl. Booth 1991: S. 35): Es entsteht ein Mangel an bestimmten Pro- dukten und Nahrungsmitteln im Inland, der nur durch massiven Import wieder ausgeglichen werden kann. Die Anzahl der selbständigen Kleinbauern in Süd- amerika ging zurück, weil sich immer mehr Land in den Händen immer weniger Großgrundbesitzer konzentrierte. Gleichzeitig konnte durch die steigende Anzahl an arbeitslosen Tagelöhnern das Pro-Kopf-Einkommen dieses „Arbeiterheeres“ niedrig gehalten werden. Einen Teil dieser Tagelöhner zog es in die Städte, die mit allen Konsequenzen dieses Massenansturmes zu kämpfen hatten.
Durch verschiedene Maßnahmen der Regierungen beschleunigten sich die wirtschaftlichen Entwicklungen. Das Ziel dieser Bemühungen war es, einen gemeinsamen regionalen Markt zu gründen, der die Nachfrage und Produktion bestimmter Güter stimulieren sollte (vgl. Booth 1991: S. 38). Gleichzeitig sollten neue Arbeitsplätze kreiert werden, um so revolutionären Politikern wie Castro, der gerade in Kuba die Macht an sich gerissen hatte, den Wind aus den Segeln zu nehmen; regionale Investoren wie die Staaten des Central American Com- mon Market (CACM) verstärkten ihr Engagement in Latein- und im besonde- ren in Mittelamerika. Man konzentrierte sich hauptsächlich auf die kapitalinten- sive Herstellung von Konsum- und Luxusgütern aus importierten Rohstoffen. Durch protektionistische öffentliche Maßnahmen und eigene Investitionen wurden außerdem die Produktion von Massenwaren und Halbfabrikaten gefördert (vgl. Kleinmann 1992: S. 26). Die Folge war, daß in den frühen 70er Jahren die Bruttoinlandsprodukte stetig stiegen, unter anderem, weil die Kosten der Importe über Jahre hinweg einigermaßen stabil geblieben waren - die Industrie und die Produktivität boomten (vgl. Booth 1991: S.39).
Allerdings bedeutete eine prosperierende Industrie nicht gleichzeitig auch mehr allgemeinen Wohlstand, denn der industrielle Aufschwung konnte nicht mit dem schnell steigenden Angebot an Arbeitskräften mithalten: die Ar- beitslosigkeit in den Städten und auf dem Land stieg weiter an. Die Arbeitslo- senquote stieg von 8.1 Prozent am Anfang der 60er Jahre auf 14,5 Prozent im Jahre 1980. Auch der wirtschaftliche Aufschwung flaute schnell wieder ab, weil zum einen die Kosten der Importe in die Höhe schnellten, zum anderen aber auch die einheimische Produktivität und Investitionstätigkeit zu wünschen übrig ließen. Dementsprechend sank auch die Nachfrage im Inland, die Arbeitslosig- keit stieg an und der Anteil der Industrie am gesamten Exportaufkommen ging drastisch zurück. Mitte der 70er Jahre konnte zum Beispiel Guatemala noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,2 Prozent verzeichnen; zehn Jahre später ging das BIP um 2,4 Prozent zurück.
Ein uneinheitliches Bild ergibt der Vergleich der Entwicklung der Arbei- tereinkommen. Durch das Ölembargo der OPEC im Jahre 1973 stieg die Preise für den Endverbraucher dramatisch an. Dadurch sank das tatsächliche Einkom- men in zahlreichen Staaten Latein- und Zentralamerikas (vgl. Booth 1991: S. 41). In Honduras und Costa Rica jedoch erlangten die Löhne gegen Ende der 70er Jahre einen großen Teil ursprünglichen Kaufkraft wieder zurück.
Als Hindernis erwies sich vor allem die beschränkte Aufnahmefähigkeit des südamerikanischen Marktes, weil in fast allen Ländern trotz der Bemühun- gen um den ökonomischen Aufschwung die landwirtschaftlichen Strukturen bei entsprechend niedriger Bezahlung beibehalten wurden. Auch die technisch ge- ringeren Möglichkeiten als beispielsweise die der Staaten in Ostasien haben dabei eine wichtige Rolle gespielt (vgl. Kleinmann 1992: S. 28). Die Folgen der mißglückten Maßnahmen sind eine große Umweltzerstörung, Landflucht und eine Konzentration der Bevölkerung in großen Metropolen mit weiteren sozialen und wirtschaftlichen Problemen. Für die Jahrtausendwende wird damit gerech- net, daß ¾ aller Bewohner eines Landes in einer Stadt leben. Die Anzahl der Menschen auf dem Land nimmt entsprechend ab. Dabei müssen allerdings re- gionale Unterschiede beachtet werden: Während in Argentinien das Verhältnis zwischen Land- und Stadtbevölkerung schon bei 86 Prozent liegt, liegt der Pro- zentsatz in Guatemala erst bei 39 Prozent. Verantwortlich für diese Konzentra- tion ist natürlich in erster Linie die Hoffnung auf eine gut bezahlte Arbeitsstelle. Das Dilemma ist allerdings, daß die lateinamerikanischen Großstädte immer weniger dazu in der Lage sind, ihre Bewohner mit Wohnungen, Freizeitanlagen und Transportmitteln auszustatten.
2.2. Agrarreform
Es wurde in fast allen Ländern der Versuch gestartet, mittels einer Ag- rarreform neue Verhältnisse zu schaffen. Besonders die Großgrundbesitzer soll- ten einen Teil ihres Reichtums an die Arbeiter abgeben. Betroffen waren aber auch die kleinen Betriebe, die oft nicht einmal eine einzige Familie unterhalten konnten, oder die Indianergemeinschaften. Das Ziel der Regierungen war es, die veraltete Arbeitsgesetzgebung, die zum Teil noch aus der Kolonialzeit stammte, zu ersetzen. Leider sind alle Reformen bis auf das kommunistische Kuba ohne weitreichende Konsequenzen geblieben, unabhängig von der Regierungsform. Ein Hauptgrund für das Scheitern dürfte in der Starrheit des lateinamerikani- schen Zweiklassensystems liegen: die obere Schicht war nicht bereit, ihren Teil zu einer gerechteren Verteilung der Ressourcen beizutragen. Deshalb finden vor allem bei der ländlichen Bevölkerung gewaltsame Problemlösungen immer mehr Anhänger (vgl. Kleinmann 1992: S. 19).
Eine Studie über den Reformversuch in Peru kommt zu folgendem Ur- teil: Die Erwartungen der Bevölkerung in das ANTA-Projekt von 1970 waren dermaßen groß, daß das Ausbleiben kurzfristiger Erfolge die Probleme nicht löste, sondern im Gegenteil noch verschärfte. Die Leitung der Genossenschaften vernachlässigte die Bedürfnisse der Campensinos und Comuneros; durch schlechte Vermarktung und Korruption wurden die Genossenschaften zum neu- en Feindbild für die Arbeiter. Die bloße Enteignung von Großgrundbesitzern ohne eine entsprechende wirtschaftliche Aufklärung von Randgruppen kann offensichtlich keinen integrativen Prozeß bewirken (vgl. Kleinmann 1992: S. 21). In Brasilien kam es sogar zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Landeigentümern und Campensinos, als Flächen besetzt wurden, von denen vermutet wurde, daß sie im Zuge der umfassenden Bodenreform enteignet wer- den würden.
Einen Ausweg aus der immer schwieriger werdenden Lage im Agrarsektor fanden viele Bauern im Anbau von Koka-Pflanzen, die als Rohstoff für die Produktion von Rauschgift dienen (vgl. Kleinmann 1992: S. 45).
3. Leistungsvergleich: Autoritäre und demokratische Regierungen
Für den Leistungsvergleich zweier konträrer politischer Systeme bieten konkrete wirtschaftliche und soziale Daten und Zahlen die beste Basis. Länder wie Kolumbien, Costa Rica und Venezuela, in denen sich die Demokratie dau- erhaft etabliert hat, sollen mit Staaten wie Argentinien, Brasilien, Mexiko und Chile verglichen werden, die wiederholt unter diktatorischer Herrschaft standen. Analysiert werden soll dabei der Zeitraum von ungefähr 1960 bis 1985.
3.1 Bruttoinlandsprodukt, Pro-Kopf-Einkommen, Inflation, Schulden
Im Vergleichszeitraum von 25 Jahren konnten alle drei demokratischen Länder einen respektablen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukt aufweisen. Den- noch ist ein Wachstum von durchschnittlich 3,8 Prozent in Venezuela eigentlich eher als enttäuschend zu bezeichnen. Offensichtlich konnten die hohen Gewinne, die durch Ölvorkommen im Lande erzielt wurden, nicht gewinnbringend inves- tiert werden. Auch das Pro-Kopf-Einkommen wuchs an: um 368 Dollar (Vene- zuela), 608 Dollar (Costa Rica) bzw. 480 Dollar (Kolumbien). Die zweite Gruppe von Staaten bietet ein recht uneinheitliches Bild: Besonders Brasilien und Mexiko können ein starkes Wachstum von durchschnittlich 6,9 Prozent bzw. 5,9 Prozent aufweisen. Andererseits ist das chilenische Bruttoinlandspro- dukt trotz einiger wirtschaftlich guten Perioden nur um 1,2 Prozent gestiegen und in Argentinien von 1976 bis 1983 sogar um einen Prozentpunkt gesunken (vgl. Sloan 1989: S. 119).
Das Pro-Kopf-Einkommen chilenischer Arbeiter mußte sogar einen leichten Rückgang von 61 Dollar hinnehmen. Offensichtlich können demokrati- sche Wirtschaftssysteme durchaus mit einer Zwangswirtschaft konkurrieren oder diese sogar überflügeln. Damit wird auch der allgemeinen Einschätzung widersprochen, daß gewählte Führer eine langfristige ökonomische Planung zugunsten eines kurzfristigen Konsumimpulses opfern würden (vgl. Sloan 1989: S. 114): Politiker könnten in die Versuchung geraten, sich durch kostspielige und leichtsinnige Subventionen beispielsweise bei Nahrungs- oder Transportmitteln die Stimmen der armen Massenbevölkerung zu „erkaufen“. Das würde im Endeffekt zu einem riesigen Defizit im Staatshaushalt und zu anderen unangenehmen Konsequenzen wie Inflation führen. Besonders unter Anhängern undemokratischer Staaten war diese Ansicht weit verbreitet.
Allerdings sprechen auch hier die Zahlen eine deutliche andere Sprache: Zwar ist eine Inflation von 17,6 Prozent in Kolumbien wenigstens nach heutigen westlichen Maßstäben alles andere als akzeptabel; im Vergleich zu den Ländern der anderen Gruppen schneiden Kolumbien, Costa Rica (12,9 Prozent Inflati- on) und besonders Venezuela (6 Prozent Inflation) jedoch sehr gut ab. In Chile verlor die Währung pro Jahr durchschnittlich 93,5 Prozent ihres Wertes und in Argentinien von 1976 bis 1983 pro Jahr gar 207,1 Prozent. Diese Zahlen sind um so erstaunlicher, wenn man sich daran erinnert, daß einige dieser Regime sich die Macht unter der Voraussetzung erkämpft haben, die riesige Inflation bekämpfen zu wollen (vgl. Sloan 1989: S. 120).
Ein weiteres Indiz für die Effektivität der Wirtschaftspolitik ist der Grad der Auslandsverschuldung. Auf diesem Gebiet haben sowohl die demokrati- schen als auch die Gewaltherrscher mit Ausnahme Venezuelas, das aufgrund seiner Ölvorhaben im Vergleich zu den anderen Ländern deutlich bevorteilt ist, keine guten Zahlen vorzuweisen. Gemessen wird dabei der Verhältnis der jährli- chen Schuldentilgung zu Gesamtsumme aller exportieren Güter desselben Jah- res: Je höher der Prozentsatz, desto unwahrscheinlicher ist es, daß ein Land seinen Verpflichtungen zur Erstattung der Auslandsschulden nachkommen kann. Alle sechs Länder liegen dabei deutlich über der Grenze von 20 Prozent, die im Allgemeinen als Wert für eine sehr hohe Verschuldung angesehen wird.
Generell läßt sich sagen, daß die sogenannten Terms of Trade (also das Verhältnis des Preisindex für Einfuhrgüter zum Preisindex für Ausfuhrgüter) bei einem Land wie Venezuela, daß in starkem Maße vom Erlös seiner Ölexporte (deren Preis deutlichen Schwankungen unterliegt) abhängig ist, sich deutlich verbessert haben, eine Tendenz zur Benachteiligung aber immer noch vorhanden ist (vgl. Kleinmann 1992: S. 14).
3.2. Schule, Analphabetentum, Kindersterblichkeit, Lebenserwartung
Auf dem Gebiet der sozialen Errungenschaften haben sowohl die demo- kratischen Länder als auch die autoritären Länder beträchtliche Fortschritte erzielen können. Die Prozentsätze von Schülern im Alter von sechs bis elf und von zwölf bis 17 Jahren sind in allen sieben Ländern deutlich gestiegen, teilweise bis auf 100 Prozent. Auch das Analphabetentum konnte erfolgreich bekämpft werden, so daß mit Ausnahme Brasiliens (76 Prozent) durchschnittlich ungefähr 90 Prozent alle Einwohner eines Landes das Lesen und Schreiben beherrschten (vgl. Sloan 1989: S.121 - 122).
Die Kindersterblichkeit konnte in allen Ländern auf ein niedrigeres Ni- veau gesenkt werden, obwohl die Prozentzahl toter Kinder in Brasilien unver- ändert hoch bleibt. Zu beachten ist außerdem, daß in den demokratischen Län- dern die Kindersterblichkeit im Durchschnitt geringer ist. Der Vergleich der verschiedenen Lebenserwartung ergibt ebenso ein recht uneinheitliches Bild: In allen Länder konnte die Lebensdauer im Betrachtungszeitraum um durchschnitt- lich ungefähr 7 Jahre gesteigert werden. Costa Rica liegt mit 73 Jahren deutlich an der Spitze vor Argentinien und Chile; Schlußlicht ist Brasilien mit einem Durchschnitt von 63,4 Jahren (vgl. Sloan 1989: S. 123).
3.3. Schlußfolgerung
Offensichtlich scheint es nicht möglich, ein System anhand der vorlie- genden Daten zu bevorzugen. Sowohl demokratische Länder als auch autoritär geführte Länder waren in der Lage, (wenn auch in unterschiedlichem Maße) wirtschaftliches Wachstum zu erzielen. Anders als bei autoritären Herrschern wird in einer Demokratie ein größeres Gewicht auf eine Vielzahl von Zielen ge- legt, anstatt lediglich nach Wachstum oder der Verteilung von Besitz und Eigen- tum zu streben. Andererseits: Durch den Versuch, ihre Kompetenz durch hohe Wachstumsraten auch im Wirtschaftssektor unter Beweis zu stellen, wurden die Länder anfällig für eine hohe Auslandsverschuldung. Der Vorteil der Demokra- tie liegt anscheinend darin begründet, daß man die gesteckten Ziele auch ohne die Repressions- und Zwangsmaßnahmen einer Diktatur erreichen kann.
4. Gefahr einer zyklischen Entwicklung
4.1. Mittelfristige Perspektiven
Natürlich beinhaltet die Diskussion der Stabilität einer neuen demokra- tisch legitimierten Regierungsform auch die Frage nach der Gefahr einer zyklisch orientierten Entwicklung, denn angesichts der Erfahrungen, die Lateinamerika in der Vergangenheit (immerhin alternieren autoritäres und demokratisches Regime mit „schöner“ Regelmäßigkeit seit mehr als vierzig Jahren) mit dem Wechsel zwischen den beiden Extremen hat machen müssen, ist diese Möglichkeit auch nach der gegenwärtigen Welle nicht von der Hand zu weisen; einige Staaten haben in der Vergangenheit sogar den Sozialismus eingeführt (vgl. Sloan 1989: S. 114). Oftmals wurde danach die neue demokratische Ordnung zwar gedul- det - blieben jedoch die erwarteten Erfolge aus, konnte die Stimmung auch schnell wieder ins Gegenteil umschlagen. Dennoch gibt es zahlreiche Fakten, die im Gegensatz zu früheren Versuchen, ein neues und gerechteres System zu etablieren, für eine gewisse Standhaftigkeit der neuen Herrscher sprechen:
- Die Ablösung durch zivile Exekutiven geschieht zielstrebiger als bei früheren Gelegenheiten: So sind auch die bisher sofort auftretenden Gegenbewegun- gen, die eine Rückkehr zum ehemaligen autoritären System forderten und die junge Demokratie zwangsläufig schon wieder destabilisierten, nach dem Verschwinden des Kommunismus als möglichem Alternativmodell nicht mehr vorhanden.
- Der stärkere Einfluß internationaler Organisationen wie der Weltbank hemmt die Möglichkeiten reaktionärer Kräfte, ihre Absichten durchzuset- zen.
- Im Laufe der Zeit sind auch in die militärischen Führung immer mehr demokratische Wertvorstellungen eingedrungen.
- Es sind bürgerliche Schichten entstanden, die für sich die Fähigkeit in Anspruch nehmen konnten, nach der Machtübernahme für die mittleren und unteren Bevölkerungsschichten zu sprechen (vgl. Fanger 1994: S. 86).
Zählt man diese Faktoren zusammen, so erscheint die Wahrscheinlich- keit, daß das Militär einen Anspruch auf eine Rückkehr an die Schalthebel er- hebt, eher gering; als Folge der zahlreichen negativen Erfahrungen im Laufe der 60er, 70er und 80er Jahren scheuen sich die oberen Schichten der Militärs vor einem neuen Machtexperiment, zumal die Gefahr, daß nach einem Putsch in einem lateinamerikanischen Land auch die Armeen in anderen benachbarten Staaten außer Kontrolle geraten könnten, durch den Wegfall des Ost-West- Konfliktes größtenteils verschwunden ist. Gefahr droht unter Umständen noch von jungen Nachwuchsoffizieren, die sich in der militärischen Ausbildung befin- den und deshalb die Konsequenzen übertriebener Versprechen und das Versa- gen bezüglich der wirtschaftlichen Perspektiven noch nicht am eigenen Leibe haben erfahren können (vgl. Fanger 1994: S. 87). Gelingt es den derzeit im Amt befindlichen Regierungen, die wirtschaftliche Lage ihrer Nation soweit zu verbessern, daß die Bürger diese positive Entwicklung beispielsweise durch einen neuen Arbeitsplatz oder durch gestiegene Löhne bei minimaler Inflation in ihrem Alltag verspüren können, sollten sich die demokratischen Regierungen auf mittlere Sicht im Amt halten können, ohne durch einen gewaltsamen Umsturz vertrieben zu werden.
4.2. Langfristige Perspektiven und politische Verhaltenstraditionen
Langfristig gesehen könnte sich die Entwicklung allerdings durchaus weniger positiv gestalten. Dann spielen nämlich die politischen Verhaltens- traditionen der Lateinamerikaner eine wichtige Rolle - und die lassen (wenigs- tens aus westeuropäischer Sicht) nicht zwangsläufig darauf schließen, daß nach der letzten Demokratisierungsflut unter den Länder Lateinamerikas das Ge- spenst der erneuten Machtübernahme durch die Militärs für alle Zeiten gebannt ist. Tatsächlich gibt es einige in der wirtschaftliche, sozialen und politischen Tra- dition Lateinamerikas verwurzelten Faktoren, die auf lange Sicht zu einer Gefahr für eine dauerhafte Etablierung der Demokratie werden könnten.
Vergleicht man die lateinamerikanische Vorstellung von Demokratie mit der Version, die sich in den westeuropäischen und nordamerikanischen Staaten durchgesetzt hat, lassen sich schnell einige wesentliche Unterschiede ausmachen, die sich nicht zuletzt auf die Einflüsse der spanischen Eroberer und der kolonia- len Sozialstruktur zurückführen lassen. Seit der Unabhängigkeit im 19. Jahrhun- dert hat sich die so geprägte Gesellschaft weiter gefestigt. Im Gegensatz dazu begründen sich die Verfassungen Westeuropas und besonders Nordamerikas eher auf die Lehren von John Locke und dem angelsächsischen Liberalismus (vgl. Fanger 1994: S. 89). Dabei haben unter anderem folgende Elemente das Verhältnis zwischen Staat, Bürger und politischer Einstellung besonders beein- flußt:
- eine leichte Tendenz zu einer autoritär geprägten Führung
- starkes Hierarchiedenken und die Betonung von Statussymbolen n das Bilden von Eliten
- ein Obhuts- und Beschützerverhältnis zwischen Reich und Arm
Eine wichtige Rolle spielt dabei die durch die spanischen Eroberer im- portierte christliche Religion, verlangt doch die christliche Lehre die Unterstüt- zung der Schwachen durch die wirtschaftlich Stärkeren. Aus dieser Schützer-
Beschützter-Beziehung ist im Laufe der Jahrhunderte eine gegenseitige Abhän- gigkeit der beiden Parteien entstanden: Während die „Starken“ beschützen und fördern, unterstützen die „Schwachen“ ihre Wohltäter vorbehaltlos. Kommt eine Seite jedoch ihren Verpflichtungen nicht nach, bricht das System zwangsläufig zusammen. Dieser Klientelismus hat also die Etablierung eines stark hierarchisch orientierten System begünstigt (vgl. Fanger 1994: S. 90), denn solange die Inte- ressen der Beschützten von ihren Herrschern nicht deutlich mißbraucht werden, können die führenden Schicht auch weiterhin von der Loyalität ihrer Untergebe- nen ausgehen. Um die eigene Zugehörigkeit zu einer der oberen Schichten in einer derart konzipierten Gesellschaft zu demonstrieren, wird in den Ländern Lateinamerikas außerdem verstärkt Wert auf Statussymbole gelegt.
Für den Einfluß dieser Faktoren spricht auch die Tatsache, daß zahlrei- che lateinamerikanische Führer (demokratisch legitimiert oder nicht) mittels po- pulistischer Versprechungen an die Macht gelangt sind (vgl. Sloan 1989: S. 114). Erfüllt diese „Vaterfigur“ seine Versprechen jedoch nicht, ist damit zu rechnen, daß das gerade installierte System schnell wieder ins Wanken gerät.
4.3. Weitere Faktoren, die eine Demokratisierung behindern könnten
Dennoch sollte man nicht davon ausgehen, daß Lateinamerika aufgrund kultureller Traditionen grundsätzlich demokratiefeindlich und deshalb für eine Demokratie nach westlichen Vorstellungen ungeeignet ist. Ein weiterer Faktor, der die Entwicklung ebenfalls nachhaltig negativ beeinflussen könnte, ist das wirtschaftliche und politische Interesse von verschiedenen Gruppen, aber auch einiger Einzelpersonen (vgl. Fanger 1994: S. 91).
Ermöglichten die wirtschaftlichen Voraussetzungen abhängige Arbeits- verhältnisse und auf der anderen Seite eine massive Anhäufung von Reichtü- mern, so entwickelten sich daraus zwangsläufig ungleiche soziale Bedingungen. Unter dem Einfluß des bereits geschilderten Abhängigkeitsverhältnisses zwi- schen Schützern und Beschützten konnte deshalb besonders in denjenigen Ge- bieten eine autoritäre Herrschaft Fuß fassen, in denen die spanischen Kolonialis- ten die indianischen Eingeborenen oder „importierte“ Afrikaner zu Sklavenarbeit gezwungen hatte. Dementsprechend kam es später hauptsächlich in den Län- dern zu verfassungswidrigen Handlungen, die in der Kolonialzeit eine hohe Kon- zentration von finanziellen Mitteln in den Händen der westeuropäischen Erobe- rer gesehen hatten und deshalb besonders durch diese Privilegien geprägt wa- ren. Länder, die ein derartiges Mißverhältnis nicht selber erlebt hatten, brachten später in der Regel Systeme hervor, die sich zumindest über einen gewissen Zeitraum als stabil erweisen sollten (vgl. Fanger 1994: S. 92). Dennoch sind wohl gewisse für Lateinamerika typische Verhaltensmuster erhalten geblieben. Dennoch ist die Verbindung zwischen sozialer Ungleichheit und Hierarchieden- ken keineswegs typisch für Lateinamerika, denn schließlich herrschten auch in zahlreichen Bundesstaaten der USA wie South Carolina und Alabama über viele Jahre hinweg hierarchisch-autoritäre Regime. Problematisch ist auch der weit verbreitete Glaube an die persönliche Beeinflußbarkeit von Regierungsent- scheidungen: zwar verfügen die betroffenen Institutionen normalerweise über die rechtlichen Voraussetzungen, eine Mißachtung zu bestrafen. In der Praxis je- doch haben die Kontroll- und Sanktionsmechanismen selten eine wirklich durchschlagende Wirkung.
5. Mobilisierung der Massen
Können sich die Anführer einer Revolution nicht auf die Unterstützung des Volkes berufen, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, daß es sich um die Installierung eines undemokratisch-autoritären Regimes handelt. Für eine Beteiligung der breiten Bevölkerung müssen jedoch einige Aspekte berücksich- tigt werden: Höhe des Einkommens, soziale Bedingungen oder auch Naturka- tastrophen haben bei dem Erstarken der Reformbewegungen in Zentralamerika eine entscheidende Rolle gespielt. Parallel zur steigenden Anzahl von Menschen, die unzufrieden mit dem vorhandenen System waren, stieg in den 70er Jahren gleichzeitig auch die Anzahl von Selbsthilfeorganisationen, die mit einfachen und systemkonformen Mitteln eine Erleichterung der Lage schaffen wollten. Erst später entstanden aus diesen Gruppen dann Organisationen, die auch bereit waren, sich mit riskanten Unternehmungen wie offener Protest oder Streiks gegen die Herrschaft aufzulehnen (vgl. Booth 1991: S. 49). Am Beispiel Guatemalas sollen diese Vorgänge verdeutlicht werden.
5.1. Der Putsch in Guatemala
Als 1954 ein äußerst repressives konterrevolutionäres Regime die Macht durch einen Coup an sich riß, wurden soziale und wirtschaftliche Refor- men bald wieder rückgängig gemacht. Erst ungefähr zwanzig Jahre später erhob sich ernsthafter Widerstand, der allerdings wegen der zahlreichen Repressalien in seinen Möglichkeiten stark eingeschränkt war. Aufgrund sinkender Einkom- men gewannen die Gewerkschaften an Einfluß. Durch ein verheerendes Erdbe- ben 1976, das besonders die Slumbewohner hart traf, organisierten sich diese Unterschichten in zwei Gruppen, die zwei Jahre später einen Streik im Trans- portwesen anzettelten und auf schnelle öffentliche Unterstützung beim Bau neuer Wohnungen drängten (vgl. Booth 1991: S. 51).
Wie auch in den Nachbarländern spielte die Kirche eine wichtige Rolle. Durch die Entstehung von CEBs (comunidades eclesiales de base, also Ge- meinschaften mit christlichem Hintergrund) konnte auch der indianische Bevöl- kerungsanteil mit die Organisationen von Arbeitergruppen einbezogen werden. Die Macht der anderen politischen Parteien blieb jedoch begrenzt, weil die herrschenden Partido Institucional Democratico (PID) und die Movimiento de Liberacion Nacional (MLN) die Ergebnisse der Wahlen von 1974, 1978 und 1982 in ihrem Sinne manipulierten, um nicht die Kontrolle über das Amt des Präsidenten abgeben zu müssen. Als Folge dieser Fälschungen sank das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Regierung. Um diesen Unmut auszudrücken, blieben immer mehr Wähler dem Urnengang fern: der Anteil der Nichtwähler wuchs von 44 Prozent aller registrierten Stimmberechtigter 1966 auf 64 Prozent bei den Wahlen zwanzig Jahre später. Als bei der Wahl 1982 die Unregelmäßigkeiten zu offensichtlich wurden, begannen junge Offizieren vorsichtige Reformen: General Efrain Rios Montt wurde der neue Präsident.
Die Reaktionen und Repressionen der Machthaber waren besonders am Anfang ihrer Herrschaft äußerst heftig: Indianer, Studentengruppen, Ge- werkschafter und Bauern wurden rigoros unterdrückt. Angst und Terror ver- breiteten unter anderem staatliche Todes- und Killerkommandos, die in jedem Monat für Dutzende von Opfern verantwortlich zeichneten. Während der Amts- zeit von Colonel Kjell Laugerud Garcia (1974 bis 1978) verstärkte sich der Widerstand gegen das Regime. Bei der Wahl 1978 errang der Kandidat der PID, General Romeo Lucas Garcia, durch Wahlfälschung den ersten Platz. Er eskalierte den Kampf gegen die Opposition: Hunderte von gegnerischen Politi- kern, Studentenführern oder Gewerkschaftern verschwanden unter mysteriösen Umständen oder wurde einfach auf offener Straße ermordet. 1971 wurden durchschnittlich dreißig politisch motivierte Morde pro Monat begangen; 1982 hatte diese Quote mit beinahe 200 Opfern einen traurigen Höchststand erreicht, ehe sie bis 1987 wieder auf das alte Niveau von ungefähr dreißig sank.
Einen Aufschwung erlebte als Folge der staatlicher Gewaltexzesse die Guerillabewegung. Besonders die Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), die E- jercito Guerrillero de los Pobres (EGP) und eine neue Gruppierung namens Organizacion del Pueblo en Arnmas (OPRA) machten dabei durch bewaffnete Aktionen von sich reden. Die Stärke der Guerillatruppe wurde am Anfang der 80er Jahre auf insgesamt 4000 Mann geschätzt.
Aus Angst vor neuen Aufstanden und einer neuen Gewaltspirale starte- ten junge reformwillige Offiziere ein zweiteiliges Programm, das unter anderem eine Reform der Verfassung und der Wahlgesetzgebung vorsah. 1985 wurde der Christdemokrat Vinico Cerezo Arevalo zum neuen Staatsoberhaupt ge- wählt. Der zweite Teil des Plans allerdings erinnerte an die schlimmsten Aus- wüchse staatlicher Gewalt: Die Armee entvölkerte ganze Dörfer und zwang die Umsiedlung zahlreicher oppositioneller Indianer, die der Unterstützung der Gue- rilla verdächtig waren. Das Ergebnis: wenigstens 500 000 Menschen wurden zu Flüchtlingen. Gleichzeitig hatte sich die Armee durch einige Entwicklungsprojek- te in den ländlichen Gebieten des Landes praktisch den gesamten Einfluß über Wirtschaft und Politik in diesen Gebieten gesichert (vgl. Booth 1991: S. 59). Die Beachtung der Menschenrechte sowie die rechtliche Verfolgung von Ver- stößen gegen diese Rechte werden immer noch behindert. Die Führung der Armee hat also keineswegs die komplette Kontrolle über das Land abgegeben; die Reform ist zu einem „Reförmchen“ verkommen.
Die Entwicklung der Parteienlandschaft spiegelte die Entwicklung der Gesellschaft wieder: um im gemeinsamen Kampf gegen die Regierung besser bestehen zu können, hatten sich anfangs der 80er Jahre zahlreiche Gewerk- schaften und Parteien zu größeren Koalitionen zusammengeschlossen. Mit dem Beginn der „Reformen“ seitens der Armee stagnierten jedoch die weiteren Eini- gungsprozesse. Die Parteien in Guatemala bzw. Lateinamerika sind allerdings nur begrenzt mit den Volksparteien Westeuropas vergleichbar: die innerparteili- che Demokratie ist unterentwickelt; Machtkämpfe und die Austragung persönli- cher Fehden sind an der Tagesordnung. Oft werden Parteien auch als Mittel zur Verteilung lukrativer Posten mißbraucht. Entsprechend der Mentalität zahlrei- cher Südamerikaner steht nicht unbedingt nur das Programm einer bestimmten Partei im Vordergrund. Vielmehr stehen einzelne Persönlichkeiten im Mittel- punkt des Interesses.
5.2. Folgerungen aus dem Beispiel Guatemalas
Durch den Druck der Regierung entstand im Untergrund eine aktive Opposition, die trotz aller Schwierigkeiten (sprich: Staatsterror) am Ende maß- geblich zum Ende der Militärdiktatur beitrug, auch wenn sich die Armee durch diverse Maßnahme ihren Anteil an der Macht gesichert hat. Entstanden ist diese Opposition nicht zuletzt auch aus den Arbeiterschichten, die nicht vom Boom der Wirtschaft (Export von landwirtschaftlichen Gütern in den 50er Jahren und der Industrialisierung in den 60er Jahren) profitieren konnten, sondern im Ge- genteil die Nachteile des Booms spüren mußten (vgl. Booth 1991: S. 60). Hätte die öffentliche Hand wie in Costa Rica oder Honduras auf Gewaltexzesse ver- zichtet oder nur moderate Mittel eingesetzt, wäre die Bildung einer Opposition unter Umständen verlangsamt worden, weil der massive Widerstand gegen die Regierung nicht hätte mobilisiert werden können, obwohl zweifellos eine gewis- se Unzufriedenheit unter der Bevölkerung herrschte: durch den Verzicht des Staates, gegen die ungleiche Verteilung von Eigentum, Besitz und finanziellen Mitteln vorzugehen, vergrößerte sich die Kluft zwischen Arm und Reich trotz der enormen Wachstumsraten in den 50er und 60er Jahren: die realen Einkom- men der Landwirte und städtischen Arbeiter sanken. Hohe Ölpreise und die daraus resultierende Inflation verstärkten bereits vorhandene Tendenzen. Auch der CACM, der ja ursprünglich diese Mißstände hatte beseitigen sollen, erwies sich als Fehlschlag. Die aus diesen Erscheinungen entstandenen Selbsthilfe- und Arbeitsgruppen entwickelten sich immer mehr zu einer aktiven Opposition, die auch große Teile der Bevölkerung für ihre Ziele begeistern konnten. Am Ende lag es an der Reaktion der Regierung, ob sich in einem Staat ein gewaltsamer Umsturz ereignete: je repressiver die Antwort, desto größer die Wahrschein- lichkeit eines Putsches.
5.3. Stabilität der politischen Partizipation
Trotz aller Repressalien waren die Militärherrscher offenbar nicht in der Lage, sämtliche Parteistrukturen aus dem demokratischen Perioden eines Lan- des zu eliminieren. Wie in das Beispiel Chile beweist, war es einigen Parteien sogar in der Illegalität möglich, ein Mindestmaß an Organisation aufrechtzuerhal- ten, so daß sie nach dem Abtritt von General Pinochet mehr oder minder prob- lemlos dazu in der Lage waren, das Steuer im Land wieder in die Hand zu neh- men (Fanger 1994: S. 96). Für eine gestiegene Partizipation spricht auch die Tatsache, daß Umfrageergebnisse in südamerikanischen Ländern auf eine breite Unterstützung der Demokratie hinweisen: 1965 unterstützten in Peru lediglich 20 Prozent die Demokratie als bevorzugte Staatsform. Als 1988 eine ähnliche Be- fragung durchgeführt wurde, war der Anteil der pro-demokratischen Stimmen auf 75 Prozent gestiegen.
Auf der anderen Seite darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß diese Stimmungen sehr wechselhaft sein können, zumal auch in den etablierten west- europäischen Demokratien erste Verschleißerscheinungen aufgetreten sind: So konnten bei diversen Wahlen in Peru zwar stets hohe Wahlbeteiligungen ver- zeichnet werden; auf der anderen Seite sprachen sich 73 Prozent der Peruaner kurze Zeit nach dem Putsch von Präsident Fujimori für diesen „auto golpe“ (d. h. einen Coup gegen sich selbst) aus. Generell läßt sich feststellen, daß die Teil- nahme der Wahlberechtigten an Abstimmungen nach unbestrittenen und vielver- sprechenden Anfangserfolgen in manchen Fällen geradezu dramatisch nachließ (Fanger 1994: S.94). In Brasilien beispielsweise fiel dieser Prozentsatz von 95 Prozent 1986 auf weniger als 70 Prozent bei der Wahl vier Jahre später; fast ein Drittel der abgegebenen Stimmen war ungültig. Auch das in Lateinamerika weit verbreitete Mittel der Wahlpflicht erwies sich als unwirksam: der Anteil der Nichtwähler unterschied sich in Länder mit bzw. ohne Pflicht nur um wenige Prozentpunkte. Offensichtlich also orientieren sich die Lateinamerikaner bezüg- lich der Erwägung anderer Herrschaftsformen, aber auch bei ihrem Abstim- mungsverhalten immer stärker an der ökonomischen und sozialen Lage: Je bes- ser die wirtschaftliche Situation, desto größer wird auch die Unterstützung des Herrschaftssystems und seiner Anführer (Fanger 1994: S. 96). Man kann vermuten, daß die Gründe für diese Sprunghaftigkeit der öffentlichen Meinung vor allem in der Entfremdung der Menschen von den etab-lierten demokratischen Parteien während einer Periode der Diktatur liegen, in denen eben diese Parteien in der Illegalität arbeiten mußten; dadurch war ein Großteil der Bevölkerung von der aktiven Politik ausgeschlossen. Auf der ande-ren Seite konnten sich die politischen Parteien in Chile auch während der Illega-lität unter Pinochet-Diktatur im Untergrund halten, so daß sie nach der Übertra-gung der Macht relativ problemlos an ihre Arbeit anknüpfen konnten. Allerdings dürfte dazu auch das Militär als Überwacher dieser Demokratie zu den relativ stabilen Verhältnissen beigetragen haben, weil so die Parteien und die Wähler aus Furcht vor einer Rückkehr zur gerade überwundenen Tyrannei vor allzu extremen Forderungen zurückgeschreckten und sich eher zur Mäßigung veran-laßt sahen (Fanger 1994: S.96).
Auch die Phase der Absteckung zukünftiger Machtbereiche und die Periode der Vergangenheitsbewältigung, die typisch ist für die Phase zwischen demokratischen und autoritären Staatsformen, verlief weitestgehend ohne Rei- bereien. Das Beispiel Chile beweist also, daß die Wechselhaftigkeit der öffentli- chen Meinung wohl doch nicht so sehr von der Entfremdung während einer Diktatur abhängt. Viel mehr wird der Grad der Etablierung einer Demokratie vor dem Einsetzen der autoritären Herrschaft als Maßstab genommen: Wenn sich also republikanische Prinzipien und Strukturen in einem Land und im allge- meinen Verhalten der Menschen festgesetzt haben, sollte eine Rückkehr zu die- sen Verhältnissen nach dem Ende einer Diktatur relativ problemlos erfolgen können.
6. Die Opposition
Eine aktive demokratisch orientierte Opposition spielt eine wichtige Rolle beim Übergang von einem autoritären Regime zu einer vom Volke gestützten Herrschaftsform, weil durch permanente Störaktionen die Standhaftigkeit einer Diktatur allmählich geschwächt werden kann.
6.1. Analyse verschiedener Interessensgruppen
Die Beziehungen zwischen den folgenden Gesellschaftsgruppen sind bei der Analyse der Aufgaben von Oppositionsgruppen von besonderer Bedeutung (vgl. Stepan 1993: S. 62)
- der „harte Kern“ von Anhängern der Diktatur:
Diese Gruppe unterstützen die derzeitigen Machthaber, weil sie so ihre wirtschaftlichen Interessen am besten vertreten sieht.
- der Machtapparat der Regierung:
Durch Zwangs- und Repressionsmöglichkeiten soll die unzufriedene Bevölkerung am Aufstand gehindert werden.
- die passiven Unterstützer des Regimes
- die passiven Gegner des Regimes
- die aktiven Gegner des Regimes
Der „harte Kern“ (also die bedingungslosen Anhänger) einer undemo- kratischen Herrschaftsform halten eine starke Regierung für eine Abwehrmög- lichkeit gegen alles, was den Status Quo gefährden könnte und werden deshalb auch nicht vor dem Einsatz von Gewalt zurückschrecken, weil sie ja ihre eigenen Interessen verteidigen (vgl. Stepan 1993: S.62). Wegen eines möglichen Ge- walteinsatzes ist es wahrscheinlich, daß die passiven Unterstützer sich dem Re- gime „ergeben“ und unter Umständen sogar indirekt mitarbeiten. Ähnlich verhält es sich auch bei der aktiven und passiven Opposition: durch die massive Dro- hung, Gewalt anzuwenden, sind beide Gruppen zur Untätigkeit verurteilt (vgl. Stepan 1993: S.63).
Ist das autoritäre System schon zum Teil erodiert, verhalten sich die verschiedenen Gruppen hingegen ganz anders: das Regime wird auf einen gro- ßen Teil seiner bedingungslosen Anhänger verzichten müssen, da sich diese Gruppe zersplittert; ein Teil dieser Menschen wechselt eventuell zur aktiven oder passiven Opposition (vgl. Stepan 1993: S. 63). Dadurch wächst für die Regierung die Bedeutung von gewaltsamen Maßnahmen zur Erhaltung ihrer Macht. Für diese Maßnahmen ist allerdings die Hilfe der Offiziere nötig, die ja die Macht über diese Zwangsmittel besitzen. Ob das Militär den Machthabern angesichts der instabilen Lage der Regierung bedingungslos gehorcht, ist zwei- felhaft, weil eine fortgesetzte Hilfe schädlich für die Armee als nationaler Einrich- tung sein würde. Bleibt das Militär ruhig, vergrößert sich automatisch auch der Zuwachs der Opposition. Auch andere einflußreiche Gruppen wie die Kirche oder die Presse würde sich den Regimegegnern unter Umständen anschließen. Die Folge wäre eine zunehmende Anzahl von Aktionen der Opposition, die den Kollaps des Systems beschleunigen könnten: zum einen gibt es mehr personelle Möglichkeiten, zum anderen fehlt auch die Furcht vor Repressionen.
6.2. Aufgaben und Funktionen
Hat sich die Opposition einmal als ernst zu nehmender politischer Fak- tor etabliert, sollte sie sich folgenden Aspekten widmen (vgl. Stepan 1993: S. 64):
- Keine Einbindung in den Apparat:
Entschieden sich die Gegner für eine Kooperation mit den Machthabern, würden sie praktisch als Opposition aus dem aktiven politischen Leben ausscheiden.
- Unabhängigkeit der Opposition:
Bleibt die Opposition als unabhängige Gruppe erhalten, muß sie sich dar- auf konzentrieren, die ohnehin vorhandenen Schwierigkeiten der Regie- rung, ihre Position zu halten, noch weiter zu vergrößern, beispielsweise durch die Publikation der Verfehlungen der Regierung im Ausland. Dabei besteht dann allerdings die Gefahr verstärkter Repressionen. n Bildung einer sinnvollen Alternative:
Es reicht allerdings nicht, sich in Fundamentalopposition zu üben. Viel- mehr müssen die Gegner des Regimes neben ihren Störmanövern gleich- zeitig eigene Vorschlage ausarbeiten, um dem Volke den Sinn eines Machtwechsels zu verdeutlichen. Ohne eigene Vorschläge würde die E- rosion des Systems nur zu einer Verschiebung der Schwerpunkte ohne tiefgreifende Reformen führen. Von großer Wichtigkeit ist dabei auch, daß die verschiedenen Oppositionsgruppen, die nicht notwendigerweise in sämtlichen Punkten einer Meinung sind, sich über prozedurale Fragen einigen können, anstatt sich bereits über inhaltliche Fragen zu streiten. Erkennen die aktiven Anhänger des alten Systems, daß sie auch im neuen Sys-tem weiterhin ihre eigenen Interessen verfolgen könnten, wird bei hnen die Angst vor den Kosten der Reform verschwinden.
7. Schlußfolgerungen
Nach mehreren Jahrzehnten zwischen Demokratie und Diktatur scheint Südamerika im Moment wieder eine etwas ruhigere Phase zu durchlaufen. In allen Ländern sind Systeme installiert, die eine mehr oder weniger demokrati- sche Wahl garantieren. Sogar die friedliche und relativ unproblematische Ablö- sung einer ziviler Regierung durch Abwahl ist inzwsichen keine Seltenheit mehr.
Dennoch ist es nach meiner Meinung leichtsinnig, den derzeitigen Zu- stand auf dem Halbkontinent für stabilisiert zu halten. Eine fundierte Prognose, wie die Situation in Südamerika in zwanzig oder dreißig Jahren aussehen wird, nicht möglich. Zu unabwägbar sind die zahlreiche Faktoren und Personen, die an diesem Ringen um die Macht beteiligt sind: Auf der einen Seite eine Bevölke- rung, die sich immer noch stark auf eine einzelne Person fixieren kann und deren Traditionen oft im Widerspruch zu einer Demokratie nach westlichem Maßstab stehen, auf der anderen Seite eine latente Bedrohung der Demokratie durch das Militär, das seine „Ausflüge“ an die Schalthebel zwar für einige Jahre bereut haben mag, dessen junge Offiziere aber vielleicht immer noch versucht sein könnten, die Macht an sich zu reißen, weil sie die Leistungen einer ziviler Regie- rung für unbefriedigend halten.
Auch die wirtschaftliche Entwicklung wird eine wichtige Rolle bei der weiteren Entwicklung Südamerikas einnehmen. Nach den gescheiterten Versuchen der Industrialisierung, die zwar wirtschaftliche Wachstumsraten produzierten, jedoch ohne die erhofften Erfolge bezüglich Realeinkommen und Anzahl der Arbeitsplätze blieb, muß man abwarten, in wie weit sich die einheimischen Industrien angesichts der steigenden Konkurrenz aus Nordamerika, Westeuropa und Ostasien auf dem Weltmarkt behaupten können
8. Literaturverzeichnis
Booth, John A. 1991: Socioeconomic and Political Roots of National Re- volts in Central America, In: Merkx, Gilbert W. (Hrsg), Latin Ame- rican Research Review, Volume 26, Number 1, S.33-73.
Fanger, Ulrich 1994: Demokratisierung und Systemstabilität in Lateiname- rika, In: Oberreuter, Heinrich / Weiland, Heribert (Hrsg.), Demo- kratie und Partizipation in Entwicklungsländern, Paderborn u.a., 1994
Kleinmann, Hans-Otto 1992: Lateinamerika. Probleme und Perspektiven, Stuttgart.
Sloan, John W. 1989: The Policy Capabilities of Democratic Regimes in Latin America, In: Merkx, Gilbert W. (Hrsg.), Latin American Research Review, Number 24, Volume 2, S. 113-125.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung beschreibt die Demokratisierungswelle in Lateinamerika seit den 1980er Jahren, wobei bis auf Kuba alle Länder autoritäre Regierungen durch gewählte zivile Regierungen ersetzt haben. Die Arbeit soll Aspekte dieser Umschwünge untersuchen, einschließlich der Gründe für die Revolution, wirtschaftliche und soziale Faktoren, Schwierigkeiten bei der Stabilisierung demokratischer Systeme und die Rolle der Opposition.
Welche Ursachen werden für die politischen Umschwünge in Lateinamerika genannt?
Mehrere Faktoren trugen zu den politischen Umschwüngen bei, darunter wirtschaftliche Gründe und soziale Aspekte. Viele Diktatoren übernahmen die Macht mit dem Ziel, die katastrophalen ökonomischen Bedingungen zu verbessern, wurden aber von internationalen Kreditgebern wie der Weltbank zu demokratischen Reformen und wirtschaftlicher Liberalisierung gedrängt.
Welche wirtschaftlichen Aspekte werden als Ursachen für die Umschwünge genannt?
Das Bevölkerungswachstum und die Verlagerung der Arbeit vom Agrar- zum Dienstleistungssektor führten zu einer exportorientierten Wirtschaft. Dies führte zu einem Mangel an inländischen Produkten, dem Rückgang selbständiger Kleinbauern und einer steigenden Arbeitslosigkeit. Maßnahmen zur Gründung eines gemeinsamen regionalen Marktes sollten Arbeitsplätze schaffen, führten aber nicht zu mehr allgemeinem Wohlstand, da die Arbeitslosigkeit weiter stieg.
Welche Rolle spielte die Agrarreform?
Agrarreformen, die darauf abzielten, die veraltete Gesetzgebung zu ersetzen und Land gerechter zu verteilen, scheiterten größtenteils aufgrund des starren Zweiklassensystems. Die obere Schicht war nicht bereit, ihren Teil beizutragen. Ein Beispiel ist Peru, wo die Erwartungen an das ANTA-Projekt hoch waren, aber die Genossenschaften die Bedürfnisse der Bevölkerung vernachlässigten.
Wie wurde die Leistung autoritärer und demokratischer Regierungen verglichen?
Der Leistungsvergleich basierte auf wirtschaftlichen und sozialen Daten von 1960 bis 1985. Länder mit dauerhafter Demokratie (Kolumbien, Costa Rica, Venezuela) wurden mit Staaten mit diktatorischer Herrschaft (Argentinien, Brasilien, Mexiko, Chile) verglichen. Dabei wurden Bruttoinlandsprodukt, Pro-Kopf-Einkommen, Inflation, Schulden, Bildungsstand, Analphabetentum, Kindersterblichkeit und Lebenserwartung analysiert.
Zu welchen Schlussfolgerungen kam der Leistungsvergleich?
Es scheint nicht möglich, ein System anhand der Daten zu bevorzugen. Sowohl demokratische als auch autoritär geführte Länder waren in der Lage, wirtschaftliches Wachstum zu erzielen. Demokratische Systeme legten mehr Gewicht auf eine Vielzahl von Zielen statt nur auf Wachstum. Die Länder wurden anfällig für eine hohe Auslandsverschuldung.
Welche Gefahren einer zyklischen Entwicklung werden diskutiert?
Diskutiert wird die Gefahr einer zyklisch orientierten Entwicklung, angesichts der historischen Wechsel zwischen autoritären und demokratischen Regimen in Lateinamerika. Faktoren, die für eine gewisse Standhaftigkeit der neuen Herrscher sprechen, sind eine zielstrebigere Ablösung durch zivile Exekutiven, der stärkere Einfluss internationaler Organisationen, das Eindringen demokratischer Wertvorstellungen in die militärische Führung und die Entstehung bürgerlicher Schichten.
Welche langfristigen Perspektiven und politischen Verhaltenstraditionen werden analysiert?
Langfristig könnten die politischen Verhaltenstraditionen der Lateinamerikaner ein Problem darstellen. Unterschiede zwischen lateinamerikanischer Demokratievorstellung und westeuropäischen/nordamerikanischen Modellen werden untersucht, wobei Einflüsse spanischer Eroberer und kolonialer Sozialstrukturen berücksichtigt werden. Dazu gehören eine Tendenz zu autoritärer Führung, Hierarchiedenken, Elitenbildung und ein Obhutsverhältnis zwischen Reich und Arm.
Welche weiteren Faktoren könnten eine Demokratisierung behindern?
Das wirtschaftliche und politische Interesse verschiedener Gruppen und Einzelpersonen, abhängige Arbeitsverhältnisse, ungleiche soziale Bedingungen, autoritäre Herrschaft in Gebieten mit Sklavenarbeit und der Glaube an die persönliche Beeinflussbarkeit von Regierungsentscheidungen.
Wie wird die Mobilisierung der Massen beschrieben?
Die Unterstützung des Volkes ist für eine Revolution entscheidend. Einkommen, soziale Bedingungen und Naturkatastrophen spielten eine Rolle beim Erstarken der Reformbewegungen. Selbsthilfeorganisationen entwickelten sich zu Organisationen, die zu Protesten und Streiks bereit waren. Das Beispiel Guatemalas wird zur Verdeutlichung herangezogen.
Was waren die Folgerungen aus dem Beispiel Guatemalas?
Durch den Druck der Regierung entstand eine aktive Opposition, die maßgeblich zum Ende der Militärdiktatur beitrug. Die Opposition entstand aus Arbeiterschichten, die nicht vom Wirtschaftsboom profitierten. Gewaltexzesse der Regierung führten zur Bildung einer Opposition. Die Reaktion der Regierung auf diese Opposition entschied, ob ein gewaltsamer Umsturz stattfand.
Wie wird die Stabilität der politischen Partizipation bewertet?
Trotz Repressalien waren die Militärherrscher nicht in der Lage, sämtliche Parteistrukturen aus dem demokratischen Perioden zu eliminieren. Umfrageergebnisse in südamerikanischen Ländern weisen auf eine breite Unterstützung der Demokratie hin. Allerdings können diese Stimmungen sehr wechselhaft sein. Die Wahlbeteiligung nahm nach anfänglichen Erfolgen ab.
Welche Rolle spielt die Opposition beim Übergang von autoritären Regimen zu Demokratien?
Eine aktive, demokratisch orientierte Opposition spielt eine wichtige Rolle beim Übergang von einem autoritären Regime zu einer vom Volk gestützten Herrschaftsform. Wichtige Interessensgruppen sind der harte Kern der Anhänger der Diktatur, der Machtapparat der Regierung, passive Unterstützer, passive Gegner und aktive Gegner des Regimes.
Welche Aufgaben und Funktionen hat die Opposition?
Die Opposition sollte sich nicht in den Apparat einbinden lassen, sondern unabhängig bleiben und die Schwierigkeiten der Regierung vergrößern. Sie muss eine sinnvolle Alternative bilden und eigene Vorschläge ausarbeiten, um dem Volk den Sinn eines Machtwechsels zu verdeutlichen. Wichtig ist auch, dass sich die verschiedenen Oppositionsgruppen über prozedurale Fragen einigen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Nach mehreren Jahrzehnten zwischen Demokratie und Diktatur scheint Südamerika im Moment wieder eine etwas ruhigere Phase zu durchlaufen. Dennoch ist es leichtsinnig, den Zustand für stabilisiert zu halten. Die wirtschaftliche Entwicklung wird eine wichtige Rolle bei der weiteren Entwicklung Südamerikas einnehmen.
- Quote paper
- Schwinning Alexander (Author), 1997, Demokratisierung in Südamerika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103462