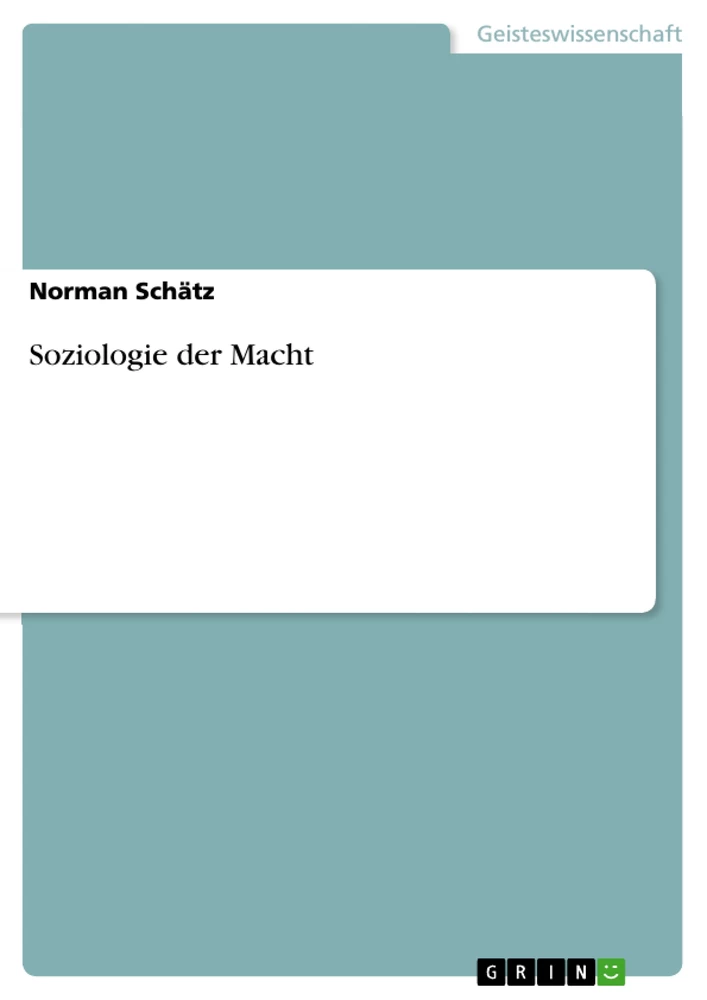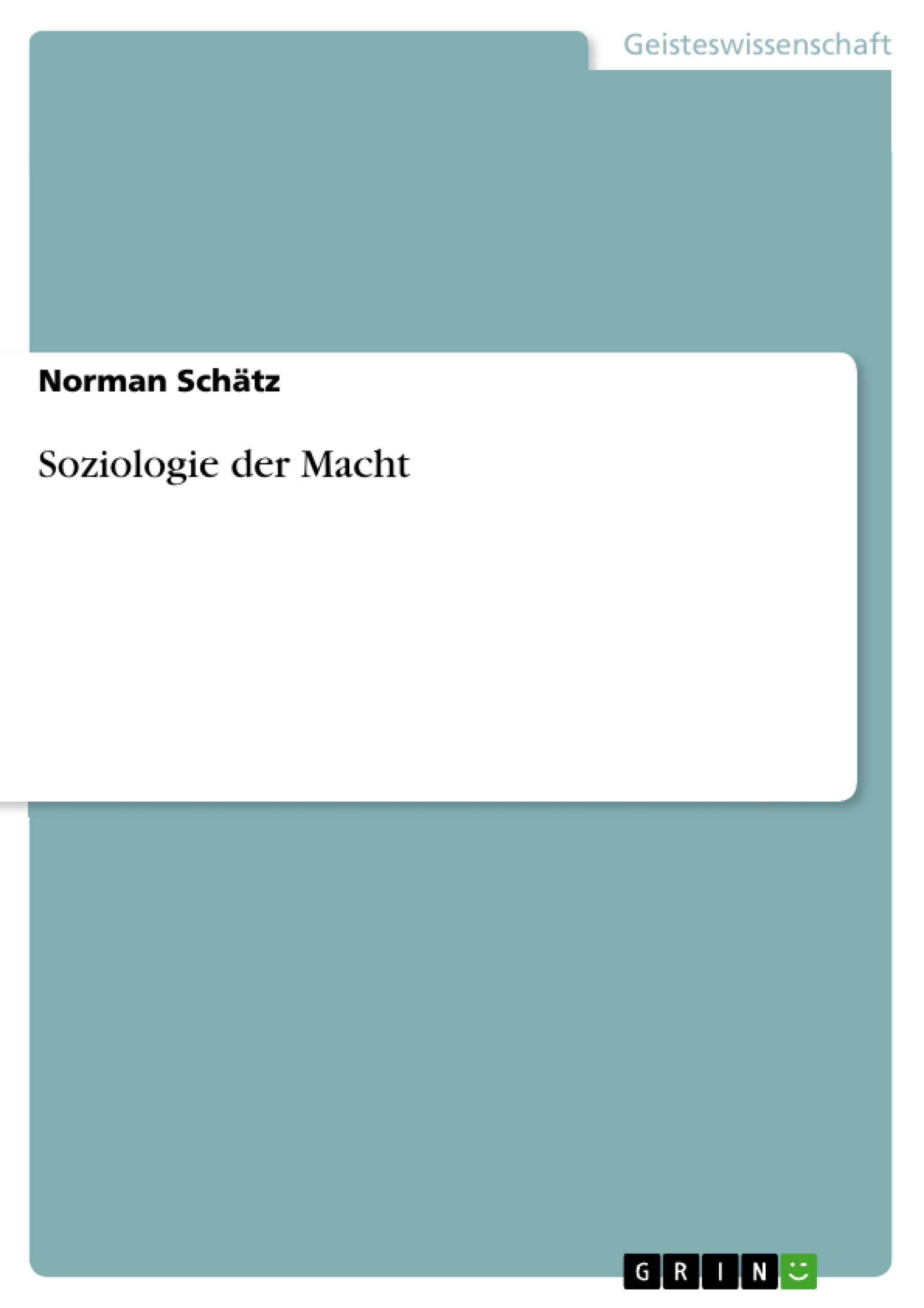Was ist Macht wirklich, und wie beeinflusst sie unser Leben, unsere Beziehungen und die Gesellschaft als Ganzes? Tauchen Sie ein in eine tiefgründige Analyse der vielschichtigen Natur der Macht, die weit über bloße politische oder wirtschaftliche Kontrolle hinausgeht. Diese fesselnde Untersuchung enthüllt die subtilen, oft unbemerkten Mechanismen, durch die Macht ausgeübt wird – von den alltäglichen Interaktionen bis hin zu den großen historischen Ereignissen. Entdecken Sie, wie Machtbeziehungen unser Denken, Fühlen und Handeln prägen und wie sie sich in Begriffen wie Einfluss, Autorität, Herrschaft und Gewalt manifestieren. Verstehen Sie die feinen Unterschiede zwischen Macht im weiteren und im engeren Sinne, und wie diese Unterscheidungen unser Verständnis von sozialer Dynamik verändern. Untersuchen Sie die sieben grundlegenden Merkmale von Macht, die ihre Grenzen, ihre Beziehung zur Kraft und ihre inhärente Amoralität beleuchten. Lernen Sie, wie Macht sich in persönlichen Beziehungen, Organisationen und im gesamtgesellschaftlichen Kontext manifestiert und wie sie durch Normen, Gesetze und soziale Erwartungen geformt wird. Ergründen Sie die tieferen Ursachen von Konflikten und Kämpfen um Macht, von den einfachen Interessenkonflikten bis hin zu den komplexen Kämpfen um Anerkennung, Werte und Identität. Analysieren Sie die Rolle von Waffen, Informationen, Drohungen und Versklavung als indirekte Mittel der Machtausübung und wie diese Instrumente die Machtverhältnisse zwischen Individuen und Gruppen verschieben können. Diese aufschlussreiche Analyse fordert Sie heraus, Ihre eigenen Vorstellungen von Macht zu hinterfragen und ein tieferes Verständnis für die Kräfte zu entwickeln, die unsere Welt formen. Erfahren Sie, wie Sie Macht erkennen, verstehen und möglicherweise sogar beeinflussen können, um eine gerechtere und ausgewogenere Gesellschaft zu schaffen. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie oder einfach nur für die menschliche Natur interessieren und die komplexen Dynamiken der Macht in unserer Welt verstehen möchten. Lassen Sie sich von dieser intellektuellen Reise inspirieren, Ihre eigene Rolle im Spiel der Macht zu erkennen und aktiv zu gestalten. Die Definition von Macht nach Max Weber wird kritisch beleuchtet und weiterentwickelt, um ein umfassenderes Verständnis zu ermöglichen.
Macht und ihre begrifflichen Grundlagen
(Vittorio HÖSLE)
1) Einleitung
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde außerordentlich viel Aufwand für die Klärung des Begriffs „Macht“ betrieben.
So hat es nicht lange gedauert, dass die Ausweitung des Begriffs Macht in den letzten Jahrzehnten eine überdimensionale Größe angenommen hat, man kann dabei ohne Übertreibung schon von beängstigenden Ausmaßen sprechen. Nicht nur erscheint danach so vieles und so Heterogenes als Macht, dass nicht leicht zu glauben ist, es gäbe einen kleinsten gemeinsamen Nenner all dieser Phänomene.
Diese Ausweitung erreicht schon Formen, dass auch unser Erkennen, auch unsere moralischen Vorstellungen als Formen von Macht verstanden wird. Die modernen Sozialwissenschaften verbinden so mit dem Begriff Macht gerne etwas Ideologisches.
Man sieht, der Begriff „Macht“ ist ein so komplexer Terminus, sodass sich Schwierigkeiten auftun, ihn klar definieren zu können und „Macht“ von anderen ähnlichen Begriffen abgrenzen zu können.
Wenn man sich dem Definitionsbereich Macht nähern will, stellt sich unumgänglich zuerst einmal die Frage: „Was ist eigentlich Macht?“.
In allen Sozialwissenschaften, aber besonders in den Politikwissenschaften wird Macht verschieden definiert.
Unter anderem kann eine Kausalität darin gefunden werden, dass der entsprechende Begriff zu einer Begriffsfamilie gehört, in der auch Begriffe wie: Einfluss, Autorität, Herrschaft und Gewalt zu finden sind, deren Verhältnis zueinander trotz zahlreicher Versuche nicht so präzise bestimmt worden ist, sodass sich ein einheitlicher Sprachgebrauch hätte durchsetzen können.
Es kommt dabei jedoch nicht so sehr darauf an, eine einheitliche Terminologie für diesen jeweiligen Begriff zu finden, sondern viel mehr darum, eine Differenzierung zwischen Macht im weiteren und Macht im engeren Sinne festzulegen, und was damit gemeint ist, als dass man durch Neologismen
(Zitat: HÖSLE, 1997; Seite 394) ein starres terminologisches Gerüst schafft.
Es gilt, sich einen Überblick über die Begriffsfamilie zu verschaffen, wobei der Begriff „Macht“ den Mittelpunkt dieser Gruppe darstellt und im jeweiligen Verhältnis zu den anderen Begriffen gemessen wird.
2.) Erläuterungen zum Begriff: „ Macht “ nach H Ö SLE
Um sich dem Begriff Macht nähern zu können, erscheint es zunächst als sehr ratsam, einige Merkmale des entsprechenden Prädikats zu nennen.
HÖSLE nennt dafür 7 grobe Merkmale, die eine Annäherung zum eigentlichen Begriff „Macht“ ermöglichen sollen:
„Macht“ ist erstens kein einstelliges, sondern immer zumindest ein zweistelliges Prädikat.
Niemand hat Macht schlechthin, sondern immer nur Macht über etwas oder über eine Person bzw. Personen.
Somit zeigt sich, dass Macht nur als begrenzt gesehen werden kann, weil die Existenz von Macht immer von einem anderen Faktor abhängig ist.
Jedoch gilt es bei dieser Definitionsbedingung zu beachten, Macht nicht mit Machtmitteln zu verwechseln, denn ob jemand Machtmittel hat, hängt nur von ihm ab, nicht hingegen, ob er Macht hat.
Machtmittel können diese Bedingung der Abhängigkeit nicht aufheben, da sie ja nur, wie es der Name schon sagt, Mittel für die Machtausübung darstellen, und auch nur auf etwas anderes oder anderen angewendet werden können. Bei Besitz von Machtmitteln kann folglich noch nicht von Macht selbst gesprochen werden; zu ihr gehört stets der grundsätzliche Wille zur Machtausübung, ohne den nicht einmal von einer Disposition die Rede sein kann.
Sofern die anderen nicht in Kenntnis sind, dass jemand die Machtmittel, über die er verfügt, nicht einsetzen will, weil ihm das Verhalten der anderen gleichgültig ist, mag er wohl eine soziale Wirkung ausüben, jedoch kann dabei nicht von einem direkten Einfluss oder sogar voreilig gezogen von Macht gesprochen werden.
Weiters wird „Macht“ generell als
Dispositionsprädikat
(Zitat: HÖSLE, 1997; S. 395) verstanden und von der konkreten Machtausübung unterschieden.Die Tragweite von Macht ist von der jeweiligen „Aktualitätsdauer“ abhängig, das heißt, wenn jemand nur einmal in den Genuss einer Machtausübung gekommen ist, bedeutet dies noch lange nicht, dass diese Person wirklich „mächtig“ ist. Gerade die Erwartung, dass diese Person auch in Zukunft bzw. für längere Dauer die Fähigkeit der Machtausübung hat, macht ihm „mächtig“.
Der Machtbegriff kann in einem gewissen Verwandtschaftsbereich von
Kraftbegriff gesehen werden, insofern Macht für Veränderungen steht bzw. für das Ausbleiben von Veränderungen in der Wirklichkeit verantwortlich gemacht werden kann, die ohne dem Einfluss von Macht nicht einträten bzw. ohne sie einträten.
Selbstverständlich differenziert sich hier Macht von Kraft dadurch, dass ihre Wirkung gewollt sein muss.
Der Machtbegriff impliziert in der Regel einen internationalen, näher „volitiven“ Akt seitens des Machthabers, der zumindest einen unbewussten Wunsch darstellen muss.
Die Machtausübung muss vom Träger gewollt sein und die Tätigung gezielt angewendet werden.
So können die Überträger der Pest im 14. Jahrhundert nach Westeuropa nicht als Machtträger bezeichnet werden, auch wenn sie unheimlich großen Schaden angerichtet haben, da dies schlussendlich nicht gewollt war.
Hier zeigt sich hier gleich die Nähe des Machtbegriffes zum Handlungsbegriff. So kann nur von einem handlungsfähigen Wesen Macht prädiziert werden, und handlungsfähig im umfassenden Sinne ist nur der Mächtige, der seinen Willen in eine Veränderung der Wirklichkeit umzusetzen weiß.
Für eine Machtausübung ist eine Handlung Voraussetzung, jedoch nicht umgekehrt und natürlich hat der Machtbegriff nicht mit allen möglichen Veränderungen zu tun.
Ein interessanter und stets labiler Grenzfall von Macht zeigt sich dann, wenn jemand eine Veränderung, in seinem Sinne, zwar durchsetzen will und dies auch könnte, weil er über die dementsprechenden Machtmitteln verfügt, jedoch nicht von sich aus weiß, dass er das kann, und es deswegen eben letztlich doch von der gewünschten Veränderung Abstand lässt.
Generell ist der Begriff „Macht“ auf Prozesse innerhalb der sozialen Welt beschränkt.
Dieser Umstand gilt jedoch keineswegs für alle bekannten Definitionen von „Macht“. So laufen in der deutschen Umgangssprache die Begriffe „Macht“ und „Herrschaft“ in einem identen Vorstellungsbereich und der Begriff „Herrschaft“ muss sich dabei nicht immer auf etwas Soziales beziehen. So wird oft der Ausdruck: „Herrschaft über die Natur“ verwendet, doch hört man in der deutschen Umgangssprache kaum: „Macht über die Natur“.
Es zeigen sich so Überschneidungen der beiden Begriffe, die es bei der eigentlichen Definition von „Macht“ zu berücksichtigen gilt.
Das Machtverhältnis gilt als asymmetrisch. Auch wenn eine Machtbeziehung für den Mächtigeren empfindliche Einschränkungen bedeuten können (z.B: damit verbundene Kosten, ), ändert dies nichts an der Tatsache, dass im Normalfall zwischen Machthaber und Unterworfenen asymmetrisch differenziert werden muss.
Als letztes Begriffsmerkmal für „Macht“ erwähnt HÖSLE die Amoralität des Machtbegriffs. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Inhalt des Willens des Machthabers als moralisch erscheint oder nicht, selbst wenn die Ausübung als wohlverstandenes Interesse gesehen werden kann.
Wenn das Aufzwingen eines eigenes Willens am Schluss auch seine Selbstzerstörung bedeuten würde, so spricht man noch immer von Macht. Verfolgt man nun die sieben erwähnten Merkmale HÖSLE`S von Macht gedanklich weiter, so ergeben sich weitere Ansatzpunkte, die als Definitionsbedingung gesehen werden sollten, um sich einen strukturierenden Überblick verschaffen zu können.
So gehören im Normalfall einer Machtbeziehung auf beiden Seiten bestimmte Intentionen an, wie: Der Machtunterworfene muss ebenso Wissen über die Machtmitteln des Machthabers besitzen wie dieser.
Es geht hier noch weiter, denn gewisse Machtformen beruhen im wesentlichen darauf, dass der Machtunterworfene an die Macht des Machtinhabers glaubt und sie als Drohung gegenüber seiner Person sieht.
Natürlich ist jener Glaube nie grundlos, denn vorausgegangen sind ihm (vielleicht fehlerhafte) Abschätzungen bzw. Kalkulierungen der Machtmittel des anderen und oft auch konkrete Kämpfe, in denen der Machthaber gezeigt hat, dass er den Willen der anderen zu brechen vermag und seinen ihnen aufzwingen kann. Stabile Macht konstituiert sich häufig erst als Ergebnis derartiger Kämpfe, zu ihr gehört ein beiderseitig akzeptiertes Bild von der bilateralen Machtsituation, das die endgültige Machtverteilung ebenso bestimmt, wie es selbst in Annahmen über die Machtverteilung besteht.
Denn Macht ist nie nur eine Funktion von Machtmitteln, sondern ebenso sehr der beiderseitigen Einschätzung der Machtmittel (und da die Einschätzung selbst ein Machtmittel höherer Stufe darstellt, der Einschätzung der Einschätzung des anderen, ).
Widerstrebende Willen, Machtmittel, deren Vorzeigen und Einschätzen, reale Auseinandersetzungen, schließlich aufgrund dieser Verarbeitung ein den Erwartungen des anderen entsprechendes Verhalten sind die entscheidenden Schritte bei der Konstituierung von Macht.
3) Webers Definition von „ Macht “
Wird der Versuch unternommen, die Begriffsmomente HÖSLE`S zusammenzufassen, so könnte man resultierend in gewisser Form auf die „Macht“
- Definition von M. Weber schließen.
„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“
Jedoch zeigen sich bei dieser Definition zwei problematische Punkte.
Erstens erfasst das, gleichviel worauf diese Chance beruht, äußerst unterschiedliche Formen der Durchsetzung des eigenen Willens.
Es erscheint doch als sehr geringe Tragweite von potentieller Macht, wenn der Versuch auf Machtausübung auf einer geringen Chancenmöglichkeit basiert. Macht kann als solches nur dann so bezeichnet werden, wenn der vermeintliche Unterworfene eine Ausübung gegenüber seiner Person für potentiell möglich hält. Daher haben andere Sozialwissenschaftler den Machtbegriff enger gefasst und das, was bei Weber „Macht“ heißt, als „Einfluss“ und als „Macht“ nur eine besondere Form von Einfluss bezeichnet. Differenzierung von Macht im weiteren und im engeren Sinn.
Einfluss braucht weniger Voraussetzungen als Macht und hat somit auch mehr potentielle Chancen. Einfluss muss, im Gegensatz zur Machtausübung, unter anderem nicht immer gewollt sein.
Zweiter Einwand für HÖSLE gegen die Machtdefinition Webers stellt die Wendung „auch gegen Widerstreben“ dar.
Es ist für ihn hier nicht vollständig geklärt, ob Weber damit meint, dass Widerstreben ein notwendiges Definiens von Macht ist. Das scheint auch gegen diese Interpretation zu sprechen.
Jedenfalls sind Situationen denkbar, in denen ein Widerstreben gar nicht aufkommt, weil die jeweilige Position des Machtinhabers vollständig unangefochten ist. Macht kann hier dann gerade besonders weitgehend und subtil sein, wenn der Machtunterworfene keinen autonomen Willen mehr hat.
Als Beispiel kann das Verhalten in Sekten erwähnt werden, in denen sich Mitglieder all zu oft dem freien Willen des Anführers, ohne jeglichen Widerstand, hingeben.
Andererseits besteht auch die Möglichkeit, dass etwa zwei Menschen vollständige identische Werte und Ansichten besitzen.
Dann wird es in ihren Interaktionen nur schwerlich zu Konflikten kommen, und sie werden daher in diesen jeweils ihren Willen durchzusetzen wissen, ohne dass ein Widerstreben aufkommt. Schwerlich wird man hier ihre Beziehung als „Machtbeziehung“ bezeichnen können, dazu fehlt die Bedingung der Asymmetrie.
Für mich erscheint dieser vermeintliche Definitionsabschnitt als doch sehr eindeutig, denn ich verbinde mit: „auch gegen Widerstreben“ die Vorstellung, dass die erfolgreiche Ausübung von Macht das Widerstreben von Unterworfenen nicht einschließt.
Das Verhältnis von Anführer und Sektenmitgliedern in „radikalen Sekten“ zeigt sich hier als sehr gutes Beispiel, denn der Sektenführer ist im Besitz von „totalitärer Macht“ gegenüber den unterworfenen Mitgliedern, auch wenn sie sich mit keinem noch so kleinen Ansatz von Widerstand ihm hingeben.
Zusammenfassend kann die Definition Weber´s nach HÖSLE folgendermaßen abgewandelt werden:
„Einfluss (Macht im weiteren Sinne) ist jede Chance einer Person oder eines Verbandes - des Einflußhabers -, den eigenen Willen gegen das Widerstreben einer anderen Person oder eines anderen Verbandes - des Einflussunterworfenen - durchzusetzen oder zu verhindern, dass der Einflussunterworfene widerstrebt“
Wobei das Widerstreben einer anderen Person nicht als Voraussetzung gesehen werden muss, denn sowohl Einfluss (Macht im weiteren Sinne) als auch Macht selbst (Macht im engeren Sinne) kann von anderem, frei von Widerstreben, akzeptiert werden. Der andere muss den Einfluss bzw. Macht gegenüber seiner Person nicht einmal wahrnehmen.
4) Definition von Macht nach sozialen Beziehungen
Max Weber definiert Macht also als eine Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung seinen eigenen persönlichen Willen gegenüber anderen Mitmenschen, auch bei deren Widerstreben, durchzusetzen.
Wie der Begriff „soziale Beziehung“ sehr weitläufig ist, so ist auch der Definitionsbereich von „Macht“ sehr groß, daher sollte und muss eine Differenzierung des Begriffs „ Macht “ nach der jeweiligen „ sozialen Beziehung “ vollzogen werden. Dementsprechend kann zwischen „persönlicher Macht“, „organisatorischer Macht“ und „Macht im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang“ unterschieden werden, da sie jeweils unterschiedliche Formen von Macht darstellen.
Persönliche Macht
Persönliche Macht stellt die Ausübung von Herrschaft in einem (sehr) persönlichen Bereich dar. Der Machtausübende versucht einem Mitmenschen seinen Willen aufzudrängen, obwohl der Grund dieser Machtdemonstration, wie es bereits V. HÖSLE erwähnt hat, gar kein objektiv rationeller sein muss.
Diese Gründe können sehr vielfältig sein und dennoch stehen viele von ihnen in unmittelbarer Verbindung mit dem inneren Bewusstsein des Machtinhabers. So kann er durch die Machtausübung auf einen Mitmenschen sein Selbstwertgefühl anheben, oder dadurch Anerkennung finden, die er ansonsten vermisst, oder einfach nur daran Gefallen finden, durch Machtdemonstration, sich über einen Mitmenschen stellen zu können.
Bei dieser Form spielen, so denke ich, viele psychologische Faktoren mit, die bei der Frage nach dem Grund dieser Machtausübung berücksichtigt werden müssen. Nicht umsonst spielt in der Sozial-(Psychologie) der Begriff Macht und Herrschaft eine sehr wichtige Rolle, denn Akteur jedes sozialen Phänomens ist immer noch der Mensch selber.
Die Machtausübung spielt sich bei der „persönlichen Macht“ meistens auf engsten sozialen Raum ab, meistens nur zwischen Machtausübenden und Unterworfenen, wobei die Gründe dafür, wie bereits erwähnt, nicht immer rationeller Natur sein müssen. Es kann aber auch passieren, dass sich der Geltungsdrang nach persönlicher Macht mit der Zeit nicht mehr auf engsten sozialen Raum beschränken will, sondern sich vergrößern will, bis auf ganze Gesellschaften.
Organisatorische Macht
Von der „persönlichen Macht“ zu unterscheiden ist die organisatorische Macht, da sie sich bei den Gründen der Machtausübung unterscheidet.
Bei der organisatorischen Macht spielt der „persönliche Bereich“ keine so große Rolle, hier ist der Grund nach der Machtdemonstration im funktionierenden Tätigkeitsablauf innerhalb einer bestimmen sozialen Gruppe zu finden. Typsicher Fall dafür wären Arbeitsbetrieben, in denen eine Gruppe Arbeitnehmer mittels Machtausübung von ein paar wenigen „Verantwortlichen“ koordiniert werden.
Hier gilt es eine strategische Festlegung von Handlungsabläufen mittels den „Verantwortlichen“ durchzuführen und einzuhalten.
Der Grund dieser Durchführung ist (bzw. sollt e) hier nicht die Befriedigung von möglichen persönlichen Geltungsbedürfnissen sein, sondern wie bereits erwähnt, die Aufrechterhaltung eines bestimmten funktionalen Ablaufes, der jedem in dieser sozialen Gruppe von Vorteil wäre.
Die Einhaltung des funktionierenden Ablaufes dient in den meisten Fällen einem gemeinsamen Ziel.
Macht erscheint hier im Zusammenhang von Sachlösungen, die sich systembegründet bzw. systemmodifizierend auswirken.
Macht im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang
Die letzte Differenzierung von Macht in bezug auf soziale Beziehung stellt die Macht im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang dar, deren Hauptinstrument die Setzung gesamtgesellschaftlicher Normen ist.
In bestimmter Weise kann ein Zusammenhang mit der „organisatorischen Macht“ gefunden werden, wobei hier aber doch Differenzierungen zwischen der Größe der sozialen Gruppe und dem Ziel der Machtausübung gesetzt werden müssen. Handelt es sich bei der „organisatorischen Macht“ um eine relativ bescheidene Anzahl von sozialen Einheiten, bezieht sich die „Macht im gesellschaftlichen Zusammenhang“ auf eine ganze Gesellschaft (Staatsbürger,...), wobei durch die Festlegung von Normen ein „funktionierendes Miteinander“ garantiert werden soll. Diese Normen stellen im Grunde Gesetze dar, die jeder Rechtsstaat aufstellt, die von den jeweiligen Bürgern eingehalten werden müssen um gesellschaftliche Stabilität und im Endeffekt das „Selbstüberleben“ schaffen zu können. Diese Normen regeln das soziale Handeln zwischen den Mitmenschen und gegenüber dem Staat, der hier als Normenschaffer Funktionsträger ist.
Wie man durch diese Aufteilung von Machtfunktionen erkennen kann, kann Macht je nach Größe der sozialen Gruppierung und Ziel der Ausübung unterschiedlich gesehen werden. Nicht immer entspricht sie rationeller Natur, aber in den meisten Fällen ist sie unabdingbar, weil Macht (bzw. Herrschaft) oft eine „Lebensgrundlage“ darstellt, wobei immer bedacht werden muss, dass der Träger von Macht und Machtmitteln ein Mitmensch ist, der dieser Aufgabe nicht immer gewachsen sein muss.
5) Weitere Grundlagen zum Begriff „ Macht “
Wie bereits erwähnt, konstituiert sich Macht in der Regel über Kämpfe. Jedoch stellt sich hier die Frage, nach dem warum?
Warum kämpfen Menschen überhaupt gegeneinander?; Welche Gründe gibt es dafür?; Welche Voraussetzungen müssen dafür bestehen?
Offenbar setzt der Begriff des Kampfes eine Pluralität von Willen voraus, die sich gegenüberstehen.
Die nicht den nämlichen Zustand wollen; den denselben Gegenstand können beide durchaus wollen, ohne dass dies friedensstiftend wirksam würde
Folglich stellt das Wollen desselben Gegenstandes eine notwenige Grundbedingung für einen Streit dar, denn nur Differenzen bei der Willensauslegung sind keine ausreichende Voraussetzung für einen Kampf. gewollte einander ausschließende Zustände.
Bei Vorstellungsdifferenzen zwischen zwei Personen, oder mehreren, muss berücksichtigt werden, dass das Wollen des Menschen keineswegs nur äußeren Zwecken wie der Befriedigung von Bedürfnissen dienen kann. Die formale Struktur des Wollens hat vielmehr in sich selbst ihre eigene Würde, auch unabhängig von den Inhalten des Wollens.
Dass die äußere Wirklichkeit sich nach den Vorstellungen des Menschen umzuwandeln hat, ist Ausdruck seiner Hoheit über die Natur und definiert die Würde gegenüber anderen und seiner Selbst.
Erfolge bei der Durchsetzung seines Willens werden von einem Wesen mit Selbstbewusstsein nicht nur wegen ihrer Konsequenzen, sondern auch als Selbstzweck genossen.
So erkennt der Mensch das Ausmaß seiner persönlichen Leistung und damit sein eigentliches Selbst, an der Größe der Widerstände, die er überwunden hat. Als Beispiel kann bei der Jagd die potentielle Gefährlichkeit des erlegten Tieres erwähnt werden.
So erfüllt die Erledigung eines großen gefährlichen Tieres durchaus mehr Selbstachtung, als es sich bei einem kleinen Hasen zeigen würde.
Gerade wegen der Würde des Menschen scheint es auch gerecht zu sein, dass er der Natur seinen Willen aufzwingen kann und die in der subjektiven Wahrnehmung bestätigt gerade der Erfolg das Recht:
Dass, wie in unserem Beispiel, der Jäger so klug und tapfer war, ein großes gefährliches Raubtier zu erlegen, belegt in concreto jene Überlegenheit, die vor dem Erfolg nur abstrakt unterstellt werden könnte.
Entscheidend dabei ist, dass sich selbst ein roher Gewaltmensch niemals auf das kurzsichtige Argument stützen würde, er habe recht, weil er sich habe durchsetzen können.
Er wird immer auf einige allgemeinere Merkmale verweisen, die dem konkreten eigenen Erfolg zugrunde liegen, wie eben Stärke, Mut, Intelligenz, Ausdauer, usw. Bloße Zufallserfolge, die einem selbst unerklärlich sind, heben das Selbstgefühl nicht und werden daher persönlich auch kaum akzeptiert.
Im Gegenteil, sie haben vielmehr etwas geradezu Demütigendes, weil sie nicht aus eigener Leistung entspringen, sondern eben nur dem Zufall.
Ob sich Menschen bei der Zusprechung eigener Leistungen bescheiden geben können, sei hier dahingestellt, doch auch wie bei vielen anderen menschlichen Eigenschaften, sollten hier notwendigerweise Differenzierungen in Betracht gezogen werden.
6) Kampf um Interessen, Anerkennung und Werte
Um sich dem Phänomen von Macht nähern zu können, muss nun der Fall untersucht werden, in dem jemand seinen Willen gegenüber einem anderen Mitmenschen durchsetzt.
Wie bereits erwähnt, bestehen wesentliche Unterschiede zwischen der bloßen Ausgrenzung von Willen und ihrer Verbindung zur Kooperation.
Angenommen ein Mensch, oder auch ein Tier, sieht einen bestimmten Gegenstand, an dem es ein Interesse gefunden hat und es folglich auch in den Besitz nehmen möchte, doch ein anderer hat genauso ein Gefallen an dem gleichen Gegenstand gefunden und stellt ebenso Besitzansprüche.
Ihre Wünsche bezüglich des Gegenstandes können nicht gleichzeitig erfüllt werden. Es stellt sich nun die Frage, was soll oder wird geschehen?
Es gibt nun drei Möglichkeiten, wie sich dieser Fall weiter entwickeln könnte:
- Wenn die Überlegenheit des einen so offensichtlich ist, wird der andere vielleicht gleich seinen Willen aufgeben, da er kaum Chancen sieht, erfolgreich einen Kampf zu führen;
- Wenn der Kampf für beide zu riskant erscheint, dann mag es zu einem Kompromiss kommen, der in der Regel gemeinsame Prinzipien voraussetzt.
- Als dritte Möglichkeit ergibt sich daraus, dass sich beide Aussichten auf einen Sieg machen und versuchen, den jeweiligen anderen vom Besitz des erstrebten Gegenstandes auszuschließen, um den eigenen Willen, in Form eines Kampfes, durchzusetzen.
Sehr bald wird diese Auseinandersetzung, die zunächst um entgegengesetzte Interessen stattfand, eine neue Qualität entwickeln, da mit der Entdeckung des Selbstzwecks der Interessenkonflikt eine neue Form bekommt. Denn der Wert eines Gegenstandes erhöht sich mit den Aufwendungen, die erforderlich sind, um ihn in seinen Besitz bringen zu können. Menschen sind dabei noch gefährlichere Gegner als Tiere, da der Sieg über einen Kontrahenten einen noch bedeutenderer Anlass darstellt, resultierend daraus, dass es das Selbstwertgefühl steigen lässt.
Ferner stellt die Hemmung des eigenen Willens durch einen anderen Menschen eine größere Herausforderung dar, als zum Beispiel seine Behinderung durch die wilde Natur, da ein möglicher Sieg einen besseren Vergleich zum Kontrahenten darstellt.
Denn die Natur selbst kann in meine Würde nicht einsehen, der andere Mitmensch jedoch kann und soll auch erfahren, dass mein Wille für ihn zu respektieren ist. Von einem Tier kann man nicht erwarten, dass es meinen Sieg und die damit gewonnene gesteigerte Würde demütig anerkennt, jedoch stellt die Respektierung meiner siegreichen Würde durch den unterlegenen Rivalen einen persönlichen Triumph dar.
Nicht bloß die zukünftigen Nachteile, die aus der Niederlage entspringen werden, sind bedrückend, die Niederlage selbst hat Auskunft gegeben, die zutiefst demütigend für den Verlierer ist.
Zumindest verfügt er nicht ausreichend über jene Fähigkeiten, auf die es noch stolz Anspruch erhoben hatte, indem es sich auf eine Auseinandersetzung einließ.
Was am Anfang ein Kampf um Interessen war, ist mit diesen Reflexionsschritten
(Zitat: HÖSLE, 1997; Seite 404) unter der Hand ein Kampf um persönliche Anerkennung geworden, in dem es um die Bestimmung der eigenen Fähigkeiten im Verhältnis zu denjenigen anderer geht.
Jedoch sollte sich der Mensch nichts vormachen, denn allzu oft verwandeln sich anfängliche Interessenskämpfe in Anerkennungskämpfe, weil der Hauptgrund der Auseinandersetzung nicht auf sachenbezogene Interessen basiert, sondern vielmehr ist es oft von Anfang ein Kampf um persönliche Anerkennung, in dem sachliche Prinzipien nur eine Nebenrolle darstellen, bzw. erst im nachhinein in den Mittelpunkt gerückt werden, um einen allgemein akzeptablen Grund angeben zu können.
Der Gegenstand, den man haben wollte, war einem in Wahrheit oft ziemlich gleichgültig, er war in Wirklichkeit nur Vorwand für diese höhere Auseinandersetzung, die durchaus Selbstzweckcharakter haben kann und in der Spiel und tödlicher Ernst je nach Umständen ineinander umschlagen können. Streitmittelpunkt stellt nicht der anfänglich gewollte Gegenstand dar, sondern das „persönliche Prinzip“.
Weiters ist anzuerkennen, dass ein Sieg über einen anderen Mitmenschen in der Regel nicht ein bloßes brutum faktum
(Zitat: HÖSLE, 1997; Seite 408) ist.
Er ist Ausdruck nicht nur physischer Stärke, sondern auch größerer Selbstdisziplin und der größeren Bereitschaft, sein eigenes Leben zu riskieren, also der Tugend der Tapferkeit, die (eigene) Achtung verdient.
In anderen Fällen mag erst der Konflikt mit anderen oft den inneren Konflikt widerstreitender Selbsteinschätzungen lösen.
Daneben gibt es auch noch strukturelle innere Konflikte, die stets Auseinandersetzungen mit anderen unvermeidlich machen.
Als gutes Beispiel für innere Konflikte, die soziale Auseinandersetzungen (meistens innerhalb der Familie) gerade heraufbeschwören, ist die Adoleszenzkrise, in der das Individuum in Machtkämpfen verwickelt wird, die zu den psychisch schmerzhaftesten gehören, weil sie sich gegen einen Teil des eigenen selbst richten, wie aus der Einheit mit der Familie.
Man erweist dem Heranwachsenden keinen Gefallen, wenn man in allem nachgibt und damit gerade das nicht gewährt, auf das es ihm in Wahrheit wirklich ankommt: Die Messung der eigenen Kräfte an dem schon Erwachsenen (Eltern).
Doch muss nicht immer ein Sieg in einer Auseinandersetzung automatisch eine Niederlage für den Geschlagenen darstellen, denn immerhin kann, wie bei großer Ausgangsungleichheit, für den Schwächeren auch schon die Niederlage einen zumindest partiellen Triumph bedeuten, weil der Sieg dem Sieger doch Arbeit gekostet hat und weil der Sieger den Unterlegenen wenigstens zur Kenntnis genommen hat.
Andererseits kann auch wiederum ein Ignorieren des Kontrahenten schmerzlicher sein, als Bekämpfen und Hassen, da das letztere dem Herausforderer immerhin soziale Wirkung sichert, also eine Erweiterung seines Seins dadurch, dass der andere an ihn denkt. Unendlich härter ist es deshalb, wenn man dem anderen nicht einmal zeigt, dass man an ihn als Mitmenschen akzeptiert - weil man wirklich nicht an ihn denkt
Denn mit dem Ignorieren wird der Kontrahent in seiner Würde verletzt, weil er als Gegner nicht einmal ernst genommen wird und so in seiner Achtung verletzt werden kann, ohne dass es vorher zu einen Kampf gekommen ist.
Allerdings versteht man unter Ignorieren oft eine bewusste Entscheidung, den anderen nicht zur Kenntnis zu nehmen, dem jedoch eine noch so bescheidene soziale Wirkung nicht abgesprochen werden kann, da er zumindest als Person vom Kontrahenten wahrgenommen wird, auch wenn in sehr bescheidenem Maße.
Jedenfalls ist die Grundlage vieler Anerkennungskämpfe nicht das „cartesische cogito, ergo sum
, sondern gleichsam ein cogita me, und fiam
“ (Zitat: HÖSLE, 1997; Seite 405).
Zumal wenn derjenige, von dem man bedacht sein will, sei es wegen seines Alters, oder wegen seiner überragenden Fähigkeiten, als vielleicht außerordentlich überlegen empfunden wird, kann das noch so flüchtige Eindringen in seiner Aufmerksamkeitssphäre dennoch außerordentlich bedeutsam für die Stabilisierung der eigenen Identität sein.
Aber Kämpfe finden nicht nur im Sinne von Interessen und Anerkennung statt, um die Durchsetzung des eigenen Willens und um die Ausdehnung des eigenen Seins durch die Aufnahme in das Bewusstsein des anderen statt. Es war zunächst davon die Rede, dass es für jemanden unerträglich wäre, wenn ein anderer seinen Willen nicht berücksichtigen wollte, dessen Würde er, gerade als Vernunftwesen, jedoch kennen müsste.
Aber der Mensch wäre nicht Mensch, wenn er nicht dieser Reflexion noch eine weitere hinzufügen könnte, nämlich dass der andere, gerade weil er selbst ein Vernunftwesen ist, genauso gut von einem selbst erwarten müsste, dass man seinen Willen achte.
Der Kampf, der am Anfang als Mittel begann, um sich einer Sache zu bemächtigen, ist schließendlich als Kampf um wechselseitige Anerkennung zum Selbstzweck geworden, weil er die Identitäten der Kämpfenden durch größere Bekanntschaft mit sich selbst vertieft und durch das Sein - für - einander erweitert.
In fast jedem Kampf zwischen Menschen spielen neben den unterschiedlichen kontrahierenden Interessen und der wechselseitigen Anerkennung auch unterschiedliche Werte eine wichtige Rolle, berufend auf unterschiedliche Legitimation der verschiedenen Interessen.
Zumindest wird man es öffentlich so begründen, als ob es einem nur um die Prinzipien, nicht um partikulare Interessen oder um das eigene Selbstbewusstsein gehe.
Im Kampf geht es nicht nur um einen äußeren Gegenstand oder um die Anerkennung der eigenen Personen durch den anderen, es geht mir um die Anerkennung eines moralischen Prinzips, das über den gegenwärtigen Streitfall weit hinaustreibt.
Moralische Prinzipien sind allgemeingültig, folglich binden sie beide Beteiligten für eine Auseinandersetzung, da moralische Prinzipien für jedermann einzuhalten sind und als soziale Gesetze definiert werden können.
Resultierend sollen sie auch von möglichst vielen Mitgliedern der Gesellschaft befolgt werden und so kann mir dieses Sollen auch gestatten oder geradezu gebieterisch auferlegen, den Willen des anderen zu brechen, der diesem Sollen nicht entspricht und mein Wertempfinden ihm geradezu gewaltsam aufzwingen.
Auch in denjenigen Fällen, in denen man es selbst ist, der die Normen der sozial anerkannten Sittlichkeit verletzt hat, wird es schwer fallen, diese auch nur vor sich selbst zuzugeben, da es auch ein Aufgeben von sich selbst darstellt.
Kämpfe um Werte können daher wesentlich erbitterter und schmerzhafter sein als solche um Interessen.
Die Werte, von denen die Rede ist, müssen jedoch keineswegs immer die moralisch richtigen sein.
Aber selbst ein Fanatiker wie Lenin ist streng von den Geltungsproblematikern zu unterscheiden. Zu Lenins Lastern gehörte brutale Ungerechtigkeit, nicht Selbstbespiegelung.
Umgekehrt kann ein eitler oder interessierter Mensch sich durchaus für die richtige Sache einsetzen, nur eben aus anderen Motiven als dem, dass es sich um die richtige Sache handelt.
So sehr sich Moralvorstellungen dem Machtgleichgewicht verdanken, das sich aufgrund von Kämpfen durchsetzt, sosehr sind, wie eben geschildert, diese Kämpfe unter anderem durch Moralvorstellungen verstärkt motiviert, eine Spirale von Macht und Moral, die Geschichte konstituiert.
Empirisch, und das Gesagte impliziert es auch, ist es außerordentlich schwierig zu definieren, um welchen Typ von Kampf es sich nun im Einzelfall handelt, zumal meist alle drei Ebenen, allerdings in unterschiedlichem Grade, vorhanden sind und auch oft miteinander verschmelzen.
Als denkendes Lebewesen muss der Mensch seine Interessen zu allgemeinen Prinzipien in Beziehung setzen.
Umgekehrt folgt aus allgemeinen Prinzipien, dass bestimmte subjektive Prinzipien und Interessen legitim sind, und folglich bestimmte Gegenstände dem und dem eben gebühren.
Insofern sind Interessen und Werte unvermeidlicherweise vermischt.
Analog wird derjenige, der sich für ein moralisches Prinzip einsetzt, seine Identität aus ihm beziehen.
Diejenigen, die das Prinzip in Frage stellen, können mittelbar auch die Stabilität ihrer Persönlichkeit verletzen.
Umgekehrt kann kein Mensch erwarten, ernst genommen zu werden, wenn er nicht an etwas Allgemeineres appelliert, das freilich gerade mit seiner Persönlichkeit in besonderer Verbindung steht:
Dennoch ist trotz aller aufgezählten Schwierigkeiten festzuhalten, dass die drei Idealtypen des Interessenvertreters, des Geltungsproblematikers und des von Werten Beseelten im Prinzip unterscheidbar sind.
Im Laufe eines längeren Kampfes stellt sich gewöhnlich heraus, wer welchem Typus am ehesten zugehört, abhängig von persönlichen Eigenschaften, wie Eitelkeit, Selbstbewusstsein, Einschätzung, sozialem Gefüge, etc., und zwar an den realen Opfern, die er selber zu bringen gewillt ist.
Eigene Interessen, selbst das eigene Leben mag durchaus aus der Geltungsproblematiker opfern, vielleicht er sogar eher als der von Werten Beseelte, der weiß, dass er weiterleben muss, um seine Sache durchzusetzen. Aber wenn jemand Missverständnisse und Missachtung durch die anderen souverän in Kauf nimmt, muss er der dritten Gruppe angehören; und zu dieser lassen sich die Fanatiker zählen.
Dass Kämpfe auch zum Tod führen können, nimmt man in Kauf, denn es ist diese Tugend, die den Kämpfen zugrunde liegt, aus denen die Vorstellungen von Gerechtigkeit erwachsen sind.
Über den Kampf begründet wird schon gesehen, wie sehr das Todesbewusstsein zum Selbstbewusstsein beitragen kann.
Der Mensch selbst beweist, dass er mehr ist als ein vitales Lebewesen, indem er die Angst vor dem Tode überwindet und sein Leben aufs Spiel setzt. Einem anderen aber wird auf deutlichste Weise sein Selbstbewusstsein gezeigt, indem es seinen Mut in der Interaktion mit ihm manifestiere, eben durch und im Kampf auf Leben und Tod.
Weiters erweist die Moral ihre höchste Geltung dadurch, dass sie unter Umständen das Opfer eines Lebens fordert, um sie zu verteidigen.
Dieser Forderung wird es nur gerecht, indem es sich nicht scheut, den Kampf zu einem solchen auf Leben und Tod realisieren zu lassen, wenn dies erforderlich scheint.
Nicht der bloße Wille nach Anerkennung durch den anderen, sondern die moralische Sache selbst fordert, dass man das Leben aufs Spiel setzt, damit es einem (gegebenenfalls) mit einer neuen und höheren, moralischen Qualität zurückgegeben wird.
7) Waffen, Informationen, Drohung und Versklavung als indirekte Mittel der Macht
Allgemein ist es bedeutsam, schon im voraus realistisch einschätzen zu können, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Sieges für die jeweilige Seite ist.
Ist die Situation einem selber günstig, wird man eher den physischen Konflikt suchen, andernfalls sich bemühen, einer Entscheidung auszuweichen. In beiden Fällen kommt es darauf an, selber zu entscheiden, wozu es kommen soll, dem Gegner das Gesetz des Handelns oder Unterlassens aufzuzwingen und es sich nicht selbst aufzuzwingen zu lassen.
Daher ist für die Entscheidungsfindung die Innehabung und die Entwicklung von relativen Machtmitteln und -verhältnissen von besonderer Bedeutung.
Waffen
In einem Kampf muss es nicht notwendigerweise immer auf das Aufeinanderstoßen von Körper auf Körper kommen, denn zwischen den Körpern können auch äußere Objekte „vermitteln“, die jene Funktion inne haben, den fremden Körper zu verletzen oder sogar zu töten.
Bekanntlich werden solche Objekte als Waffen (im engeren Sinne) bezeichnet, als indirekte Mittel der unmittelbaren Machtaustragung.
Überlegenheit in den Waffen kann auch das Fehlen physischer Stärke kompensieren, so wie bei der Jagd, bei der der Jäger größere und vor allem stärkere Tiere, als er selbst, mittels Waffen erledigen kann.
Der physisch Schwächere erhält durch Waffen die Chance auf einen Sieg über den Stärkeren.
Solche unmittelbaren Objekte können eine sehr große Rolle spielen, so haben Innovationen in der Waffenentwicklung häufig über den Ausgang von Kriegen entschieden.
Dennoch ist etwas Formales an den Waffen bestechend, nämlich die Tatsache, dass sie ein Produkt theoretischer und physischer Intelligenz sind.
Somit kann ein Sieg, begründet auf Waffenüberlegenheit, durchaus auch als Ergebnis physischer Überlegenheit bezeichnet werden.
Waffen gehören zur zweiten Welt, sie verlegen den Schwerpunkt der Gewalt aus dem eigenen Körper heraus, verbleiben aber dennoch in der Sphäre des Körpers, denn sie müssen ja auch schließlich auf die Körper wirken.
Jene Ansichten sind absurd, denen zugrunde liegt, technische Entwicklungen könnten schließendlich zu virtuellen Kriegen auf Computern führen. Zwar mag es schon sein, dass man sich in bestimmten Situationen mit symbolischen Auseinandersetzungen begnügt, wie man das in früheren Zeiten tun konnte, aber wenn der Konflikt ernst gemeint ist, dann wird er zur Anwendung von Gewalt gegen Körper führen.
Denn der Streitursprung stellt immer noch der „lebende Gegner“ dar und so kann sich die Gewaltausübung nur unmittelbar auf den gegnerischen Körper richten.
Informationen
Eine Loslösung von der Sphäre der Körperlichkeit stellen dagegen die Informationen dar, die erforderlich sind, um einen möglichst effizienten Einsatz der Gewalt zu ermöglichen, denn der Wille bedarf zutreffender Annahmen über die Außenwelt, um in sie eingreifen zu können.
Diese Informationssuche (Spionage,...) hat hängt nicht unmittelbar mit der Machtausübung oder Gewalt zusammen, sie ist nur ein indirektes Instrument der Macht.
Über bestimmte Informationen hinsichtlich ungeschützter Schwächen des Gegners, seiner aggressiven Absichten und seiner Waffen zu verfügen, kann den Sieg oder die Abwendung einer Niederlage bedeuten.
Von ihnen können kampfstrategische Entscheidung abhängen, wie Angriff oder Verteidigung.
Bei der Angewiesenheit auf Information setzt die List an, ein sehr interessanter Aspekt im Gefüge von (relativer) Macht.
Um eine List handelt es sich dann, wenn ich den Willen des anderen dadurch vereitle, indem ich Irrtümer des anderen ausnütze oder ihm gar falsche Informationen zukommen lasse, wenn ich ihn also desinformiere, um mir einen persönlichen Vorteil bei der Machtauseinandersetzung verschaffen zu können. Man sollte dabei übrigens nicht die List der Gewalt entgegensetzen.
Sicher kann es auch Zweck einer List sein, dem Gegner zu entrinnen und es gar nicht zum Gewalteinsatz kommen zu lassen.
Aber es ist keineswegs begriffsnotwendig, denn die List kann durchaus auf die physische Neutralisierung des Gegners zielen (z.B.: den Gegner in einen Hinterhalt locken wollen, um ihn dann zu vernichten).
Nur ist das Mittel, dessen sich die List bedient, weder unmittelbar noch, wie die Waffen, mittelbare physische Stärke.
Zu dieser, nicht zu Gewalt, ist sie der konträre Begriff. Freilich kann die List den anderen ganz ohne Einsatz direkter oder indirekter physischer Stärke nur in Ausnahmefällen vernichten.
In der Regel wird sie sich darauf beschränken, den zur Durchsetzung des eigenen Willens erforderlichen physischen Kampf im eigenen Interesse möglichst zu begrenzen.
Doch sind mit der List auch zwei moralische Probleme verbunden:
Erstens führt sie in der Regel (auch wenn nicht notwendig) zur Lüge und verletzt damit die elementarste Grundlage von „Intersubjektivität“ und zweitens kann die List insofern die Symmetrie des objektiven Kampfes verletzen, da der Gegner nicht immer mit ihr rechnet, während bei einem offenen Kampf die eingesetzten Mittel beider Seiten bekannt sind und von jeder Seite auch eingeschätzt werden können.
Waffen und Informationen haben etwas konformes, sie können nämlich transportiert werden und müssen dies auch, wenn die Auseinandersetzung größere Räume erfasst. Der Transport von Menschen, Dingen und Informationen im Raum ist ein sehr wichtiges Machtmittel.
Drohung
Aber nicht nur der begrenzte Kampf oder die Zufügung von Schmerzen, auch schon die Drohung mit ihm oder allgemein mit negativen Sanktionen, wie der Verletzung von Leib, Freiheit, Eigentum oder Ehre kann genügen, um den anderen zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen.
Die Drohung mag sich nicht nur gegen eigene Güter richten, auch die Güter derjenigen Angehörigen, die einem ließ sind bzw. mit denen man in einem kollektiven Wir verbunden ist, mögen gefährdet sein, in diesem Fall werden die Angehörigen zu Geiseln.
Sosehr zur Drohung der Verweis auf die Zukunft gehört, wird sie freilich nur dann wirksam sein, wenn sie plausibel erscheint. Dabei wird sich der Glauben an sie in der Regel teils an bestimmten Merkmalen des Drohenden orientieren (wie etwa an der physischen Stärken), teils an vorangegangenen Erfahrungen, die sei es der Bedrohte, sei es andere mit jenem, gemacht haben.
Entscheidend ist jedenfalls die subjektive Einschätzung durch den Adressaten der Drohung. Was er glaubt, ist wichtiger, als was wirklich eintreten wird, wenn es darum geht, den Kampf zu vermeiden.
Wenn nämlich der Stärkere dem Unterlegenen schaden kann, dieser das aber nicht für wahr hält, wird er ihm nicht ohne Kampf zu Willen sein.
Sicher kann man in einem bestimmten Sinne sagen, jemand habe über einen anderen Macht auch dann, wenn er ihn zum Beispiel vernichten kann, ohne dass dieser daran glaubt.
Denn er könnte seinen Willen an Sachen oder anderen Menschen durchsetzen, wenn sich ihm der andere in den Weg stellte, indem er ihn nämlich beseitigte. Für die Wirkung der Drohung sind nicht nur die subjektiven Überzeugungen des Bedrohten hinsichtlich der Fähigkeiten des Drohenden wichtig. Nicht minder zählt einerseits, ob der Bedrohte das Angedrohte wirklich nicht will und andererseits der Grad seine Furcht vor dem in Aussicht Gestellten. Einen Lebensmüden wird die Drohung mit dem Tode nicht schrecken, und selbst wer am Leben hängt und davon überzeugt ist, dass der andere ihn töten kann, mag vor dem Tode weniger Furcht empfinden als vor der Verletzung seiner Pflicht. Denn der Gezwungene muss, wie wir bereits gesehen haben, selber wollen und auch wenn er nur deswegen will, weil er dadurch ein größeres Übel zu vermeiden sucht, ist an der Notwendigkeit seines Wollens nicht zu rütteln. Er kann daher immer standhaft bleiben, wenn er Tod und Schmerzen der Schuld vorzieht.
Freilich wird seine Lage schwieriger, wenn er durch seine Weigerung nicht nur den eigenen Tod, sondern den Tod anderer zu verantworten hat, die sich nicht durch ein vergleichbares Bewusstsein einer eigenen heroischen Entscheidung zu trösten wissen.
Geiseln sind daher ein ganz besonders raffiniertes Machtmittel, um selbst Tapfere einzuschüchtern.
Immerhin kann der Mut des Bedrohten den Drohenden verunsichern, weil er ihm klar macht, dass er mit beachtlichen Widerständen zu rechnen hat. Mehr noch, er mag ihm sogar mehr Achtung abnötigen als das Nachgeben vor seiner Drohung.
Wie wichtig die Intentionen des Bedrohten für die Machtbeziehung sind, zeigt sich am gelegentlichen Gelingen von Bluffs. Der Glaube des Bedrohten, der andere besitze Machtmittel, ist letztlich wichtiger als der reale Besitz, ja selbst der Glaube des Machthabers daran.
Entscheidend ist nur, dass der Drohende weiß oder für wahrscheinlich hält, dass der andere glaube, er verfüge über die Machtmittel.
Der geschickte Bluffer muss jedenfalls einen untrüglichen Instinkt dafür haben, welcher Menschentyp auf seine Bluffs hereinfällt, bzw. welche Situationen eine allgemeine Bereitschaft erzeugen, an Bluffs zu glauben.
Dazu gehören solche, in denen der mögliche Bluffer einleuchtende kratische oder psychologische Gründe dafür hat, seine Machtmittel nicht vor der realen Auseinandersetzung zu zeigen. Wer ängstlich ist und seine Angst hat deutlich werden lassen, ist dem Bluffer gewöhnlich ausgeliefert.
Klassische Beispiele unseres Jahrhunderts für erfolgreiche Bluffs sind etwa Mussolinis Marsch auf Rom und Hitlers Außenpolitik in den ersten Jahren des Dritten Reiches.
Erfolge bei Drohungen haben etwas Autokatalytisches
(Zitat aus Hösle, V.:„Moral und Politik“; Seite 418), je mehr Menschen meinen Drohungen Glauben schenken, desto mehr steigt meine Macht und desto mehr kann ich anderen drohen. Daher gehören Hinweise auf die eigene Macht zu den beliebtesten Techniken der Machtsteigerung. Allerdings kann der Zusammenbruch einer Macht, die nicht durch die Fähigkeit gedeckt ist, die Drohungen auch sämtlich auszuführen, ebenso rasch sein wie ihr Aufbau.
Hier liegt ein grundsätzliches Problem für jene Machtform, die auf Drohungen gegründet ist. Einerseits muss das Angedrohte immer wieder vollzogen werden, sonst zerrinnt die Glaubwürdigkeit der Drohung.
Insofern kann der Machthaber sogar wünschen, der andere gebe ihm einen Anlass zu zeigen, dass er das Angedrohte auch durchzuführen vermöge, er mag ihn deshalb zu einer Verletzung seiner Befehle geradezu provozieren. Andererseits bedeutet die Notwendigkeit, die Drohung zu vollziehen, auch eine Anerkenntnis, dass die Drohung eben nicht ausgereicht habe, dass man also weniger mächtig gewesen sei, als man selbst gedacht oder wenigstens gehofft habe, dass der andere annähme.
Sie ist daher, selbst wenn man den Kampf siegreich besteht, eine Niederlage, von denen Kosten und Risiken, die mit der Ausführung der Drohung verbunden sind, ganz zu schweigen.
Hinzu kommt, dass bei dem Bedrohten die Angst paradoxerweise nach der Bestrafung geringer sein kann als vorher. Wer negative Sanktionen erdulden muss, erfährt manchmal, dass sie weniger schlimm sind, als er sie sich vorgestellt hat.
Ja, im Grunde trifft die geschilderte Ambivalenz auch schon auf die Drohung zu, nicht erst auf ihre Ausführung. Einerseits kann nur die explizite Drohung mit Sanktionen den anderen bewegen, den Preis seines Zuwiderhandelns genau in Rechnung zu stellen, andererseits legt sie den Drohenden unwiderruflich fest, bei Strafe des Gesichtsverlustes, d. h. der zukünftigen Unglaubwürdigkeit seiner Drohungen.
Sie beraubt ihn damit, ebenso wie den Machtunterworfenen, der Freiheit. Selbst wenn die Drohung eine sofortige Wirkung hat, also ohne realen Gewalteinsatz Erfolg hat, hat man sich mit ihre Feine gemacht, die sich später einmal an einem rächen können und die man im Fall der Unbestimmtheit der Drohung vielleicht hätte vermeiden können, zumindest in denjenigen Situationen, in denen man sich seiner Überlegenheit nicht völlig gewiss und nicht zum Kampfe bereit ist, werden die Drohungen daher unbestimmt sein: Man werde tun, was die eigenen Interessen geböten
(Zitat aus Hösle, V.:„Moral und Politik“; Seite 419).
Zur Machtausübung durch Drohungen gehört so die Kunst der indirekten Mitteilung.
Es ist nämlich kein Zufall, dass die sogenannte diplomatische Sprache von dieser Kunst lebt, denn der Machtmodus der internationalen Beziehungen ist im Normalfall derjenige impliziter Drohungen.
Sanft zu sprechen und einen großen Stock zu tragen ist nicht nur evidenterweise besser als ohne Waffen zu schreien.
Es ist auch, nicht nur aus rein kratischen Gründen, besser als zu schreien und mit dem Stock zu fuchteln.
Freilich muss der Schwächere, der diese Sprache nicht versteht, mit physischen Sanktionen rechnen: „Wer nicht hören will, muss fühlen“, der Stärkere aber, der sich jener Sprache nicht bedient, macht sich unnötig Feinde.
Schon eine explizite Absage kann verletzend sein, daher gehört es zum guten Ton, es gar nicht zu einer ausdrücklichen Anfrage kommen zu lassen, sondern schon im Vorfeld zu signalisieren, dass sie abschlägig beschieden werden wird. Umso mehr gilt dies für Drohungen, die sich, wie die Verleumdung selbst, wenn nur möglich, in Andeutungen bewegen.
Neben den Andeutungen sind auch paralinguistische Mittel
(Zitat aus Hösle, V.:„Moral und Politik“; Seite 419) wie Körperhaltung, Gestik, Mimik und Tonhöhe einschlägig. Oft sind sie viel wichtiger als das, was eigentlich gesagt werden will.
Gerade der Gegensatz zwischen Form und Inhalt kann besonders einschüchternd sein, da er die Bedeutungslosigkeit des inhaltlich Gesagten krass manifestiert.
Wenn die realen Rahmenbedingungen einer Situation objektiv bedrohlich sind, kann es sich der Machthaber sogar leisten, sich besonders leutselig zu geben, denn er braucht nicht zu befürchten, dass der andere seine scheinbare Freundlichkeit ausnützt. Folglich ersetzt die Wirklichkeit die Anstrengungen der paralinguistischen Mittel.
Wenn der andere die Situation missverstehen sollte, beweist er nur seine Dummheit.
Jener Widerspruch zwischen realem Hintergrund und formaler Kommunikation kann daher ein Mittel sein, um Informationen über die soziale Intelligenz des Bedrohten zu erhalten, die der Machthaber als Selbstzweck verwenden kann.
Zur Unbestimmtheit der Drohungen gehört aber nicht nur das Offenlassen möglicher Sanktionen, die man bei Ungehorsam verhängen wird, manchmal können auch die Erwartungen bleiben, die man an den anderen richtet. Diese letztere Unbestimmtheit erklärt das Phänomen des vorauseilenden Gehorsams, wie es zum Beispiel KAFKA im „Prozess“ in psychologisch unüberbietbarer Weise analysiert hat.
Einerseits ist wegen der Unvorhersehbarkeit von Einzelumständen ebenso wie wegen der Unbestimmtheit der Sprache jeder Befehl auf die Urteilskraft, ja die Phantasie des Ausführenden angewiesen.
Andererseits können die Erwartungen so vage bleiben, dass im Prinzip immer mehr geleistet werden kann und der Drohende daher stets die Möglichkeit behält, unzufrieden zu sein und dementsprechend seine Sanktionen zu setzen.
Versklavung
Sosehr der Kampf auf Leben und Tod oft eine naheliegende Möglichkeit ist, so finden sich doch auf allen drei Ebenen der Auseinandersetzung Argumente, die dagegen sprechen, es bis zum Äußersten kommen zu lassen.
Töte ich den anderen, der mir einen Gegenstand streitig macht, bin ich mir des begehrten Gegenstandes gewiss, jedoch warum soll man sich nur mit einer „Trophäe“ zufrieden geben, wenn man vielleicht beide haben kann, nämlich den begehrten Gegenstand und die demütigende Herrschaft über den besiegten Rivalen.
Der Blick des Sterbenden möge mir vielleicht ein Glücksgefühl und Hochgefühl vermitteln, aber erstens kann der Verstorbene mir dieses Gefühl nicht neu beleben bzw. für lange Zeit gewähren und zweitens mag jener Blick durchaus jede Anerkennung verweigern und Nuancen von Hass über Verachtung zu Mitleid durchlaufen.
Weiters könnte mir der Besiegte noch von wirtschaftlichen Nutzen sein, indem ich ihm seine Freiheit entziehe, ihn als Sklave ausbeute und mir so einen weiteren (wirtschaftlichen) Vorteil verschaffen könnte.
Die Versklavung des anderen bedeutet eine größere Macht als seine Tötung, denn Macht über eine anderen Menschen nur die Versklavung konstituiert, nicht die Tötung.
Der Tote kann mir zwar keinen Schaden mehr zuführen, aber er stellt mir auch keinen Nutzen mehr dar.
Weder fördert der Tote meine Interessen, noch erkennt er mich an, noch gibt er mir, wie in diesem Falle, in dem er als Sklave weiterzuleben dem Tode vorzieht, eine partielle moralische Bestätigung meiner Macht.
Wenn Macht letztlich in der Fähigkeit besteht, meinen Willen weitgehend durchzusetzen, so potenziere ich meine Macht, wenn ich über einen anderen Willen verfügen kann.
Je mehr Tätigkeiten dieser in Entsprechung mit meinem eigenen Willen ausübt, desto mächtiger bin ich.
Weiters ist zu beachten, wenn ich jemanden töte, beseitige ich zwar die physische Grundlage seines Willens, der damit zumindest für mich nicht mehr da ist, aber ich kann nicht ungeschehen machen, dass der andere meinen Willen nicht mehr anerkennt.
Dies ist aber dann möglich, wenn ich den anderen dazu zwinge, dass heißt wenn ich Gewalt nicht über seinen Körper, sondern über seinen Willen ausübe.
Im Zwang kann der andere dazu gebracht werden, das zwar nicht zu wünschen und zu erstreben, aber doch zu wollen und zu tun, was ich will, nicht nur dasjenige nicht zu tun, was ich nicht will.
Ich werde Herr nicht nur über seine Unterlassungen, sondern auch über seine Taten. Ich verfüge über seinen Willen und mache ihn zu einem Instrument meiner selbst.
Erschlage ich jedoch den Gegner, der etwas für sich haben will, was ich auch begehre, habe ich nur die Durchsetzung seines Willens verhindert, nicht seinen Willen verändert.
Wie kann ich einem anderen seinen Willen zerstören und ihn mir gefügsam machen?
Nun zu aller erst besteht die Möglichkeit der Zufügung von physischen Schmerzen um ihn willenlos zu foltern.
Aber die Zufügung physischen Schmerzes ist nicht die einzige, ja nicht einmal die primäre Weise, den Willen des anderen zu zwingen.
Entscheidend ist vielmehr die Zerstörung der Selbstachtung des anderen.
(Zitat aus Hösle, V.:„Moral und Politik“; Seite 414).
Allein dadurch kann ich den Willen des anderen brechen, ein doch wesentlich aufwendigerer Vorgang als das bloße Töten, den kein anderes Tier als der Mensch kennt.
In der normalen Folter wird der Wille des anderen nur stückchenweise entrissen und das Zwingen des Willens geschieht auf dem Umweg des Körpers, also über etwas Äußerliches. Um den fremden Willen gleichsam zu schmelzen, ist die rasche Alternierung entgegengesetzter Gefühle, des Schmerzes etwa und des Behagens, der Angst und des Vertrauens.
Der Höhepunkt der Brechung des Willens wird dort erreicht, wo jemand durch die Folter dahin geführt wird, von selbst etwas zu tun, was er moralisch auf tiefste verachtet und persönlich ablehnt.
So sehr die Brechung der geistigen Grundlage des Willens des anderen, seiner Selbstachtung, etwas Seelisches betrifft, sosehr geschieht sie in der Regel vermittelt über physische Gewalt.
Vergleichbar damit ist die Szene in ORWELL´s 1984
, in der Winston Smith von O´Brien dazu gebracht wird, Julia zu verraten, ohne eine Anregung dazu erhalten zu haben.
Es gibt aber auch die Möglichkeit der reinen psychischen Gewalt, um jemanden willenlos zu machen. Gewiss muss sie als intersubjektiver Akt über eine Sprache vermittelt sein.
Aber die Bedeutungen sind es, auf die es dabei ankommt. Denn man kann einen Menschen mit Worten tiefer verletzen als mit Taten und gerade das Fundament der Selbstachtung, das beim im Zweikampf tödlich Getroffenen unversehrt bleiben kann, mag durch Beleidigungen furchtbar erschüttert werden.
Literaturhinweis:
Häufig gestellte Fragen
- Was ist der zentrale Fokus des Textes "Macht und ihre begrifflichen Grundlagen"?
- Der Text analysiert umfassend den Begriff "Macht", seine verschiedenen Definitionen, Beziehungen zu verwandten Begriffen wie Einfluss, Autorität, Herrschaft und Gewalt, und die Grundlagen der Machtausübung in sozialen Kontexten.
- Wie definiert Vittorio Hösle Macht?
- Hösle beschreibt Macht anhand von sieben Merkmalen: Sie ist ein zweistelliges Prädikat, ein Dispositionsprädikat, verwandt mit dem Kraftbegriff, impliziert einen volitiven Akt, ist auf Prozesse innerhalb der sozialen Welt beschränkt, ist asymmetrisch und amoralisch.
- Was sind Hösles sieben Merkmale von Macht?
- 1) Zweistelliges Prädikat, 2) Dispositionsprädikat, 3) Verwandtschaft zum Kraftbegriff, 4) Volitiver Akt seitens des Machthabers, 5) Beschränkung auf soziale Welt, 6) Asymmetrisches Verhältnis, 7) Amoralität.
- Wie unterscheidet sich Macht von Einfluss nach Hösle?
- Hösle unterscheidet zwischen Macht im weiteren Sinne (Einfluss) und Macht im engeren Sinne. Einfluss erfordert weniger Voraussetzungen und muss nicht immer gewollt sein, während Macht eine stärkere Form von Einfluss darstellt, die Widerstand überwinden kann.
- Wie kritisiert Hösle Webers Machtdefinition?
- Hösle kritisiert Webers Definition dafür, dass sie zu unterschiedliche Formen der Willensdurchsetzung erfasst und nicht klar definiert, ob Widerstreben ein notwendiges Element von Macht ist.
- Welche Arten von sozialer Macht werden unterschieden?
- Es werden drei Arten von Macht unterschieden: persönliche Macht, organisatorische Macht und Macht im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Diese unterscheiden sich durch den Umfang der sozialen Gruppe und das Ziel der Machtausübung.
- Warum kämpfen Menschen um Macht?
- Menschen kämpfen um Macht aufgrund von konkurrierenden Willen, dem Wunsch nach Anerkennung, der Durchsetzung von Interessen und der Bestätigung von Werten. Der Kampf selbst kann zum Selbstzweck werden und das Selbstwertgefühl steigern.
- Welche Rolle spielen Waffen und Informationen bei der Machtausübung?
- Waffen stellen indirekte Mittel der Macht dar, die physische Schwäche kompensieren können. Informationen sind für den effizienten Einsatz von Gewalt unerlässlich und ermöglichen es, Schwächen des Gegners auszunutzen.
- Wie funktioniert Machtausübung durch Drohungen?
- Drohungen können den anderen zu einem bestimmten Verhalten zwingen, indem sie negative Sanktionen androhen. Die Wirksamkeit der Drohung hängt von der Glaubwürdigkeit und der subjektiven Einschätzung des Bedrohten ab.
- Was bedeutet Versklavung als Mittel der Machtausübung?
- Versklavung bedeutet die Herrschaft über den Willen eines anderen Menschen und stellt eine größere Macht dar als dessen Tötung, da der Sklave ausgebeutet werden kann und somit einen Vorteil für den Machthaber darstellt.
- Wie kann der Wille eines anderen Menschen gebrochen werden?
- Der Wille eines anderen Menschen kann durch die Zufügung von physischen Schmerzen, aber vor allem durch die Zerstörung seiner Selbstachtung gebrochen werden. Dies kann durch psychische Gewalt und die Manipulation von Gefühlen geschehen.
- Was ist die Bedeutung von Selbstachtung im Kontext von Macht?
- Die Zerstörung der Selbstachtung des anderen ist ein zentrales Element bei der Brechung des Willens und der Versklavung. Es ist ein aufwendigerer Prozess als das bloße Töten und ermöglicht die vollständige Kontrolle über den anderen.
- Welche Rolle spielen Werte im Kampf um Macht?
- Im Kampf um Macht spielen Werte eine wichtige Rolle, da sie die Legitimation der verschiedenen Interessen beeinflussen. Moralische Prinzipien können als Rechtfertigung dienen, den Willen des anderen zu brechen und das eigene Wertempfinden aufzuzwingen.
- Quote paper
- Norman Schätz (Author), 2000, Soziologie der Macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103470