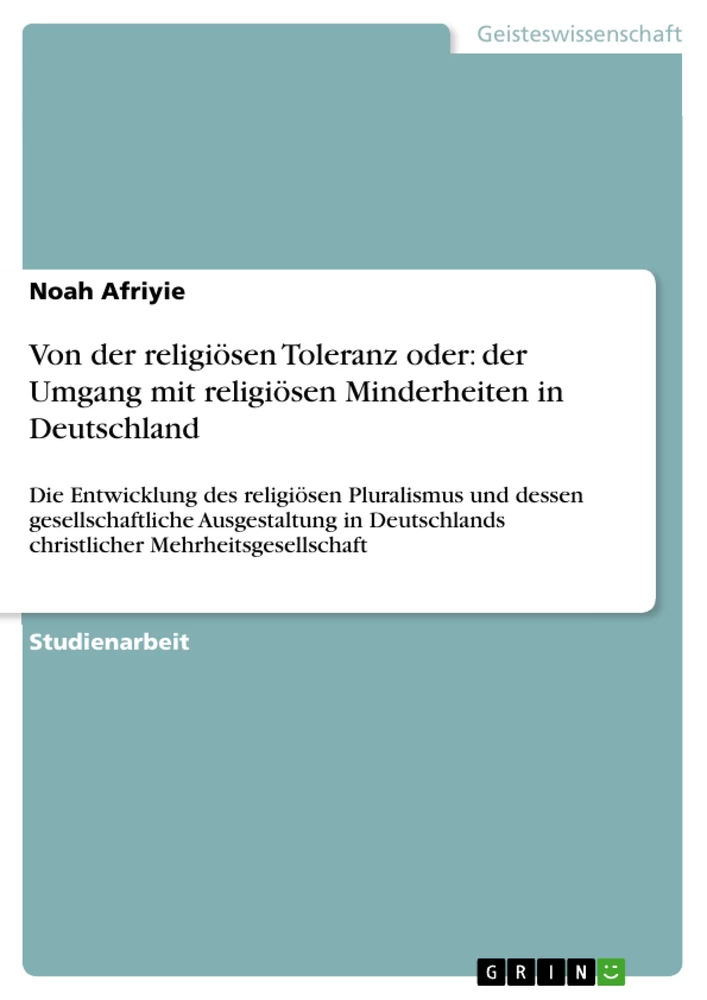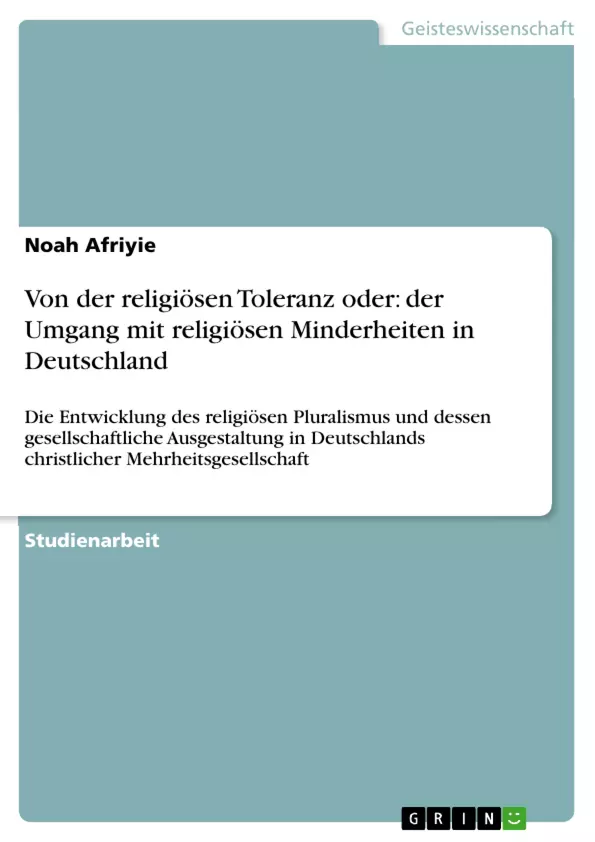Diese Arbeit wird sich in diesem Zuge mit zweierlei befassen: Zuerst wird einen kurzen historischen Rückblick über die Geschichte religiöser Freiheit im historischen Kontext geben und einige klassische Ansätze zu dieser Thematik darlegen. Das ist insofern interessant, als das die religiöse Vielfalt, in der wir heute leben, lange ausgehandelt werden musste und die Trennung von Religion und Staat, welche uns in liberalen Staaten heute weitreichende Freiheit unserer religiösen Praktiken ermöglicht, lange Zeit umstritten war und erst im Laufe der jüngeren Geschichte in vielen Staaten etabliert werden konnte. Demzufolge erachte ich es als sinnvoll, einen kurzen Überblick über den historischen Kontext vom Zusammenhang von Staat & Religion zu geben.
Anschließend unternehme ich einen kurzen Exkurs zur Begrifflichkeit der Toleranz. Dies dient vornehmlich dazu, den Toleranzbegriff, welcher speziell im 2. Teil der Arbeit vorgenommen wird, besser zu kontextualisieren, da dieser so simpel erscheinende Begriff aufgrund mangelnder Trennschärfe zu verwandten Begriffen und verschiedener Verständnisansätze kontroverser, und komplexer ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Daran anschließend wird im 2. Teil der Arbeit, basierend auf dem zuvor dargelegten Toleranzverständnis, ein Sprung in die gesellschaftliche Realität unternommen und die religiöse Toleranz in unserer multireligiöse Gesellschaft genauer betrachtet. Das Hauptinteresse liegt darin, der Frage nachzugehen, inwieweit der religiöse Pluralismus in Deutschland erfolgreich ist – das heißt, inwiefern eine gegenseitige Toleranz, oder gar Anerkennung der Anhänger der unterschiedlichen Religionen stattfindet. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, wie weit Vorurteile und Feindseligkeiten aufgrund der religiösen Zugehörigkeit in Deutschland verbreitet sind. Zu dieser Thematik hat der Religionsmonitor 2019 eine Studie mit durchaus interessanten Ergebnissen durchgeführt. Diese bildet nachfolgend gemeinsam mit einer weiteren Erhebung aus dem Jahr 2014 die statistische Basis, anhand derer analytische Bewertungen hinsichtlich des religiösen Zusammenlebens in Deutschland vorgenommen werden, wobei vor allem auf die Sonderrolle des Islams in Deutschland eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des religiösen Pluralismus
- Klassische Ansätze zum Verhältnis von Staat und Religion
- Historische Entwicklung des religiösen Pluralismus im westlichen Kontext
- Exkurs: Zur Toleranz an sich
- Der Pluralismus und die religiöse Toleranz in Deutschland
- Religiöser Pluralismus: Deutschland im Vergleich
- Deutschland und der Islam: Toleranz mit Grenzen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des religiösen Pluralismus in Deutschland und analysiert die Herausforderungen und Chancen der Toleranz im Umgang mit religiösen Minderheiten.
- Historische Entwicklung des religiösen Pluralismus im Westen
- Klassische Ansätze zum Verhältnis von Staat und Religion
- Der Begriff der Toleranz und seine Komplexität
- Religiöse Vielfalt in Deutschland und der Umgang mit verschiedenen Glaubensrichtungen
- Der Islam in Deutschland: Toleranz und Grenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der religiösen Toleranz in Deutschland vor und beleuchtet die Entwicklung des religiösen Pluralismus in modernen Gesellschaften. Sie skizziert den historischen Hintergrund und die Bedeutung der Trennung von Religion und Staat.
Die Entwicklung des religiösen Pluralismus
Dieses Kapitel befasst sich mit der historischen Entwicklung des religiösen Pluralismus und analysiert klassische Ansätze zum Verhältnis von Staat und Religion. Es werden wichtige Denker wie John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Juan de Mariana und Montesquieu vorgestellt, die unterschiedliche Perspektiven auf religiöse Vielfalt und Toleranz vertreten.
Exkurs: Zur Toleranz an sich
Dieser Exkurs beleuchtet den Begriff der Toleranz im Detail und analysiert dessen Komplexität. Er betrachtet verschiedene Verständnisansätze und untersucht die Grenzen des Toleranzbegriffs.
Der Pluralismus und die religiöse Toleranz in Deutschland
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Situation in Deutschland und analysiert die Herausforderungen und Chancen des religiösen Pluralismus. Es betrachtet den Islam in Deutschland und die Frage der Toleranz mit Grenzen.
Schlüsselwörter
Religiöse Toleranz, Religiöser Pluralismus, Staat und Religion, Historische Entwicklung, Toleranzbegriff, Deutschland, Islam, Religionsfreiheit, Minderheitenrechte, Gesellschaftliche Integration.
- Quote paper
- Noah Afriyie (Author), 2021, Von der religiösen Toleranz oder: der Umgang mit religiösen Minderheiten in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1035154