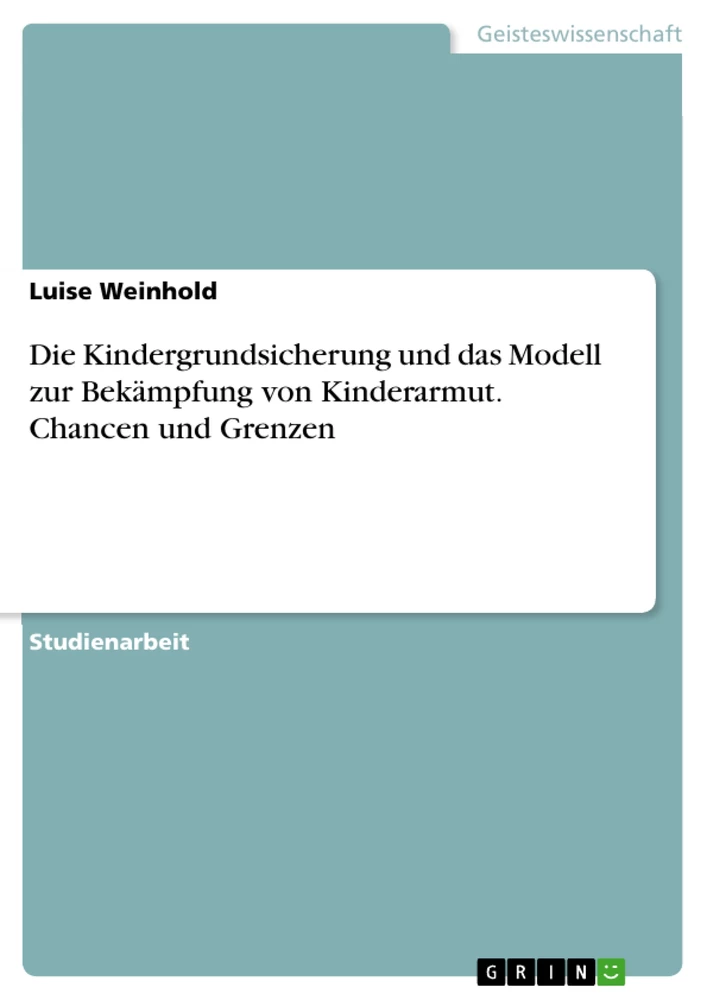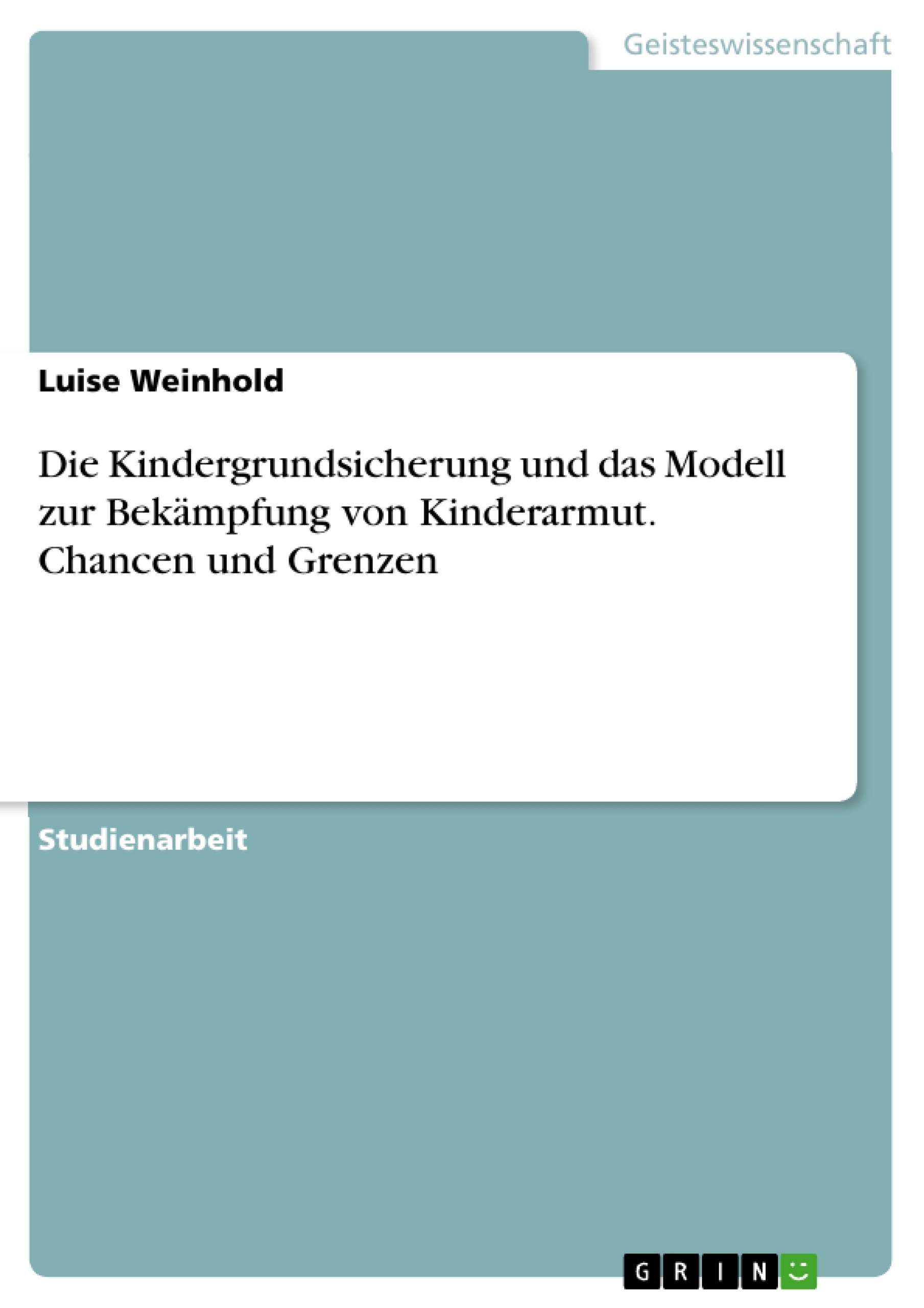Diese Arbeit möchte folgender Frage auf den Grund gehen: Welche Chancen bietet und welche Grenzen hat die Kindergrundsicherung als Maßnahme zur Bekämpfung von Kinderarmut?
„Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard an.“, heißt es in Artikel 27 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention von 1989, zu deren Unterzeichnern auch Deutschland gehört.
Doch dieses Recht ist durch ein Leben in Armut stark gefährdet. Glücklicherweise hat die Bekämpfung von Kinderarmut in den letzten Jahrzehnten einen zunehmend wichtigeren Stellenwert in Deutschland eingenommen. Das Starke-Familien-Gesetz von 2019 ist eine der aktuellsten Bemühungen, den Familienlastenausgleich fair zu gestalten und dabei auch Kinderarmut zu senken.
Einigen Parteien und NGOs geht dieses Maßnahmenpaket jedoch nicht weit genug: Sie fordern die Einführung einer Kindergrundsicherung. Diese solle Kinderarmut nachhaltiger bekämpfen können als beispielsweise ein reformierter Kinderzuschlag. In die Überlegungen zur Kinderarmut spielen auch immer Fragen zu Kinderrechten eine Rolle: Was steht Kindern in welchem Umfang zu?
Auf der einen Seite gelten Kinder als unschuldig an ihrer Armutslage und sollten deswegen besonders vom Staat geschützt und gefördert werden, auf der anderen Seite wird die Versorgung der Kinder weitgehend als Aufgabe der Eltern betrachtet, in die sich der Staat nur zögerlich einmischt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrundwissen
- Kinderarmut im Überblick
- Kindergrundsicherung im Überblick
- Chancen und Grenzen der Kindergrundsicherung
- Chancen
- Grenzen
- Fazit
- Quellen
- Printquellen
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Chancen und Grenzen die Kindergrundsicherung als Maßnahme zur Bekämpfung von Kinderarmut bietet. Dabei wird zunächst Grundlagenwissen über Kinderarmut und das Modell der Kindergrundsicherung aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Im Hauptteil werden dann die Chancen bzw. Stärken und anschließend die Grenzen bzw. Schwächen des Modells beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der kritischen Auseinandersetzung mit den Argumenten beider Seiten und der Berücksichtigung der komplexen Problematik von Kinderarmut. Zum Schluss erfolgt eine Einschätzung zur Kindergrundsicherung und ein Ausblick hinsichtlich der möglichen Implementierung im deutschen Wohlfahrtsstaat.
- Kinderarmut in Deutschland
- Das Modell der Kindergrundsicherung
- Chancen der Kindergrundsicherung
- Grenzen der Kindergrundsicherung
- Mögliche Implementierung im deutschen Wohlfahrtsstaat
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung zum Thema Kindergrundsicherung und stellt die Problemstellung der Arbeit dar. Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über Kinderarmut in Deutschland und erläutert das Modell der Kindergrundsicherung. Das dritte Kapitel beleuchtet die Chancen und Grenzen der Kindergrundsicherung, wobei die Stärken und Schwächen des Modells aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Kinderarmut, Kindergrundsicherung, Chancen, Grenzen, Wohlfahrtsstaat, soziale Gerechtigkeit und Kinderrechte. Die Arbeit befasst sich mit den unterschiedlichen Argumenten und Perspektiven zum Thema Kinderarmut und der Wirksamkeit des Modells der Kindergrundsicherung als Instrument zur Bekämpfung von Armut in der Kindheit.
- Citation du texte
- Luise Weinhold (Auteur), 2020, Die Kindergrundsicherung und das Modell zur Bekämpfung von Kinderarmut. Chancen und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1036014