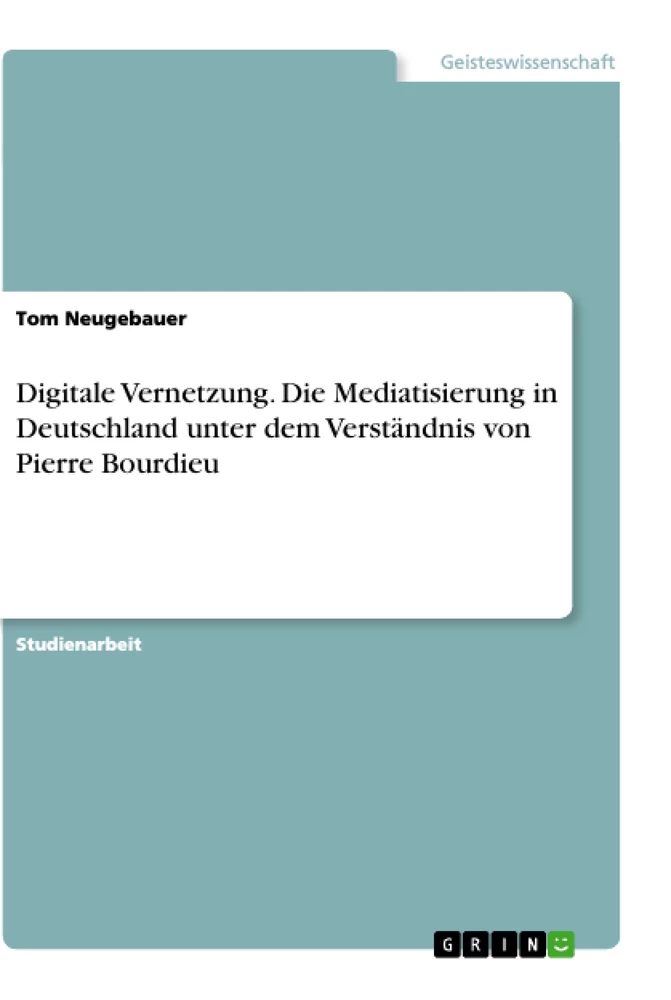Diese Arbeit befasst sich mit den Phänomenen Digitalisierung und Mediatisierung und untersucht, inwiefern diese als Faktoren für gesellschaftliche Inklusion und Exklusion fungieren. Während Digitalisierung abgekürzt als das Ersetzen analoger Leistungserbringung durch Leistungserbringung in einem digitalen, computerhandhabbaren Modell bezeichnet wird, steht die Mediatisierung als Konsequenz der Digitalisierung für eine wachsende Bedeutung der unterschiedlichen Medien für Arbeit, Alltag und soziale Beziehungen.
So spielen Medien eine immer größere Rolle, weil sie für das kommunikative Handeln in der Gesellschaft verwendet werden und auf diese Weise die Wirklichkeit beeinflussen. Es soll geklärt werden, welche Auswirkungen der technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten auf das Individuum zu verorten sind und inwiefern sich dieser Sachverhalt mit den Thesen des französischen Soziologen Pierre Bourdieu über den Habitus und soziale Felder, mit besonderem Hinblick auf die unterschiedlichen Kapitalsorten, analysieren lässt. Unter Kapital versteht Bourdieu im Allgemeinen eine soziale Energie, also eine Art der Macht, die einem einzelnen Menschen oder einer Menschengruppe verschiedene Handlungsalternativen ermöglichen.
Als ökonomisches Kapital bezeichnet er beispielsweise (Wert-)Gegenstände oder finanzielle Ressourcen, wohingegen sich der soziale Kapitalbegriff auf soziale Beziehungen oder Gruppenzugehörigkeiten bezieht. Das bedeutet, nur wenn jemand im Besitz eines bestimmten Kapitals ist, ist diese Person nach Bourdieu in der Lage die spezifischen, diesem Kapital zugeordneten Tätigkeiten auszuführen. Die Frage, die diese Hausarbeit auf den folgenden Seiten beantworten soll, lautet demnach: "Inwieweit kann das Phänomen der Mediatisierung in Deutschland als Verstärker für gesellschaftliche In- und Exklusion bezeichnet werden?"
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Pierre Bourdieu
- 2.1 Der Habitus
- 2.2 Das Kapital
- 2.2.1 Das ökonomische Kapital
- 2.2.2 Das kulturelle Kapital
- 2.2.3 Das soziale Kapital
- 2.2.4 Das symbolische Kapital
- 3 Exploration
- 3.1 Digitalisierung
- 3.2 Mediatisierung
- 3.3 Chancen und Risiken von Digitalisierung und Mediatisierung
- 4 Analyse
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Auswirkungen der Digitalisierung und Mediatisierung auf gesellschaftliche Inklusion und Exklusion. Sie untersucht, inwieweit diese Phänomene als Verstärker für soziale Ungleichheit fungieren und welche Rolle Pierre Bourdieus Kapitaltheorie dabei spielt.
- Die Bedeutung von Digitalisierung und Mediatisierung für das menschliche Handeln und soziale Beziehungen
- Die Analyse der Folgen von Digitalisierung und Mediatisierung auf die Lebensbereiche Arbeit, Alltag und soziale Beziehungen
- Die Anwendung von Pierre Bourdieus Kapitaltheorie auf die Analyse der Auswirkungen von Digitalisierung und Mediatisierung auf gesellschaftliche Inklusion und Exklusion
- Die Untersuchung der verschiedenen Kapitalsorten (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) und ihrer Relevanz im Kontext von Digitalisierung und Mediatisierung
- Die Frage, ob sich der soziale Zwang, der durch die Mediatisierung entsteht, umgehen lässt, ohne von gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen zu werden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit führt in die Thematik der Digitalisierung und Mediatisierung ein und stellt die zentrale Frage nach deren Auswirkungen auf gesellschaftliche In- und Exklusion. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese Frage mithilfe der Thesen des französischen Soziologen Pierre Bourdieu zu untersuchen.
Kapitel 2 beleuchtet Bourdieus Kapitaltheorie, insbesondere die verschiedenen Kapitalsorten und deren Bedeutung für gesellschaftliche Prozesse. Der Habitus als Ausdruck von inkorporierter Erfahrung wird als grundlegendes Konzept für die Kapitaltheorie vorgestellt.
Kapitel 3 widmet sich der Erläuterung der Phänomene Digitalisierung und Mediatisierung. Es werden die Chancen und Risiken dieser Entwicklungen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das menschliche Handeln und soziale Beziehungen beleuchtet.
Kapitel 4 bietet eine theoretische Analyse der gesellschaftlichen Situation im Kontext von Digitalisierung und Mediatisierung. Es wird untersucht, ob sich Bourdieus Kapitaltheorie als geeignetes Werkzeug zur Analyse der Auswirkungen dieser Prozesse auf soziale In- und Exklusion erweist.
Die Arbeit gipfelt im Fazit, das die Ergebnisse der Analyse zusammenfasst und die zentralen Schlussfolgerungen des Textes hervorhebt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Digitalisierung, Mediatisierung, gesellschaftliche Inklusion und Exklusion sowie Pierre Bourdieus Kapitaltheorie. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen der Digitalisierung und Mediatisierung auf soziale Beziehungen, die Relevanz von Bourdieus Kapitalbegriffen (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital) in diesem Kontext und die Frage nach dem Einfluss dieser Entwicklungen auf soziale Ungleichheit.
- Citation du texte
- Tom Neugebauer (Auteur), 2019, Digitale Vernetzung. Die Mediatisierung in Deutschland unter dem Verständnis von Pierre Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1036043