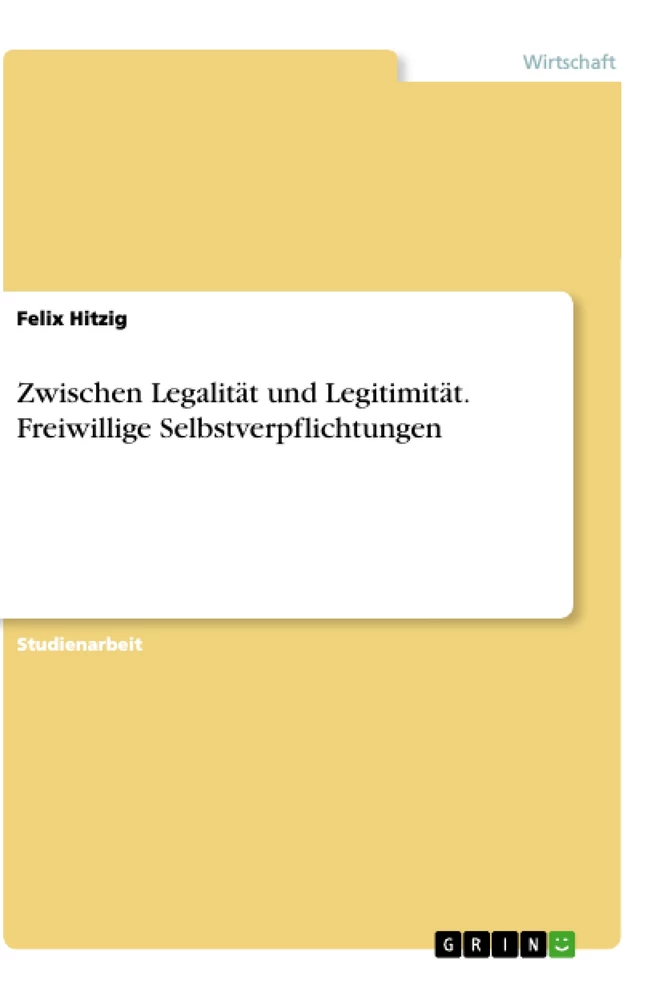Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Motive und Ziele von Staat und Wirtschaft, eine freiwillige Selbstverpflichtung (FSV) abzuschließen. Zudem wird der Frage nachgegangen, ob Verfassungsrecht und andere Rechtsgebiete betroffen sind und inwiefern freiwillige Selbstverpflichtungen vergleichsweise effektiv und effizient sind.
Die Arbeit bezieht sich dabei schwerpunktmäßig auf theoretische Ansätze und praxisnahe Erwägungen. Konkrete Fallbeispiele werden mit Blick auf den beabsichtigten Umfang der Arbeit nur exemplarisch angeführt. Im Fazit werden schließlich übergreifend die Stärken und Schwächen von FSV abgewogen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Definition, Synonyme und Abgrenzung
- Motive, Ziele, Eingriffsfunktion
- Staat
- Wirtschaft
- Legalität – Rechtliche Bewertung
- Verfassungsrecht
- Vertrags-, haftungs- und wettbewerbsrechtliche Belange
- Legitimität – Berechtigung und Anerkennungswürdigkeit von FSV
- Effektivität
- Effizienz
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Rechtsprechungsverzeichnis
- Rechtsquellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Motivationsgründe und Ziele von Staat und Wirtschaft, Freiwillige Selbstverpflichtungen (FSV) abzuschließen. Im Zentrum steht die Frage, ob Verfassungsrecht und andere Rechtsgebiete betroffen sind und wie effektiv und effizient FSV im Vergleich zu anderen Regelungsformen sind. Die Arbeit basiert auf einer umfassenden Literaturrecherche.
- Analyse der Motive von Staat und Wirtschaft, FSV einzugehen
- Bewertung der rechtlichen Auswirkungen von FSV auf Verfassungsrecht und andere Rechtsgebiete
- Untersuchung der Effektivität und Effizienz von FSV
- Abwägung der Stärken und Schwächen von FSV
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Freiwillige Selbstverpflichtungen (FSV) ein und beschreibt die Kontroversen und Herausforderungen, die mit FSV in verschiedenen Bereichen wie Umweltpolitik, Mobilfunk und Arbeitsbedingungen verbunden sind. Sie definiert die Zielsetzung der Arbeit, die auf die Klärung der Motive der FSV-Partner, die staatlichen Eingriffsfunktionen und die rechtlichen Grundlagen sowie die Effektivität und Legitimität von FSV abzielt.
- Definition, Synonyme und Abgrenzung: Dieser Abschnitt widmet sich der Definition des Begriffs „Freiwillige Selbstverpflichtung" und erörtert die Synonyme und Abgrenzungen zu ähnlichen Konzepten wie Branchenabkommen, freiwillige Vereinbarungen, Verbändevereinbarungen und Verhaltenskodex. Die Diskussion beleuchtet die Entwicklung der Definition von FSV und die zunehmende kritische Hinterfragung der Rechtsunverbindlichkeit.
- Motive, Ziele, Eingriffsfunktion: Dieser Abschnitt analysiert die Motive von Staat und Wirtschaft, FSV abzuschließen. Er betrachtet die staatlichen Ziele, die in einem Zeitvorteil im Verhandlungsprozess und einem geringeren Kontrollaufwand in der Umsetzungsphase bestehen, sowie die Vorteile für die Wirtschaft, die in den spezifischen Regelungen für ihre jeweiligen Branchen liegen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Arbeit sind Freiwillige Selbstverpflichtungen (FSV), Legalität, Legitimität, Effektivität, Effizienz, Verfassungsrecht, Vertragsrecht, Haftungsrecht, Wettbewerbsrecht, Staat, Wirtschaft, Zeitvorteil, Kontrollaufwand, Informationsasymmetrien, Verzögerungstaktiken, Greenwashing.
- Citar trabajo
- Felix Hitzig (Autor), 2021, Zwischen Legalität und Legitimität. Freiwillige Selbstverpflichtungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1036500