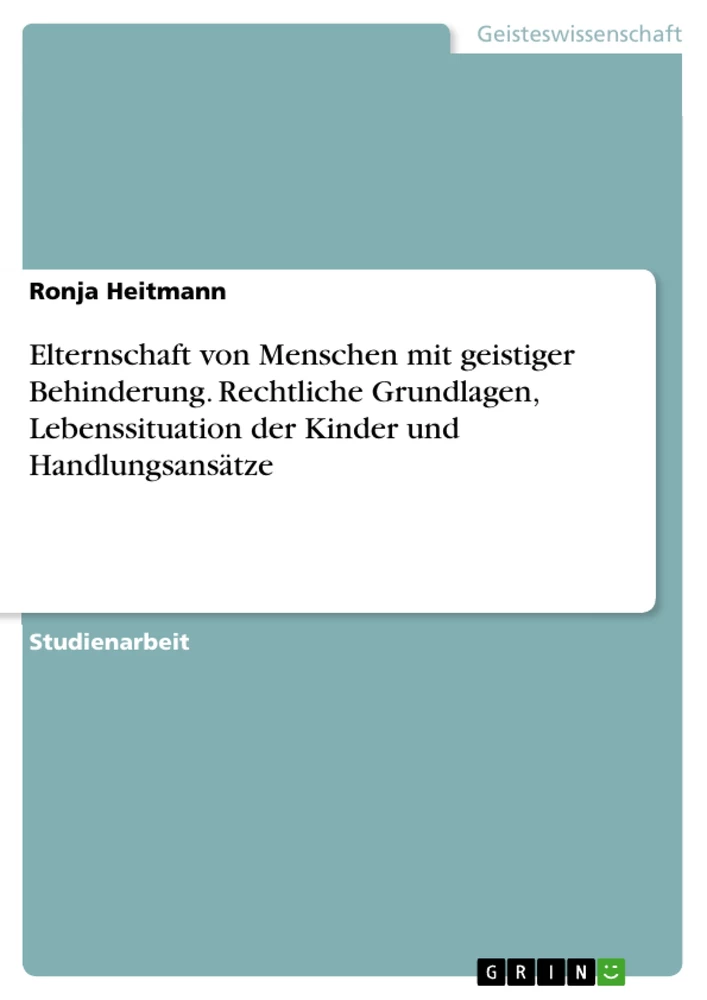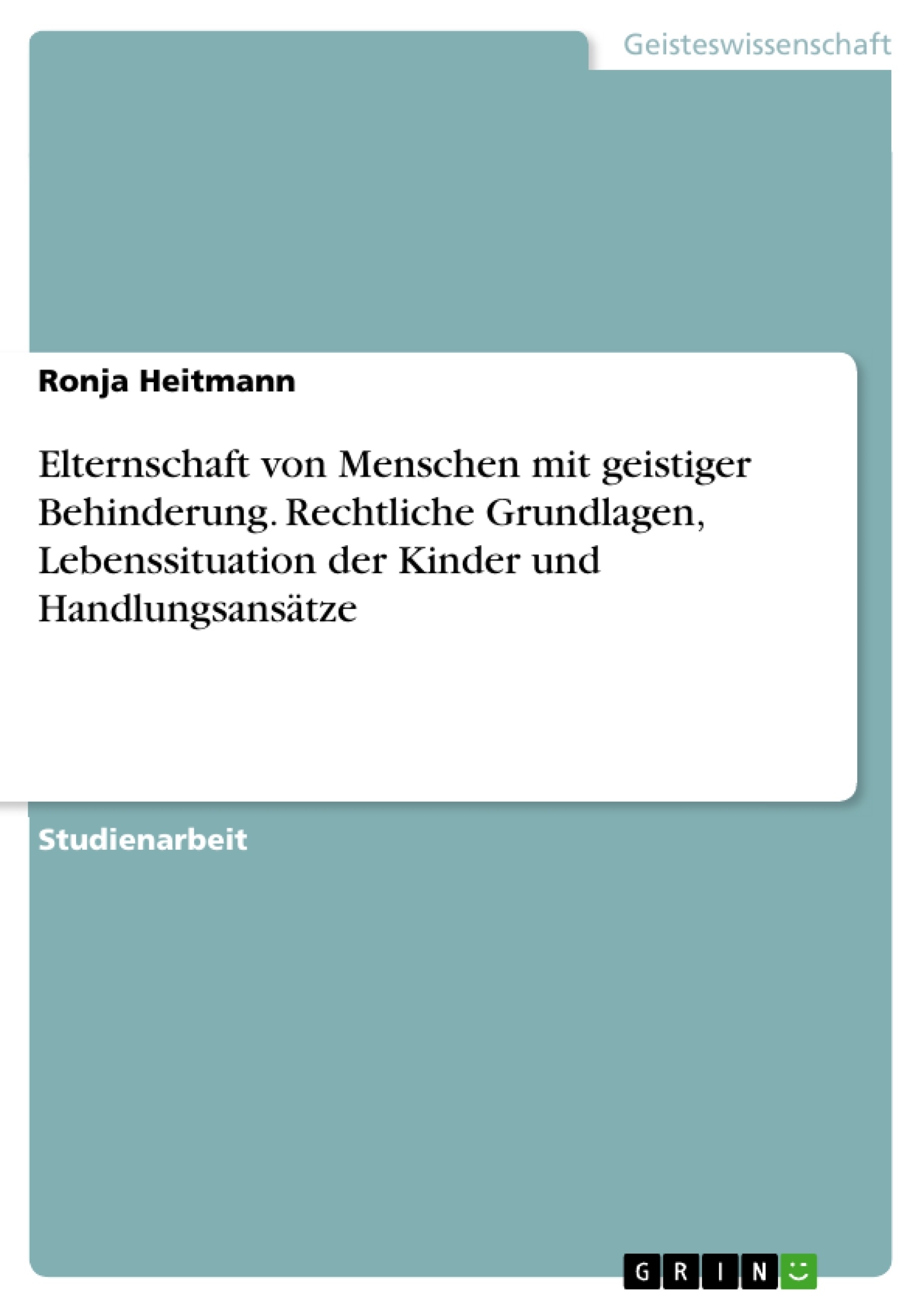Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob es ethisch vertretbar ist, Menschen mit Behinderung in ihrem Wunsch, eine Familie zu gründen, zu unterstützen. Die Hypothese lautet dabei: Menschen mit geistiger Behinderung benötigen umfassende Unterstützungsangebote, um eine gelungene Elternschaft zu ermöglichen, bei der das Kind bei der Mutter, dem Vater oder der Familie aufwachsen kann, ohne das Wohl des Kindes und der Eltern zu gefährden.
Die Hausarbeit beginnt mit der Definition des Begriffes ‚Geistige Behinderung‘ und geht weiter mit einer historischen Einordnung zur Thematik der Sterilisation von Menschen mit Behinderung. Anschließend werden die rechtlichen Grundlagen im Rahmen der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung dargestellt und der aktuelle Forschungsstand zu Kindern behinderter Eltern skizziert. Anschließend folgen mögliche Handlungsansätze für die Arbeit als Sozialarbeiter/-in.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Definition der geistigen Behinderung
- 3. Sterilisation von Menschen mit Behinderung – ein geschichtlicher Abriss
- 4. Rechtliche Grundlagen
- 4.1. UN-Behindertenkonvention
- 4.2. Grundgesetz
- 4.3. Kindeswohl
- 5. Die Lebenssituation von Kindern behinderter Eltern
- 5.1. Eigene Behinderung
- 5.2. Trennung von den Eltern
- 5.3. Vernachlässigung
- 5.4. (Sexuelle) Gewalterfahrung
- 5.5. Parentifizierung
- 5.6. Diskriminierung
- 5.7. Belastung durch das professionelle Hilfesystem
- 6. Handlungsansätze
- 6.1. Elternassistenz und begleitete Elternschaft
- 6.2. Alltagsorientiertes Konzept
- 6.3. Elterliche Sorge
- 6.3.1. Vollzeitpflege unter Beibehaltung des Sorgerechts
- 6.3.2. Entzug des Sorgerechts
- 6.4. Freigabe zur Adoption
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung und untersucht die ethische Vertretbarkeit der Unterstützung ihres Wunsches, eine Familie zu gründen. Dabei wird die Bedeutung von umfassenden Unterstützungsangeboten für eine gelungene Elternschaft beleuchtet, die das Wohl des Kindes und der Eltern gleichermaßen berücksichtigt.
- Definition und historischer Kontext der geistigen Behinderung
- Rechtliche Grundlagen der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung
- Lebenssituation von Kindern behinderter Eltern und deren Herausforderungen
- Mögliche Handlungsansätze für die Unterstützung von Menschen mit geistiger Behinderung in der Elternschaft
- Ethische Aspekte und die Frage der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor. Es wird deutlich, dass die Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung bis heute Gegenstand kontroverser Diskussionen ist. Kapitel 2 beleuchtet die Definition und den historischen Kontext der geistigen Behinderung und führt den Begriff der Intelligenzminderung nach ICD-10 ein. Kapitel 3 behandelt die problematische Geschichte der Zwangssterilisation von Menschen mit Behinderung im Nationalsozialismus.
Die Kapitel 4 und 5 beschäftigen sich mit den rechtlichen Grundlagen und der Lebenssituation von Kindern behinderter Eltern. Kapitel 4 geht auf die UN-Behindertenkonvention, das Grundgesetz und das Kindeswohl ein. Kapitel 5 skizziert die möglichen Schwierigkeiten, mit denen Kinder behinderter Eltern konfrontiert sein können, wie zum Beispiel eigene Behinderung, Trennung von den Eltern, Vernachlässigung, (sexuelle) Gewalterfahrung, Parentifizierung, Diskriminierung und Belastung durch das professionelle Hilfesystem.
Im sechsten Kapitel werden Handlungsansätze für die Arbeit als Sozialarbeiter/-in im Kontext der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung vorgestellt, darunter Elternassistenz, begleitete Elternschaft, alltagsorientierte Konzepte und die elterliche Sorge, einschließlich der Aspekte Vollzeitpflege und Entzug des Sorgerechts. Das Kapitel behandelt auch die Freigabe zur Adoption.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen der geistigen Behinderung, Elternschaft, Unterstützung, Selbstbestimmung, Inklusion, Kindeswohl, rechtliche Grundlagen, Diskriminierung, Handlungsansätze, Elternassistenz und dem professionellen Hilfesystem. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung verbunden sind, und plädiert für eine inklusive und respektvolle Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung.
- Quote paper
- Ronja Heitmann (Author), 2021, Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung. Rechtliche Grundlagen, Lebenssituation der Kinder und Handlungsansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037236