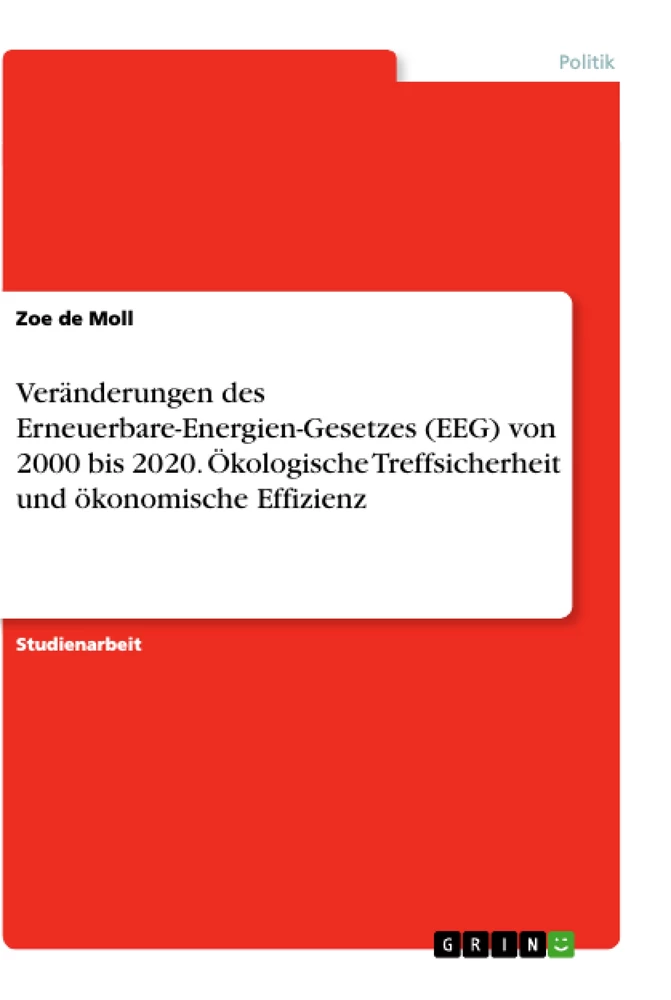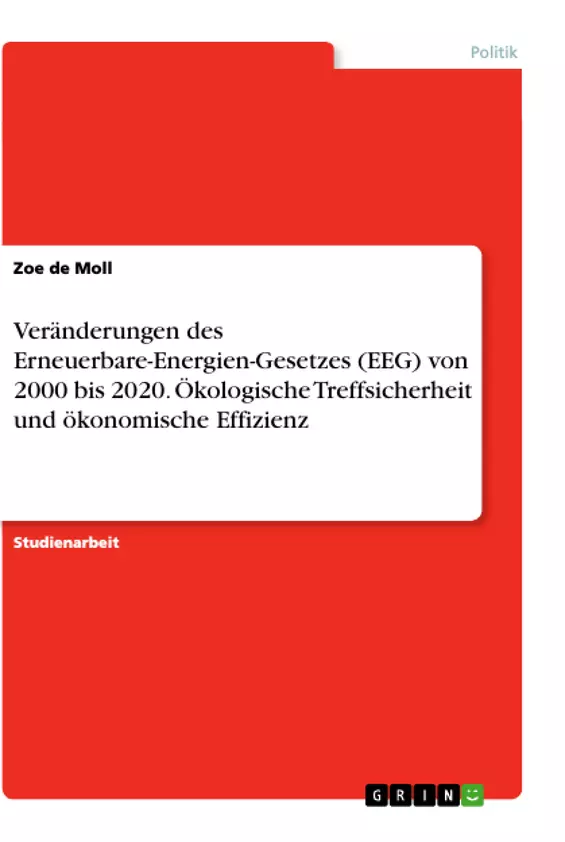Diese Hausarbeit stellt das Erneuerbare-Energien-Gesetz mit seinen Veränderungen seit der Einführung im Jahr 2000 bis 2020 dar. Dabei werden die verschiedenen Vergütungsmodelle für die Anlagenbetreiber sowie die EEG-Umlage als Mittel der Finanzierung vorgestellt. Abschließend wird der Erfolg des EEGs hinsichtlich der ökologischen Treffsicherheit (erfüllt es die gewünschte Wirkung?) und der ökonomischen Effizienz (ist dieses Modell langfristig finanzierbar und tragbar?) analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundlagen
- 1.1 Ziele des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
- 1.2 Entwicklung des Gesetzes
- 2. Vergütungsmodelle
- 2.1 Einspeisevergütung
- 2.2 Direktvermarktung und Marktprämie
- 2.3 Mieterstromzuschläge
- 2.4 Ausschreibungen
- 3. EEG-Umlage
- 3.1 Funktionsweise
- 3.2 Auswirkungen und Entwicklung
- 4. Analyse
- 4.1 Ökonomische Effizienz
- 4.2 Ökologische Treffsicherheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dessen Zielen, Entwicklung, Vergütungsmodellen und der EEG-Umlage. Die Arbeit analysiert die ökonomische Effizienz und ökologische Treffsicherheit des EEG im Hinblick auf seine Erfolgsbilanz. Der Fokus liegt auf der Darstellung der verschiedenen Anpassungen und Entwicklungen des Gesetzes seit seiner Einführung.
- Ziele des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und deren Entwicklung
- Vergütungsmodelle für Anlagenbetreiber erneuerbarer Energien
- Funktionsweise und Auswirkungen der EEG-Umlage
- Ökonomische Effizienz des EEG
- Ökologische Treffsicherheit des EEG
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Notwendigkeit der Substitution fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien und die Rolle des EEG dabei. Sie führt in die Thematik ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit, der die Darstellung der Ziele, Entwicklung, Vergütungs- und Finanzierungsmodelle des EEG umfasst, gefolgt von einer Analyse der ökonomischen Effizienz und ökologischen Treffsicherheit.
1. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Ziele des EEG dar, die eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung, den Umwelt- und Klimaschutz sowie die Schonung fossiler Ressourcen beinhalten. Es werden konkrete Ziele für den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bis 2025, 2035 und 2050 genannt. Weiterhin wird die anfängliche Problematik der höheren Kosten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Vergleich zu fossilen Energieträgern angesprochen und die Rolle der EEG-Vergütungen zur Anreizsetzung für Investitionen in erneuerbare Energien erläutert. Die Entwicklung des EEG seit dem Stromeinspeisungsgesetz von 1991 wird skizziert, wobei die Einführung der differenzierten Vergütungen nach Technologie und Anlagenleistung sowie die garantierten Netzanschlüsse und Vergütungszahlungen hervorgehoben werden.
2. Vergütungsmodelle: Dieses Kapitel beschreibt detailliert verschiedene Vergütungsmodelle des EEG, einschließlich der Einspeisevergütung, der Direktvermarktung mit Marktprämie, Mieterstromzuschlägen und Ausschreibungen. Es analysiert die Mechanismen und die Auswirkungen dieser Modelle auf den Ausbau erneuerbarer Energien.
3. EEG-Umlage: Hier wird die Funktionsweise der EEG-Umlage als Finanzierungsinstrument für die Vergütungen der Anlagenbetreiber erläutert. Die Auswirkungen und die Entwicklung der EEG-Umlage im Zeitverlauf werden detailliert beschrieben, inklusive ihrer Auswirkungen auf den Strompreis.
4. Analyse: Dieses Kapitel analysiert die ökonomische Effizienz und die ökologische Treffsicherheit des EEG. Es bewertet, inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden und welche ökonomischen und ökologischen Auswirkungen das EEG hatte. Die Analyse stützt sich auf die Entwicklungen des EE-Stroms und der EEG-Umlage.
Schlüsselwörter
Erneuerbare Energien, EEG, Einspeisevergütung, Direktvermarktung, Marktprämie, EEG-Umlage, Ökonomische Effizienz, Ökologische Treffsicherheit, Nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz, Umwelt, Stromerzeugung, Ausbau erneuerbarer Energien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe. Die Arbeit analysiert die ökonomische Effizienz und ökologische Treffsicherheit des EEG, untersucht seine Entwicklung und verschiedene Vergütungsmodelle.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ziele des EEG, seine historische Entwicklung, verschiedene Vergütungsmodelle (Einspeisevergütung, Direktvermarktung mit Marktprämie, Mieterstromzuschläge, Ausschreibungen), die Funktionsweise und Auswirkungen der EEG-Umlage sowie eine umfassende Analyse der ökonomischen Effizienz und ökologischen Treffsicherheit des Gesetzes.
Welche Ziele verfolgt das EEG?
Das EEG verfolgt Ziele einer nachhaltigen Energieversorgung, des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Schonung fossiler Ressourcen. Es definiert konkrete Ziele für den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch für verschiedene Zeiträume (z.B. 2025, 2035, 2050).
Wie funktioniert die EEG-Umlage?
Die EEG-Umlage ist ein Finanzierungsinstrument, das die Vergütungen der Anlagenbetreiber erneuerbarer Energien sichert. Die Arbeit beschreibt detailliert ihre Funktionsweise, ihre Auswirkungen auf den Strompreis und ihre Entwicklung im Zeitverlauf.
Welche Vergütungsmodelle werden im EEG verwendet?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Vergütungsmodelle, darunter die Einspeisevergütung, die Direktvermarktung mit Marktprämie, Mieterstromzuschläge und Ausschreibungen. Sie analysiert die Mechanismen und Auswirkungen dieser Modelle auf den Ausbau erneuerbarer Energien.
Wie wird die ökonomische und ökologische Effizienz des EEG bewertet?
Die Arbeit analysiert die ökonomische Effizienz und die ökologische Treffsicherheit des EEG, indem sie bewertet, inwieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden und welche ökonomischen und ökologischen Auswirkungen das Gesetz hatte. Die Analyse basiert auf der Entwicklung des EE-Stroms und der EEG-Umlage.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis des EEG?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Erneuerbare Energien, EEG, Einspeisevergütung, Direktvermarktung, Marktprämie, EEG-Umlage, Ökonomische Effizienz, Ökologische Treffsicherheit, Nachhaltige Energieversorgung, Klimaschutz, Umwelt, Stromerzeugung, Ausbau erneuerbarer Energien.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Notwendigkeit der Energiewende und die Rolle des EEG erläutert. Es folgen Kapitel zu den Grundlagen des EEG, den Vergütungsmodellen, der EEG-Umlage und einer abschließenden Analyse der Effizienz. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
- Citation du texte
- Zoe de Moll (Auteur), 2020, Veränderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 2000 bis 2020. Ökologische Treffsicherheit und ökonomische Effizienz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037532