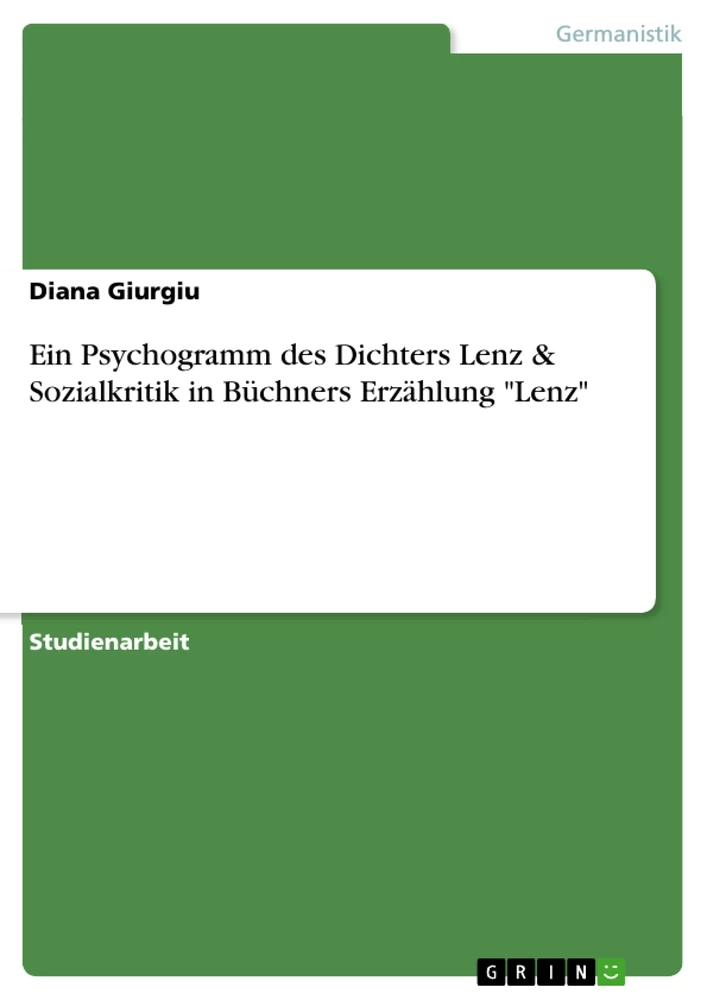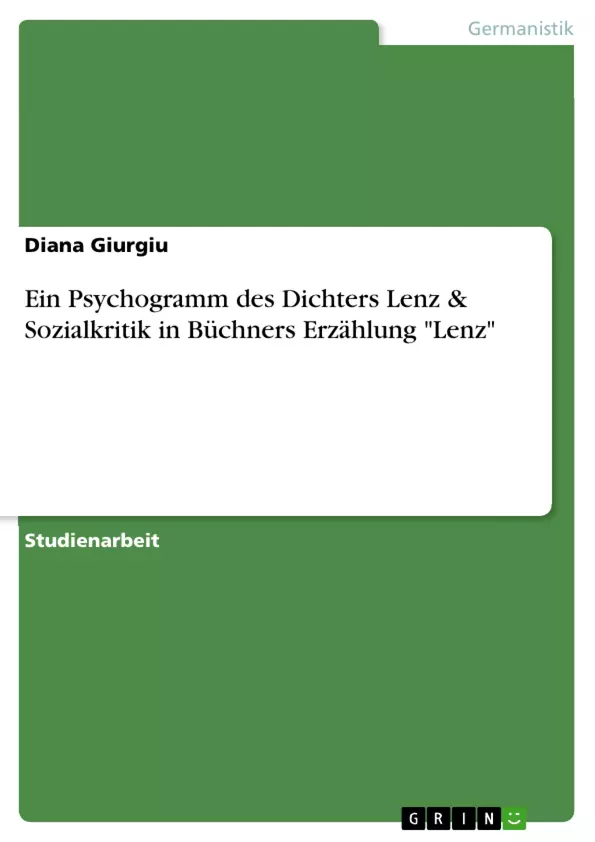Was treibt einen jungen Dichter in den Wahnsinn, und welche Abgründe der menschlichen Seele offenbaren sich in der schonungslosen Konfrontation mit der Natur, der Gesellschaft und dem eigenen Ich? Georg Büchners fragmentarische Erzählung "Lenz" ist weit mehr als die Schilderung einer psychischen Erkrankung; sie ist eine erschütternde Reise in die Innenwelt eines Sturm-und-Drang-Autors, der an den Konventionen seiner Zeit und den eigenen Ansprüchen zerbricht. Begleiten Sie Lenz auf seiner Wanderung durch das Gebirge, wo die erhabene Schönheit der Natur in quälendem Kontrast zu seinem inneren Aufruhr steht. Erleben Sie seine Zerrissenheit zwischen religiösem Trost und atheistischem Zweifel, zwischen dem Drang nach künstlerischem Ausdruck und dem lähmenden Gefühl der Sinnlosigkeit. Büchner seziert mit unglaublicher Präzision die Mechanismen des Wahnsinns und entlarvt gleichzeitig die Heuchelei und Engstirnigkeit der bürgerlichen Gesellschaft. "Lenz" ist ein zeitloses Meisterwerk der deutschen Literatur, das bis heute nichts von seiner Sprengkraft verloren hat. Tauchen Sie ein in diese faszinierende Studie über Genie und Wahnsinn, über die Grenzen der menschlichen Erkenntnis und die unstillbare Sehnsucht nach Erlösung. Entdecken Sie Büchners bahnbrechende literarische Pathographie, die eine neue Perspektive auf die Darstellung psychischer Krankheit eröffnet und bis heute nachwirkt. "Lenz" ist ein muss für alle, die sich für Literatur, Psychologie und die dunklen Seiten der menschlichen Existenz interessieren. Ergründen Sie die tiefe Bedeutung von Natur, Religion und Kunst in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs. Lassen Sie sich von Büchners ungeschönter Sprache und seinem einfühlsamen Blick auf das Leid des Einzelnen berühren. Erfahren Sie mehr über die Auseinandersetzung mit Goethe und die Kritik am Idealismus. Dies ist eine Geschichte über Krankheit, soziale Kritik, und die Suche nach Identität, die den Leser nicht unberührt lässt. Tauchen Sie ein in die Welt von J.M.R. Lenz und erleben Sie eine unvergessliche literarische Reise. Die Erzählung "Lenz" beleuchtet die inneren Kämpfe des Protagonisten, seine Beziehung zur Natur und seine Auseinandersetzung mit religiösen und künstlerischen Konventionen. Georg Büchner wirft einen kritischen Blick auf die Gesellschaft seiner Zeit und zeigt, wie individuelle Schicksale von den herrschenden Verhältnissen geprägt werden. Ein intensives Leseerlebnis, das zum Nachdenken anregt. Die Themen Wahnsinn, Naturerleben, soziale Kritik und die Rolle des Künstlers werden auf fesselnde Weise miteinander verwoben. Ein literarisches Juwel, das es zu entdecken gilt.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Lenz und Wahnsinn
2.1. J.M.R. Lenz als Sturm- und- Drang Autor
2.2. Büchners Auseinandersetzung mit Goethes Lenz
2.3. Wahnsinn als Topos
3. Krankheit
3.1. Pathographie als neues literarisches Programm
4. Natur
4.1. Büchners Naturbegriff
4.2. Natur als Rahmen der Erzählung
5. Kritik
5.1. Krankheit als Büchner´sche Form der Kritik
5.2. Kritik der Religion
5.3. Kritik der Kunst: das Kunstgespräch
5.4. Kaufmanns Moralpredigt
6. Nachwort
7. Literaturliste:
1. Vorwort
Was veranlasst Georg Büchner dazu, die Erzählung „Lenz“ niederzuschreiben? Worin besteht die Faszination der jungen Sturm- und- Drang Autors J.M.R. Lenz? Es ist bekannt, dass Büchner sowohl aus Goethes autobiographischem Werk „Dichtung und Wahrheit“ Informationen über Lenz entnommen hatte, als auch sein dichterisches Werk kannte und sich daher ein eigenes Bild des „ verrückt“ gewordenen Künstlers gemacht hatte. Das Thema des Wahnsinns ist ein ziemlich verbreitetes und variiertes Thema in der deutschen und europäischen Literatur vieler Epochen. Interessant zu beobachten ist, wie Büchner im 19. Jahrhundert dieses Thema anspricht und vor welchem Hintergrund er es verarbeitet. Er erweist sich als Bahnbrecher in der Form der literarischen Pathographie.
Weshalb stellt er den schizophrenen Lenz dar? Um möglicherweise auf dieser Art und Weise soziale Kritik zu üben? Werke Büchners, wie das Drama „Dantons Tod“, die als Fragment hinterlassene Erzählung „Lenz“, entstehen während der Straßburger Periode des politischen Exils, ein Zeitraum voller Spannungen. Diese Zeit des Umbruchs um 1800 ist Gelegenheit, sich auch mit den 1770er Jahren auseinander zu setzen. Der Poet Lenz lebt ebenfalls in einer „irre gewordenen“1 Zeit. Was auf sozialer Ebene damals und auch ein paar Jahrzehnte später, zu Büchners Zeit, vorgefallen ist, scheint den Einzelnen besonders geprägt zu haben. Dies hat sich in der Form von psychischen Störungen konkretisiert, was Büchner verständlich zu machen gelingt.
Auch wenn Büchner es nicht dazu gebracht hat, die Erzählung fertig zu schreiben, mangelt es hier nicht an Themenkomplexität: Natur, Krankheit, Ästhetik, Religion hat er einzigartig miteinander verknüpft. Das Bild der Natur in „Lenz“ ist in seiner Ruhe ständig bedroht. In der Arbeit werde ich besonders auf die Korrespondenz der Natur mit Lenzens Psyche eingehen. Der Natur hat Büchner ein zentrale Rolle zugeordnet. Aber auch Themen wie Religion der damaligen Zeit scheint er mittels seiner Figur Lenz etwas skeptisch gegenüberzustehen. An der Person des Pfarrers Oberlin wird diese Tatsache klar.Ich werde versuchen, auf dieses Verhältnis zwischen den beiden einzugehen.
Zu bewundern ist das neue Bild des unangepassten Lenz, das Büchner als Gegenbild zur Stilisierung Goethes geschaffen hat. Büchner verarbeitet Hintergründe der psychischen Labilität, wobei er über Erkenntnisse der Psychiatrie der Zeit verfügt. Nicht umsonst wird seine „naturwissenschaftlich geschulte Sehweise“2 von Gutzkow geschätzt.
Das Kunstgespräch, das ungefähr in der Mitte der Erzählung positioniert ist, ist auch im Rahmen der Kritik einzuordnen. Es wird mit dem tragischen Verlauf der Handlung darauf gedeutet, dass Lenz nicht stark genug ist und nur theoretisch eine antiidealistische Haltung vertritt. In der Praxis ist er gescheitert und es existiert im Grunde keine Hoffnung auf Rettung mehr.
2. Lenz und Wahnsinn
2.1. J.M.R. Lenz als Sturm- und- Drang Autor
Mit Sturm- und- Drang verknüpft man den Geniebegriff. In der von Kant 1790 gegebenen Definition, heißt Genie folgendes:
„Genie ist die angeborene Gemütslage (ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Re- gel gibt".1
Damit ist die schöpferische Kraft gemeint, wobei die Quelle dafür in der Natur zu finden ist. Somit ist Genie ohne Natur unvorstellbar, was auch bei Lenz der Fall ist, dieses Verhältnis aber nur selten ideal ist.
Mit der Erzählung „Lenz" möchte Büchner das unglückliche Dasein des Sturm- und- Drang Autors Jakob Michael Reinhold Lenz in Erinnerung rufen. Er knüpft mit dem Charakterzug des Wahnsinns an eine seit der Romantik vorhandene Tradition des Wahnsinnsmotivs an. Somit ist die Erinnerung an den jungen Autor zugleich Rückbesinnung auf diese literarische Epoche, es ist die Künstlerproblematik die in den Mittelpunkt rückt, „die ständige Gefährdung einer Künstlerpersönlichkeit"2 wird hier veranschaulicht.
Melancholie als Grundstimmung ist typisch für die damaligen Autoren und Figuren der Dramen. Die ganze Zeit herrscht auch in Büchners Novelle eine Melancholie geladene Atmosphäre. Trotz aller Bemühungen, sich dieser "überwältigenden Erstarrung"3 zu widersetzen, ist die Melancholie diejenige die siegt. Der ganze Kampf Lenzens im Laufe der Erzählung, ist umsonst. Schon in der Anfangsszenerie spricht etwas gegen das Konzept des starken, autonomen Genies. Lenz gelingt es zu selten, das in der Natur zu finden, was die Sturm- und- Drang Autoren fanden- nämlich Ruhe, Trost und Kraft. Lenz schafft es nur manchmal- und auch dann nicht gänzlich- eins mit der Natur zu werden. Seine Mühe um ein identitätsstiftendes Naturverhältnis gleichen einem Subjekts, das nicht mehr die Kontrolle über sein Denken und Handeln hat. In der Genieauffassung des Sturm- und- Drang wird das eigene Ich um die unendliche Dimension des kosmischen Raumes erweitert. In "Lenz" dagegen ist dies nicht der Fall:
„[...]aller Genien Wesen und Natur ist- Übernatur- Überkunst, Übergelehrsamkeit, Übertalent-Selbstleben! - Sein Weg ist immer weg des Blitzes, oder des Sturmwindes, oder des Adlers- Man staunt seinem wehenden Schweben nach! hört sein Brausen! sieht seine Herrlichkeit- aber wohin und woher weiß man nicht? und seine Fußstapfen findet man nicht."4
Ein wichtiger Punkt in der Geniegestaltung bei Büchner ist die Quelle seiner Schrift. Unter anderen Quellen, spielt Goethes "Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit"5 eine entscheidende Rolle. Hier schafft Goethe ein Bild der labilen Künstlerpersönlichkeit Lenzens, was für die spätere Rezeption bedeutend ist. Im Gegensatz zu Goethe, der Lenz als Repräsentant der Sturm- und- Drang Periode stilisiert, schafft Büchner ein komplettes, "anschauliches"6 Bild. "Lenz "ist Büchners Arbeit über den genialischen, zerrissenen, unsteten, in seinem Leben und besonders in seinem Liebesleben enttäuschten Lenz beim Übergang aus einer allgemein nervösen schizophrenen Erkrankung. Es gelingt ihm einen eigentlich bekannten Sachverhalt so darzubieten, dass er „aufleuchtet und für alle Gestalt gewinnt"1. Es ist eine einzigartige Verbindung zwischen schöner Literatur und Psychiatrie. Welche Bedeutung Lenzens Darstellung bei Goethe für Büchner hat, werde ich im folgenden näher erläutern.
2.2. Büchners Auseinandersetzung mit Goethes Lenz
Büchners neues Konzept zeigt sich in der Veränderung von Goethes Urteilen über den Autor Lenz. Goethe empfand keinesfalls Sympathie für den jüngeren Lenz in seiner „Dichtung und Wahrheit“. Er betrachtet Lenz als Außenseiter oder neutral: Lenz ist weder krank noch ein Genie, eher verrückt. So schreibt Goethe über Lenz, er sei „ein Schelm in der Einbildung“2, mit „seinen Vorstellungen und Gefühlen verfuhr er wirklich.“3 Büchner sieht das anders: Lenz „hatte einen unendlichen Trieb, mit allem um ihn im Geist willkürlich umzugehen[...], die Menschen um- und auszukleiden (...) Manchmal fühlte er einen unwiderstehlichen Drang, das Ding auszuführen, und dann schnitt er entsetzliche Fratzen.“4 So eine „Fratze“ ist zum Beispiel die Stelle, an der Lenz Oberlins Katze hypnotisiert, dass sich diese bedroht fühlt.
Goethe hat den äußeren Blickwinkel, wobei Büchner versucht, die Person für die Leser aus Innensicht verständlich zu machen. Auch wenn der Text von bis zu zwei Drittel aus Oberlins Bericht entnommen ist- er schreibt manche Stellen ab- , gibt es eine andere Stufe des Er- zählens. Büchner versucht eine Erklärung zu geben für die von Oberlin beschriebenen Störungen, wobei es ihm gelingt, ein pathetisches Gesamtbild zu schaffen. Lenz erlebt mehrere Arten seines Zustands: es sind die „seligsten Augenblicke“5 des Selbstmitleids, Angstattacken- „Augenblicke der fürchterlichsten Angst“ - , Momente der „dumpfen an´ s Nichtsein grenzenden Ruhe“ und „Augenblicke, wenn sein Gast sonst auf irgend einer wahnwitzigen Idee zu reiten schien“6 als die erfüllendsten. Es ist verblüffend, wie gut sich Büchner in der Schizophrenie auskennt. Man vermutet, dass Büchner selbst an psychischen Depressionen gelitten haben muss. Dies ist aus seinen Briefen zu erschließen. Er schreibt seiner Geliebten: „(...) Ich bin ein Automat. Die Seele ist mir genommen.“ Oder: „Ich glühte. Das Fieber bedeckte mich mit Küssen und umschlang mich wie der Arm des Geliebten. Die Finsternis wogte über mir, mein Herz schwoll in unendliche Sehnsucht(...) Ich habe nicht einmal die Wollust des Schmerzes und des Sehnens.“7 usw. Es sind Zustände die eine ähnliche Atmosphäre wie die in der „Lenz“ Erzählung wiederherstellen. Büchner gelingt nicht nur eine Introspektion des Wahnsinns, er musste wieder in die Verhältnisse des Jahres 1770 zurückfinden, vor allem zur Religion und zum politischen Dasein. Lenz, der sich Oberlins Bemühungen widersetzt, ist weder im Bericht Oberlins noch in Goethes „Dichtung und Wahrheit“ zu finden.
2.3. Wahnsinn als Topos
Wie schon erwähnt, ist die Bearbeitung des „Lenz“- Stoffes eine Rückbesinnung auf die Sturm- und- Drang- Periode samt den Topoi, die der damaligen Zeit entsprechen. Goethes „Werther“, in der tragischen Gestalt des Schreibers, der aus unglücklicher Liebe zu Lotte zu Grunde geht, galt als Vorbild. Bei Werther und bei Lenz ist eine gewisse Seelenver- wandtschaft zu verspüren. Beide Figuren haben nicht die ausreichende Kraft, um gegen die aüßeren Umstände zu kämpfen, beider Verhalten ist eher resigniert. Sie sind keine Kraftgenies wie die Helden der Sturm- und- Drang Dramen, sondern Genies ohne Kraft und ohne Entschlossenheit. Werther und Lenz sind ihren wechselnden Stimmungen widerstandslos ausgeliefert. Im Gegensatz zu Werther, der die Ablösung vom Leid im Selbstmord findet, ist Suizid für Lenz kein Fluchtweg aus der destruktiven Langeweile:
„(...) ich mag mich nicht einmal umbringen: es ist zu langweilig!“1
Die Darstellung des psychisch kranken Individuums, das sich nicht der Gesellschaft anpassen kann, ist ein verbreitetes literarisches Thema. Es tritt auf in Krisenzeiten als Erscheinen des gesellschaftlichen Umbruchs, der Umstrukturierung oder um das Menschenverständnis neu zu definieren. Diese literarische Reihe wird von Goethes „Werther“ und von Karl Philipp Moritz´ Autobiographie „Anton Reiser“ eröffnet.
Auch E.T.A. Hoffmann, Autor der Romantik, behandelt dieses Thema aber auf unter- schiedliche Art und Weise: dem Romantiker wird die Welt des Verrückten zur Realität. Die Ereignisse werden so geschildert, wie Lenz sie als Wahnsinniger subjektiv empfindet. Im Gegensatz gibt Büchner, als Realist, eine objektive Darstellung dieses Seelenzustandes. Er stellt den geisteskrank werdenden Lenz in einer ewig harmonischen Natur dar, ohne dass diese wahnsinnig wird. So entsteht ein neues Bild: der Wahnsinnige in der Natur. Der Autor Büchner kreiert eine eigene Stimmung; es ist die dichterische Verknüpfung einer leidend erregten Seele mit der sie umgebenden Natur. Büchner stüzt sich auf Traditionen, die sehr unterschiedlich sind. Als Quelle seiner Erzählung benutzt er den Bericht des Pfarrers Oberlin, der über den Krankheitsverlauf des Dichters Lenz Auskunft gibt, distanziert sich aber von der Erzählweise des Berichts, die Lenz aus der Perspektive des Aufklärers und des religiösen Christen beschreibt.
Auch in den 20er Jahren in der Zeit des Expressionismus, vor und während des ersten Weltkrieges, werden seelische Anomalien und andere Krankheiten zum dominierenden Thema. Durch Martin Walser, R.Goetz oder Thomas Bernhard erfreut sich dieses Thema in den 60er und 70er Jahren einer neuen Beliebtheit.
3. Krankheit
3.1. Pathographie als neues literarisches Programm
Als Naturwissenschaftler war Büchner sowohl mit der Psychiatrie des 19. Jahrhunderts vertraut als auch mit den Anhängern der psychischen und somatischen, der idealistischen und materialistischen Richtung. Er kannte und nutzte Goethes „Werther", Lenzens Gedichte und Dramen, Ludwig Tiecks Erzählungen. So verarbeitet er in seiner Erzählung die „Ergebnisse vorwissenschaftlicher Beobachtung, wissenschaftlicher Diagnostik und die Techniken poetischer Darstellung."2
Sowohl mit „Woyzeck“ als auch mit „Lenz“ begründet Büchner die Tradition der literarischen Studie über schizophrenes Erleben. Das Drama „Woyzeck“ setzt Oesterle mit der literarischen Gattung der „Physiologien“ in Beziehung:
„Die Literatur im ersten Drittel des 19.Jahrhunderts gelingt Vergleichbares [zur Philosophie] (...) es entsteht außerhalb der überkommenen Gattungen im Grenzgebiet zwischen Publizistik und Poesie eine neue Schreibweise, die der literarischen Physiologien.“1 Ebenfalls sieht Gutzkow „in der Fähigkeit zur Autopsie ein neues literarisches Prinzip“2. Beide literarische Gestalten gelten als „Gestörte“.
Büchners Darstellung von Gestalten und die Quellen seiner Schriftstücke sind vom medizinisch- gesellschaftskritischen Interesse, von pathographischen Absichten mitangeregt und verbunden mit Ästhetikfragen. Somit sind Lenz und Woyzeck keine „reinen“ Autopsien. Es ist mehr als ein sachlich- medizinischer Bericht was Büchner vor allem in „Lenz“ darbietet, sondern es handelt sich um eine neue Art der ästhetischen Gestaltung, einmalig in der Literatur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. „Lenz“ ist verbunden mit Fragen der Kunsttheorie, Gesellschaftskritik und medizinischen Diagnose.
Friedrich Schiller, dessen Ästhetik Büchner nicht unbedingt zustimmt (Brief an die Familie), spricht sich für eine Trennung von Ästhetik und Ethik unter Berufung auf die Physiologie. Genauso ist es auch bei Kant, der die neue Form der Physiologien verdrängt und durch die geschichtsphilosophische und idealistische Ästhetik verformt. Bei ihm ist die Anthropologie in physiologisches und pragmatisches Menschenkenntnis aufgeteilt. Die Physiologie erklärt das was die „Natur aus dem Menschen macht“3, während die pragmatische Anthropologie „was er als freihandelndes Wesen aus sich selber macht, oder machen kann und soll“4 umfaßt. Von Wichtigkeit ist hier das Naturkonzept Büchners, es sei zu berücksichtigen das Büchner sowohl den Blick des Naturwissenschaftlers als auch den des Dichters wohl geschult hatte. Was bedeutet Natur für Büchner also?
4. Natur
4.1. Büchners Naturbegriff
Büchners Auffassung von Natur ist selbstverständlich vom medizinischen Studium, das Naturwissenschaft und Dichtung/Philosophie umfasst, geprägt.
In Büchners Naturkonzept und Naturforschung, aber auch in seinem dichterischen Werk, wo es um die Natur des Menschen geht, wird der Wandel vom Verständnis der Natur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts deutlich. Schon in den Gymnasialzeiten, in dem Aufsatz „Über den Selbstmord", spricht der junge Schüler dieses Thema an. Natur manifestiert sich aber voller Widersprüchlichkeit und Mehrdeutigkeit. Der Tod des Cato Uticensis sieht Büchner als gerechtfertigt, da er dem gleichen Zwecke diente, wie sein Leben. Hier stimmt Büchner Spinoza zu, dessen Ethik beinhaltet: was „nur aus der Notwendigkeit seiner Natur existiert und nur durch sich selbst zum Handeln bestimmt wird."5
Büchner lehnt die teleologische Methode, die Methode von der Zweckmäßigkeit der Organe in Beziehung zur Umwelt, ab. Die Zweckmäßigkeit der Organismen wird von ihm unter dem
Aspekt der Harmonie in der Natur gesehen und deshalb der ästhetischen Sphäre zugeordnet. Büchner hat einen ganz neuen Standpunkt für Deutschland damit vertreten . In der Analyse des Naturbegriffs von Büchner, wird gezeigt, dass Büchner zwei verschiedene Meinungen vertritt, was abhängig ist in welchen seiner Schriften, den wissenschaftlichen oder dichterischen, das Naturkonzept vorkommt. In den Dichtungen ist es die „gesellschaft- liche[...] und kreatürliche[...] Natur des Menschen "1, Determinismus ( der Mensch als Zeuge seines fatalistischen Schicksals )2 und in den wissenschaftlichen Schriften ist es der Einfluß der idealistischen Morphologie in der Naturauffassung.
Es sind zwei unvereinbare Weltbilder die Büchner hat: des Naturwissenschaftlers und des Poeten. In „Lenz" kommt der Determinismus der Natur vor und auch die Natur als Landschaft. Diese äußere Natur hat Büchner einen wichtigen Platz in der Novelle zugeordnet. Ein Großteil der Handlung spielt sich draußen in der Natur ab- Natur gehört zur Szenerie.
4.2. Natur als Rahmen der Erzählung
Wie bereits erwähnt, wird der Natur in der Erzählung eine zentrale Rolle zugeordnet. Schon am Anfang („Den 20.Jänner ging Lenz durchs Gebirg“)3 erfährt der Lesende von Lenz und der Natur, deren Verhältnis die gesamte Erzählung bestimmt. Lenz geht durch die Natur und „bewegt sich dabei nicht in der Natur“4. Während die Natur statisch ist, befindet sich das Subjekt in Bewegung. Darauf folgt eine Naturbeschreibung:
„Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war naßkalt; das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolke, aber alles so dicht- und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump.“5
Jetzt wird der Protagonist selbst zum Erzählgegenstand. Wir erfahren von dem inneren Befinden, von dem Gefühl der seelischen Leere, was zur Langeweile führt. Jedesmal, auch im weiteren Verlauf der Handlung, besonders beim Gehen oder in der absoluten Einsamkeit, wird Lenz mit dem innerlichen Gefühl der Leere konfrontiert. Dann wird der Wunsch geäußert „auf dem Kopf gehen zu können“. Dafür gibt es mehrere Deutungen. Nicht auf dem Kopf gehen zu können bedeutet auch „sich der Welt, ihrer Gesetzmäßigkeit und Ordnung zu ergeben“ was auch an all die Begrenztheiten leiden zu müssen heißt. Paul Celan, in seiner Rede zum Büchner- Preis sieht dies folgendermaßen: „(...) wer auf dem Kopf geht, hat den Himmel als Abgrund unter sich“6. Was hat nun das für eine Bedeutung für Lenz? Dass er auf seiner Ich-Suche eine völlig andere Weltsicht hat, ist es ein Zeichen seiner schizophren wahrgenommenen Welt? Also ist es deutlich, in welcher seelischen Auffassung sich Lenz befindet. Die Rätselhaftigkeit dieses Wunsches von Lenz wird mit einer nicht definierten Suche verbunden: „(...) er suchte nach etwas, wie nach verlorenen Träumen. Aber er fand nichts.“7
Wie erscheint aber die Natur? Es ist offensichtlich, dass Natur nicht ein Ort des Gleich- gewichts und kein einheitlicher Zustand ist. Die Außenwelt ist Gegensatz, es herrscht eine Atmosphäre voller Spannungen, was auch Lenzens Zustand widerspiegelt. Lenz geht „gleichgültig weiter“1, passt sich notwendig der topographischen Gegebenheiten an. Er scheint die Naturwelt zu ignorieren. Der auktoriale Erzählstil wird von der subjektiven Sicht des Helden abgelöst, jetzt ist Lenz der Wahrnehmende. Er ist derjenige, aus dessen Perspektive geschildert wird. Die Natur erscheint für Lenz gegenwärtig so: „(...)alles so dicht, - und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer durch das Gesträuch, so träg, so plump“2. Natur und Ich sind nicht zu trennen, sie werden als sich gegenseitig bespiegelndes System vorgeführt. Das heißt, Natur ist Teil und Ausdruck des inneren Befindens von Lenz. Im folgenden Zitat kommt der unmittelbare Bezug zwischen beiden zum Ausdruck:
„(...) wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriß, und dann der Sturm verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläute heraufsummte, und am tiefen Blau ein leises Rot hinauf- klomm (...)-riß es ihm in der Brust, er stand, keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen, er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen, er dehnte sich aus und lag über der Erde, er wühlte sich in das All hinein, es war eine Lust die ihm wehe tat; (...)er stand still und legte das Haupt ins Moos und schloß die Augen halb, und dann zog es weit von ihm (...).“3
Mal bewegt sich Lenz ziellos in der Natur, mal erlebt er Momente der Ekstase, in denen er so weit weg von sich selbst ist, dass er den eigenen Körper nicht mehr fühlt. Seine Spaziergänge sind ein Hineingehen in die innere Welt, wo er nach sich selbst sucht. Er spürt die Einsamkeit des Windes, der Gebirge und der Täler:
„(...) er stand keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen (...)“ In „Lenz“ bietet somit die Natur keinen Trost- Objekt - und Subjektwelt korrespondieren miteinander; es gibt eine „Gleichstellung zwischen der Verlassenheit der Natur und der inn- eren Leere.“4
Trotz seines Zustandes, gelingt es Lenz ekstatische Erfahrung zu machen und sich im kosmischen Raum zu verlieren. Es sind Momente der Ausschaltung des Bewußtseins, so dass er nichts mehr davon weiß bis er sich wieder besinnt. Lenz wird zum Mittelpunkt einer unbändigen Natur. A. Erb sieht dies allerdings nicht als Moment der Ekstase: „(...)der kurze Augenblick der imaginären Elevation ist kein kosmischer Rausch eines den Überblick suchenden Ich, es ist viel mehr eine Fluchtbewegung von der sich rapide verkleinernden Erde.“5
Die sogenannte innere Leere ist charakteristisch für die Melancholie, die auch für den Wahn- sinn verantwortlich ist. Das wahnsinnige Genie ist ein beliebtes und immer wieder bearbei- tetes Motiv.
5. Kritik
5.1. Krankheit als Büchner´sche Form der Kritik
In „Lenz“ wird Büchners Gegenposition zur zeitgenössischen Praxis der unangepaßten und aufbegehrenden Natur deutlich. So ist der schizophrenische Krankheitszustand des jungen Lenz nicht als individueller Fall untersucht. Büchner sucht nach sozialen und psychologischen Hintergründen von Krankheit.
Die Geschichte vom Lenz im Steintal ist unter die Lupe zu nehmen. Sie ist die Auseinandersetzung Büchners mit dem Umbruch in der Gesellschaft um 1800. Indem er den Fall „Lenz“ bearbeitet, befragt mit seiner Annäherung an die historische Figur J.M.R. Lenz, welche die Möglichkeiten unter den Bedingungen einer dominierenden Väter- generation waren. Außerdem ist gerade die Zeit einer sich komplett umstrukturierenden Gesellschaft. An Themen wie Natur, Kunst und Religion wird Ideologiekritik geübt.
Die Entstehungsgeschichte von „Lenz“ ist ein wichtiger Augenblick in Bezug auf die soziale Kritik. Es ist bekannt, dass Büchner in Folge der Verteilung der Flugschrift „Der Hessische Landbote“- Schrift in der das politische Engagement zum Ausdruck kommt- nach Frankreich fliehen mußte. Diese Straßburger Zeit ist eine hektische Zeit, der Verfolgung und der Flucht: seine Bewegungsfreiheit ist begrenzt, die Kommunikation mit der Familie und den Freunden in der Heimat ist schwierig. Außerdem sind einige seiner politischen Verbündeten inhaftiert. Von da aus betrachte Büchner das politische Geschehen und kommentiert es, ohne aber aktiv sein zu können. Diese Periode des politischen Exils hat die Erzählung geprägt. Die Geschichte der Entstehung von „Lenz“ und auch von „Dantons Tod“ ist ein typisches Beispiel für die Auswirkungen der politischen, unterdrückenden Epoche auf den Werdegang des jungen Autors. Wenn man aber zurück zum „Hessischen Landboten“ kehrt und den Inhalt näher betrachtet, so kann man die Schrift, auf Grund ihrer analytischen Passagen ebenso wie der suggestiven Bildlichkeit, als Grundlage der Büchner- Texte sehen. Denn fast alle auf- tretenden Figuren werden als Individuen gezeichnet, die sich mit der politischen Wirklichkeit, den ökonomischen Widersprüchen und Entwicklungen auseinandersetzen. All diese sind Teil des „Projekts der Moderne“1 deren Dimension in sozialer Hinsicht für Büchner eine bedeutende Rolle spielt. Was also Büchner an der Biographie von Lenz reizt, ist das Nicht- Zurechtkommen mit einer Zeit die mit seiner viele Gemeinsamkeiten aufweist.
„Lenz“ ist Büchners Art, seine rebellische Natur dichterisch zum Ausdruck kommen zu lassen.
5.2. Kritik der Religion
Die Erzählung „Lenz“ nutzt Büchner als Medium atheistischer Äußerungen.
Büchners Kritik an der Religion ist zugleich Kritik am gegenwärtigen Zustand der Gesellschaft. Er übt Kritik an der religiösen Atmosphäre des Steintals. Wichtig ist, dass Lenz bei einem Pfarrer untergebracht wird. Das Verhältnis von Oberlin und Lenz ist von einer pietistischen Grundstimmung geprägt. Der Kritiker L. Büttner meinte, Lenz werde „durch den Verlust des überlieferten Glaubens in den Wahnsinn getrieben.“2 Im Steintal befindet sich nun Lenz, um mit Hilfe Oberlins wieder zu sich und seinem verlorenen Glauben zu finden. Auf der einen Seite gibt es den gastfreundlichen, offenen Oberlin, dem aber einiges an Einfühlungsvermögen mangelt. Dieser steht einem kranken Individuum gegenüber, der sich des öfteren religionskritisch äußert- meist in närrischer Form. Auf der anderen Seite gewinnt diese Konfrontation Ernst: Oberlins Mitleid wird deutlich, was auch ernst genommen wird. Dann gibt es eine Form, in der Büchner in der Erzählung gegenüber dem Pfarrer großen Respekt zeigt, was seine mystische Neigung anbetrifft: „Oberlin brach es ab, es führte ihn zu weit von seiner einfachen Art ab.“3 Er hat die Kontrolle und weiß wo die Grenze zur übertriebenen Mystik liegt, was nicht von Lenz zu behaupten ist. Auch wird Oberlin als praktischer Mensch gezeigt, wenn es sich um das Elend im Steintal handelt.
An den Stellen, wo Lenz als Religionsskeptiker gegenüber dem Seelsorger Oberlin dargestellt wird, gibt es keine Spur von Respekt zwischen den beiden mehr: „Oberlin sagte ihm, er möge sich zu Gott wenden.“1 Darauf Lenzens Antwort: „(...) da lachte er und sagte: ja, wenn ich so glücklich wäre, wie Sie, eine so unbehaglichen Zeitvertreib aufzufinden.“2 Denn in der Ansicht von Lenz ist alles im Leben nichts anders als Zeitvertreib aus Langeweile. An manchen Stellen, wie zum Beispiel im Gespräch mit Lenz, in dem er Lenz den religiös christlichen Weg im Leben empfiehlt, zeigt Oberlin zu wenig Mitgefühl. Bevor er versucht, sich ein eigenes Bild von Lenz zu machen, deutet er die Unruhe des Leidenden als Stimme des schlechten Gewissens. Lenzens Leid als Schuld darzustellen und ihn an die Macht Gottes zu erinnern, ist ein erneuter Schritt in Richtung Schizophrenie. So deutet das kalte Baden, die Bezichtigung zum Mörder und auch der Fenstersturz als Versuch des Selbstmords auf eine Verschlechterung seines seelischen Zustands. An dieser Stelle angekommen, weiß der Gastgeber keine Rat mehr und entscheidet sich für Lenzens gewaltsamen Abtransport nach Straßburg. Oberlin war bestimmt nicht der einzige Grund für Lenzens Erkrankung. Bedeutend ist auch die Vorgeschichte, die Büchners kannte.
Die streng pietistische Erziehung von Lenzens Vater war für seine Entwicklung prägend. Gerade befindet er sich auf der Flucht vor den Anforderungen seines Vaters, da begegnet er wieder einer Autorität, die im Grunde der seines Vaters ähnelt. Oberlins pädagogischer, sozialer und missionarischer Einsatz im Steintal, seine Art Bibelstellen zu zitieren sind Zeichen einer pietistischen Frömmigkeit. Ebenso weist Lenzens stilles Lesen der Bibel, der Wunsch zu predigen sowie der Erweckungsversuch auf den pietistischen Kontext.
Das Verhältnis von Lenz und der Religion ist desillusionierend. Obwohl es Momente gibt, in denen es scheint, dass Lenz zur Ruhe gekommen ist (wie die Predigt, das Lesen den Neuen Testaments) wird Lenz enttäuscht. Er erlebt einen Rückschlag. Die pietistische Ideologie wird wieder zerstört. Nach einer Phase religiöser Quälereien, nach dem mißlungenen Erweckungs- versuch kommt es zum definitiven Bruch mit der positiven Form der Religion.. Büchners Figur Lenz hofft mittels der Religion sein seelisches Gleichgewicht wieder zu finden. Aber, wie es sich offenbart, scheitert dieser Versuch. Die Kritik des Autors zielt vor allem auf die „praktische Wirkungslosigkeit“ der Religion. Lenz ist während seines Aufenthalts nicht stark genug, um über die Religion zu sich zu kommen. So bleibt zurück ein hoffnungsloser, desillusionierter Lenz. Er weist atheistische Tendenzen auf, er lehnt sich gegen die göttliche Weltordnung auf: „Lenz mußte laut lachen, und mit dem Lachen griff der Atheismus in ihn und faßte ihn ganz sicher und ruhig und fest.“3
5.3. Kritik der Kunst: das Kunstgespräch
Heftige Kritik an die Gesellschaft übt Büchner durch Kritik an der idealistischen Kunst. Im Gespräch über die Ästhetik in „Lenz“, lässt er seinen Protagonisten Partei ergreifen für eine realistische Sicht der Welt.
Kurz bevor das Gespräch beginnt, informiert Büchner. „Die idealistische Periode fing damals an, Kaufmann war ein Anhänger davon, Lenz widersprach heftig.“4 Also haben wir zwei Parteien: den Idealisten in der Person Kaufmanns und den Antiidealisten Lenz. Lenz äußert sich gegen eine idealistische Literatur, wobei er auf die bildende Kunst kommt. Er erwähnt die niederländischen Maler, die als „die einzigen fasslichen“5 für den Realismus in der Kunst stehen, wobei Kaufmann die idealistische Schönheit der Raffaelischen Madonnen und den Apoll von Belvedere nennt. Lenzens Ablehnung des Idealismus in der Kunst ist die Absage an eine Geisteshaltung, die sich auf das Soziale ausdehnt: „Dieser Idealismus ist die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur.“1 Auch wenn Lenz sich gegen eine idealistische Kunst ausspricht, scheint es, dass er dem Idealismus nur theoretisch absagt. Im praktischen Leben sieht es bei ihm ganz anders aus. Das Kunstgespräch ist eine Auseinandersetzung mit Kaufmann, wobei Lenz mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, dem Vater- Sohn Konflikt. Der Blick auf die realen Tatsachen ist von Angst kennzeichnet. Er sucht die Isolation indem er in eine irreale Welt flüchtet, da er in der Wirklichkeit mit den eigenen Problemen nicht zurecht kommt: „er hätte sich lieber so ein Plätzchen zurechgemacht, das bisschen Ruhe war ihm so kostbar.“ Dieses Sich- Zurückziehen hat idealistische Züge. Auch wenn er auf der Suche nach Geborgenheit ist, endet seine Suche negativ. Was er findet, ist eine bedrohte Geborgenheit in Oberlins Familie. Es ist nichts Reelles, nichts von Dauer und kann nur ein verlorener Traum bleiben. Lenz erscheint wie ein hilfsloses Kind ohne Zuhause: „(...) er gehörte zu ihnen, als wäre er schon längst da und niemand frug, woher er gekommen war und wohin er gehen werde.“ 2 Dieses Scheinbild der Harmonie wird gefährdet, als Oberlin sich auf die Reise in die Schweiz macht. Vor diesem Kontext der bedrohlichen Zukunft, gelangt Lenz zur Einsicht in sein Idealismus. „(...) er fühlte in einzelnen Augenblicken tief, wie er sich alles nur zurechtmache; er ging mit sich um, wie mit einem kranken Kinde.“3
Indem Lenz die Welt seinen Bedürfnissen entsprechend sieht, versucht er den Blick von seiner verzweifelten Lebenslage abzuwenden. Die von Lenz beschriebene Szene, weist idealistische Tendenzen auf. Die sprachlichen Formulierungen in der Beschreibung der beiden Mädchen sind poetisiert und nicht wirklichkeitsgetreu: „das goldne Haar“, „ so sorgsam bemüht“ ).
Dieser Teil der Erzählung ist nicht isoliert von dem restlichen Text zu interpretieren. Es handelt sich nicht bloß um ein philosophisches Gespräch zwischen Kaufmann und Lenz. Das Verhältnis von Kunst und Leben und von Leben und Praxis ist vordergründig und somit gesellschaftskritisch zu betrachten. An Lenz macht Büchner deutlich, dass es dem Menschen nicht gelingt „selbständig und unverändert die ganz große Maschine“4 zu betätigen. Er ist Teil eines Systems, das den Einzelnen steuert.
5.4. Kaufmanns Moralpredigt
Von Kaufmann sagt man, dass er beigetragen habe, „den kranken Geist von Lenz noch mehr zu verwirren."5 Aus der Biographie von Lenz weiß man, dass Lenz sich der väterlichen Autorität zu unterwerfen hatte, klar sind die Folgen dieser pietistischen Erziehung. Im Steintal taucht dann die väterliche Instanz erneut auf in der Gestalt von Kaufmann. Dieser taucht plötzlich auf und ist in Korrespondenz mit Lenzens Vater. Daher fordert er Lenz auf, nach Hause zurückzukehren, erinnert ihn somit an seine Pflichten. Lenz „verschleudre“ und „verliere"6 hier sein Leben. Doch das Ziel von Lenz ist „ein bißchen Ruhe"7 zu finden. Von hier "weg", das würde ihn "toll" machen. Kaufmanns Besuch hat negative Folgen für den labilen Lenz. Auch überredet der Besucher Oberlin, ihn in die Schweiz zu begleiten. Da weiß er ganz genau, dass Oberlins Abwesenheit nicht seinem Gast Lenz zugute kommt. Der bislang erlangte Punkt seiner psychischen Stabilität ist damit erneut ins Wanken geraten.
Seine Antwort ist nichts anderes als die Forderung nach Ruhe, eigentlich eine resignierte Haltung: „(...)Was will mein Vater? (...)Laßt mich in Ruhe!“1 Wir erfahren ja, dass er gegen Ende der Erzählung mit Gewalt abtransportiert wird.
6. Nachwort
Das Hauptziel der Arbeit sollte folgendes sein: Georg Büchner hat mit seinem „Lenz“ nicht nur eine neue Sehweise erwiesen. Er hat Themen wie Kunst, Religion, Natur aus der Perspektive des Sozialkritikers verarbeitet und diese im Zusammenhang mit dem „Riss“, der durch Lenz geht, dargestellt.
Der Schreibstil Büchners, der Identifikationen und Distanzierungsangebote enthält, erschwert die passive Lesehaltung. So gelingt Büchner das alte, von Goethe dargebotene Bild Lenzens neu zu schaffen. Der Einzelne kann sich an einzelnen Stellen mit dem kranken Lenz identifizieren. Warum sich Büchner gerade mit Lenz auseinandergesetzt hat? Vielleicht ist die „Wahlverwandtschaft“, die sein Bruder Ludwig zwischen den beiden feststellt der Grund dafür. Lenz war ihm thematisch vertraut und politisch verwandt, was Büchner in der ersten Straßburger Periode entdeckt hat. Der Text ist somit als politisches Code in die revolutionäre Praxis mit eingebunden.
Das Hauptthema, des Wahns, hat Büchner unvermittelt neben die Natur gestellt.
Auch wenn die Natur als Schauplatz erscheint, korrespondiert sie mit Lenz. Manchmal scheint sogar die Natur vom Wahnsinn beeinflusst zu sein. Dem Wahnsinn verfällt nicht nur Lenz als individuelles Wesen, es ist eine ganze Gesellschaft davon betroffen, vor allem die jungen Leute, die sich mit der alten Generation in Konflikt befinden. Die neue Zeit Büchners ist undurchschaubar und daher verwirrend. Das erklärt vielleicht auch, warum der Begriff der Schizophrenie etwa 1908 eingeführt wird.2
Der unheimliche Verlust des Geistes in der Erzählung widerspiegelt die Stimmung der Zeit. Der Verrückten wird in Rapport mit den entsprechenden Stimmungen der Natur gesetzt.
7. Literaturliste:
- Georg Büchner, „Werke und Briefe“, Münchener Ausgabe, Hrsg. K. Pörnbacher, G. Schaub u.a. , dtv , 7.Auflage, München 1999
- Georg Büchner 1813-1837, „Revolutionär, Dichter, Wissenschaftler", Katalog der Ausstellung Mathildenhöhe, Darmstadt, 2 August bis 27. September 1987. Basel, Frankfurt am Main: Roter Stern /Stroemfeld 1987
- Georg Büchner, „Lenz“, Philipp Reclam jun. Stuttgart, 1998
- Georg Büchner, „Lenz", Richard Thieberger, Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur, Moritz Diesterweg Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, München 2. Auflage 1986
- Niccolini Elisabetta, „Der Spaziergang des Schriftstellers", „Lenz" von G. Büchner, „Der Spaziergang" von R. Walser, „Gehen" von Th. Bernhard; Verlag J.B. Metzler, Stuttgart, Weimar, 2000
- G. Büchner „Lenz", Suhrkamp Basis Bibliothek 4, neu hrsg.,kommentiert und mit zahlreichen Materialien versehen von Burghard Dedner, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1998
- G. Büchner „Lenz. Eine Erzählung", interpretiert von Andreas Erb, Oldenbourg Interpretationen. Band 57, Hrsg. von K.-M. Bogdal und C. Kammler, R. Oldenbourg Verlag GmbH, München 1997
- G. Büchner Jahrbuch 8 (1990-1994), Aufsatz: Büchners „Lenz“: Rekonstruktion der Textgenese, Dedner Burghard, Aufsatz „ Die idealistische Periode und ihre Konsequenzen“, Andreas Pilger, Niemeyer Verlag, Tübingen 1995
[...]
1 Lenz. Eine Erzählung.A. Erb, Oldenbourg, S.14, Aus G. Herwegh, „Zum Andenken an G. Büchner, dem Verfasser von Dantons Tod (1841)
2 Werke und Briefe,S 686
1 vgl.A Erb, Lenz. Eine Erzählung., Oldenbourg
2 Niccolini E.,Der Spaziergang des Schriftstellers, S. 69
3 Niccolini E., Der Spaziergang des Schriftstellers, S. 93
4 A. Erb, Lenz. Eine Erzählung, Oldenbourg,S.77
5 vgl. Kap.11, 14, „Dichtung und Wahrheit“, J.W. Goethe
6 Niccolini E., Der Spaziergang des Schriftstellers, S.71
1 Dedner B. , Suhrkamp Basisbibliothek 4, S. 119
2 Dedner B. , Suhrkamp Basisbibliothek 4,S. 80,Aus:J.W. Goethe: Dichtung und Wahrheit. Dritter Theil. Vierzehntes Buch, in Goethes Werke. vollst. Ausgabe letzter Hand. Bd XXVI, Stuttgart und Tübingen 1829, S.247-253
3 Dedner B. , Suhrkamp Basisbibliothek 4, S.80
4 Lenz., S.31
5 Lenz, S.32
6 Lenz, S.33
7 Werke und Briefe, Briefe von Büchner, S 288-289
1 Lenz, S. 27
2 A. Erb, Lenz. Eine Erzählung. Oldenbourg
1 Werke und Briefe, S. 686
2 Werke und Briefe, Über Schädelnerven, S. 686
3 Werke und Briefe, Über Schädelnerven, S. 697
4 Werke und Briefe, Schriften aus der Gymnasialzeit, S. 36
5 Werke und Briefe, Über Schädelnerven, S. 699
1 Werke und Briefe, S. 701
2 der Determinismus in "Woyzeck" und "Lenz"
3 Lenz. S.3
4 A. Erb, Lenz. Eine Erzählung. Oldenbourg, S.47
5 Lenz.S.4
6 Niccolini E.,Der Spaziergang des Schriftstellers. S75
7 Lenz. S.3
1 Lenz. S.3
2 Lenz. S.4
3 Lenz. S.4
4 A. Erb, Lenz. Eine erzählung, Oldenbourg, S.49
5 A. Erb, Lenz .Eine Erzählung Oldenbourg, S.77
1 A. Erb, Lenz. Eine Erzählung, Oldenbourg, S. 14
2 Georg Büchner Jahrbuch 8,( 1990-1994), Aufsatz von Dedner Burghard
3 Lenz, S.27
1 Lenz, S. 27
2 Lenz, S.27
3 Lenz. S.25
4 Lenz, S.14
5 Lenz, S.16
1 Lenz, S.14
2 Lenz, S. 14
3 Lenz, S. 18
4 A. Erb, Lenz. Eine Erzählung, Oldenbourg, S. 69
5 Lenz. R.Thieberger.S.24
6 Lenz. S.14
7 Lenz .S. 17
1 Lenz. S.17
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses in diesem Text?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Kapitel: Vorwort, Lenz und Wahnsinn (mit Unterpunkten zu J.M.R. Lenz als Sturm- und Drang Autor, Büchners Auseinandersetzung mit Goethes Lenz, und Wahnsinn als Topos), Krankheit (mit Pathographie als literarisches Programm), Natur (mit Büchners Naturbegriff und Natur als Rahmen der Erzählung), Kritik (mit Unterpunkten zu Krankheit als Büchner'sche Form der Kritik, Kritik der Religion, Kritik der Kunst: das Kunstgespräch, und Kaufmanns Moralpredigt), Nachwort, und Literaturliste.
Was sind die Hauptthemen im Vorwort?
Das Vorwort behandelt die Faszination Georg Büchners für J.M.R. Lenz, die Auseinandersetzung mit dem Thema Wahnsinn, Büchners Rolle als Bahnbrecher der literarischen Pathographie, die Möglichkeit sozialer Kritik durch die Darstellung des schizophrenen Lenz, und die Verknüpfung von Natur, Krankheit, Ästhetik und Religion in der Erzählung.
Welche Aspekte von J.M.R. Lenz werden im Kapitel "Lenz und Wahnsinn" betrachtet?
Das Kapitel untersucht Lenz als Sturm- und Drang Autor, Büchners Auseinandersetzung mit Goethes Darstellung von Lenz, und die Verwendung von Wahnsinn als Topos. Es wird auch Lenzens Beziehung zur Natur und seine psychische Verfassung analysiert.
Was wird unter "Krankheit" als neuem literarischen Programm verstanden?
Der Text geht auf die Entwicklung der Pathographie als literarisches Programm ein, wobei Büchner als Begründer der literarischen Studie über schizophrenes Erleben gilt. Es wird auch die Verbindung von medizinisch-gesellschaftskritischem Interesse, pathographischen Absichten und ästhetischen Fragen diskutiert.
Welche Bedeutung hat die Natur in Büchners Erzählung "Lenz"?
Die Natur spielt eine zentrale Rolle als Rahmen der Erzählung und korrespondiert mit Lenzens Psyche. Büchner ordnet der Natur eine zentrale Rolle zu, wobei er die Korrespondenz zwischen Natur und Lenzens psychischem Zustand untersucht. Auch wird sein Naturbegriff erörtert.
Welche Formen der Kritik werden in der Erzählung "Lenz" dargestellt?
Der Text analysiert Krankheit als Büchner'sche Form der Kritik, die Kritik der Religion (insbesondere das Verhältnis von Lenz und Pfarrer Oberlin), die Kritik der Kunst (insbesondere das Kunstgespräch) und Kaufmanns Moralpredigt als Ausdruck gesellschaftlicher Normen.
Was wird im Nachwort zusammengefasst?
Das Nachwort fasst die Hauptziele der Arbeit zusammen: Büchners neue Sehweise, die Verarbeitung von Themen wie Kunst, Religion und Natur aus der Perspektive des Sozialkritikers und die Darstellung dieser Themen im Zusammenhang mit Lenzens "Riss". Es wird auch die Identifikationsangebote des Schreibstils Büchners hervorgehoben.
Was beinhaltet die Literaturliste?
Die Literaturliste enthält Werke von und über Georg Büchner, insbesondere Ausgaben von "Lenz", sowie Sekundärliteratur, die sich mit der Erzählung und Büchners Werk auseinandersetzt.
- Citar trabajo
- Diana Giurgiu (Autor), 2001, Ein Psychogramm des Dichters Lenz & Sozialkritik in Büchners Erzählung "Lenz", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103759