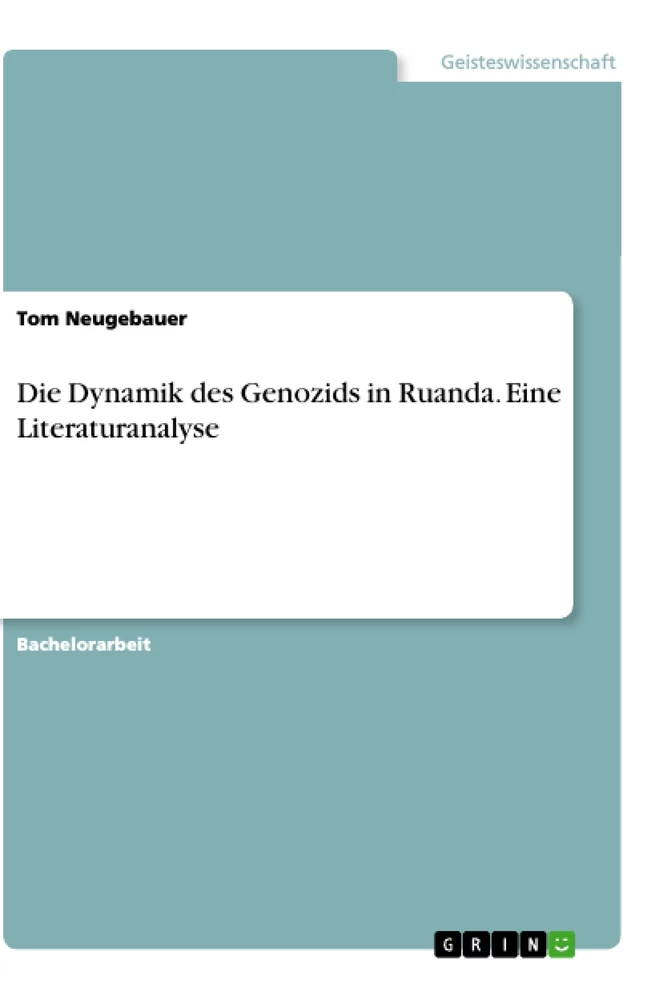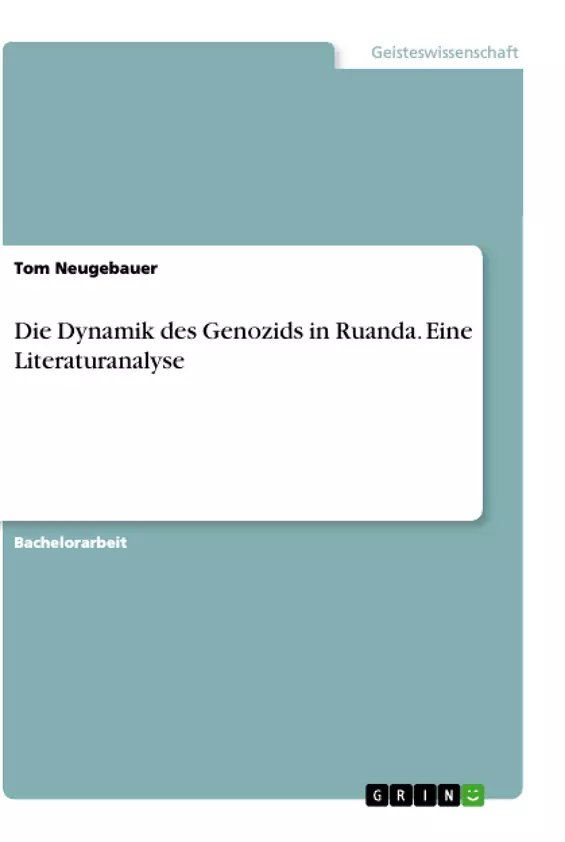Diese Arbeit befasst sich mit dem Genozid an der ruandischen Bevölkerungsminderheit Tutsi und den gemäßigten Hutu in den 1990er Jahren und untersucht, inwiefern sich bestimmte Ansätze aus der Soziologie beziehungsweise der Sozialpsychologie als Erklärungsversuch für die stattgefundenen Gewaltakte in der bisherigen Forschung über den Völkermord wiederfinden lassen. Mit Hilfe der gewählten Theoreme soll der zu behandelnde Sachverhalt so wissenschaftlich analysiert, etwaige Ursachen und begünstigende Faktoren herausgearbeitet und damit anschließend verdeutlicht werden, ob und in welchem Maße die verwendeten Thesen in der Lage sind, kollektive Gewalt an einem empirischen Beispiel zu erklären.
Ethnische Konflikte und Gewaltakte gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen finden leider auch in der heutigen Zeit noch statt. Unterschiedliche Beispiele zeigen, dass das Phänomen des Genozids als durchaus zeitgemäß betrachtet werden sollte. Immer wieder haben die vereinten Nationen Warnungen vor potenziellen Völkermorden in unterschiedlichen Ländern herausgegeben. Nach dem Ausbruch eines religiös motivierten Bürgerkriegs zwischen christlichen und muslimischen Milizen in der zentralafrikanischen Republik im Jahr 2013 wurde die humanitäre Lage im Land, vier Jahre darauf, seitens der UNO als äußerst prekär eingestuft. Auch für den Südsudan gab die UN aufgrund eines bis 2018 andauernden Bürgerkriegs entsprechende Warnungen heraus. Ein politischer Machtkampf hat sich dort zu einem Konflikt zwischen Bevölkerungsgruppen entwickelt und so zehntausende Opfer gefordert. Im April 2019 wurde 25 Jahre nach Beginn des Völkermords in Ruanda weltweit an die im ostafrikanischen Binnenstaat stattgefundene Massengewalt erinnert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Mikrosoziologie der Gewalt: Handlungstheoretische Grundlagen
- 2.1 Emotionale Energie
- 2.2 Der Tunnel der Gewalt
- 2.3 Die Vorwärtspanik in Gruppen
- 3 Die Theorie der sozialen Identität
- 3.1 Das Minimalgruppen-Paradigma
- 3.2 Identitätstheoretische Grundlagen
- 3.3 Die (Wieder-)Herstellung eines positiven Gruppenbildes
- 3.4 Enthumanisierung
- 4 Der Genozid
- 4.1 Hintergründe
- 4.2 Gewalt- und Tötungsformen
- 5 Analyse
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Genozid an der ruandischen Bevölkerungsminderheit Tutsi und den gemäßigten Hutu in den 1990er Jahren. Sie untersucht, inwiefern sich Ansätze aus der Soziologie und Sozialpsychologie als Erklärungsversuch für die stattgefundenen Gewaltakte in der Forschung über den Völkermord wiederfinden lassen. Dabei soll der Sachverhalt wissenschaftlich analysiert werden, um Ursachen und begünstigende Faktoren herauszuarbeiten und zu beleuchten, ob und inwiefern die verwendeten Thesen kollektive Gewalt erklären können.
- Die Rolle von Emotionen und Gruppendynamiken bei der Eskalation von Gewalt
- Die Bedeutung der sozialen Identitätstheorie für das Verständnis von Intergruppenkonflikten
- Die Mechanismen der Enthumanisierung und ihre Auswirkungen auf das Verhalten von Tätern
- Die Rolle der Mikrosoziologie von Randall Collins bei der Analyse von Gewaltsituationen
- Die Bedeutung von Vorwärtspaniken in der Entstehung und Eskalation von Massengewalt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik des Genozids in Ruanda und den wissenschaftlichen Hintergrund der Untersuchung dar. Sie erläutert die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage, die im Zentrum der Analyse steht.
- Kapitel 2: Die Mikrosoziologie der Gewalt: Dieses Kapitel befasst sich mit den Handlungstheoretischen Grundlagen der Gewalt, insbesondere mit der emotionalen Energie, dem Tunnel der Gewalt und der Vorwärtspanik in Gruppen.
- Kapitel 3: Die Theorie der sozialen Identität: Dieses Kapitel behandelt die soziale Identitätstheorie von Henri Tajfel und John C. Turner, inklusive des Minimalgruppen-Paradigmas, den identitätstheoretischen Grundlagen, der (Wieder-)Herstellung eines positiven Gruppenbildes und der Enthumanisierung.
- Kapitel 4: Der Genozid: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Hintergründe des Genozids in Ruanda und die Formen der Gewalt und Tötung, die während des Völkermords eingesetzt wurden.
Schlüsselwörter
Genozid, Ruanda, soziale Identität, Mikrosoziologie, Gewalt, Enthumanisierung, Intergruppenkonflikt, Vorwärtspanik, Emotionale Energie, Handlungstheorie, Identitätstheorie, Minimalgruppen-Paradigma, Randall Collins, Henri Tajfel, John C. Turner.
- Quote paper
- Tom Neugebauer (Author), 2020, Die Dynamik des Genozids in Ruanda. Eine Literaturanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037754