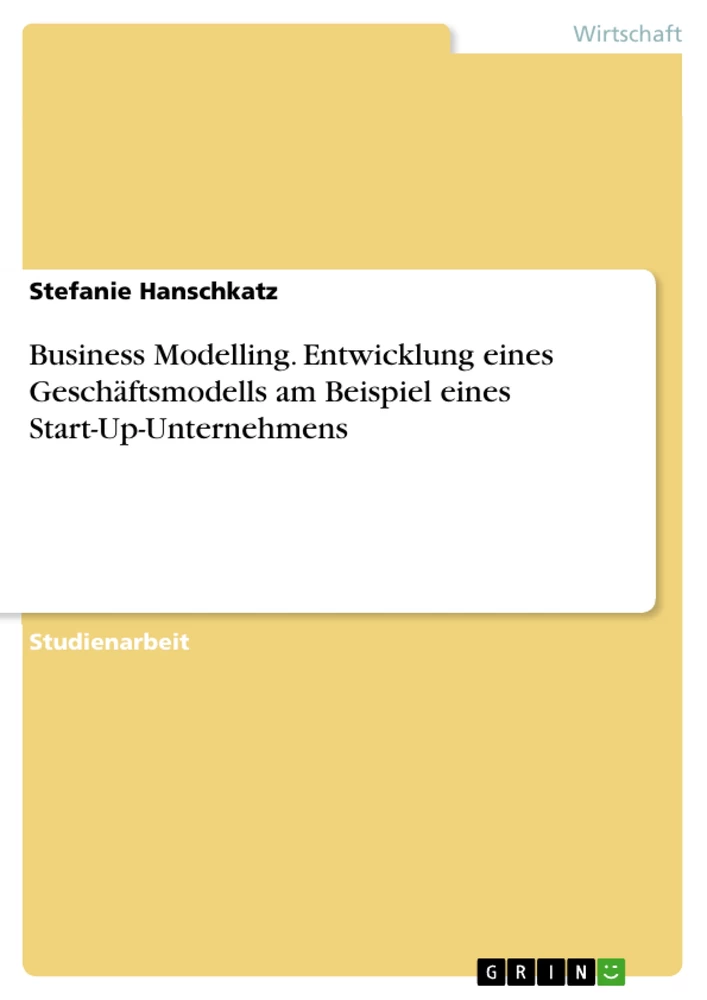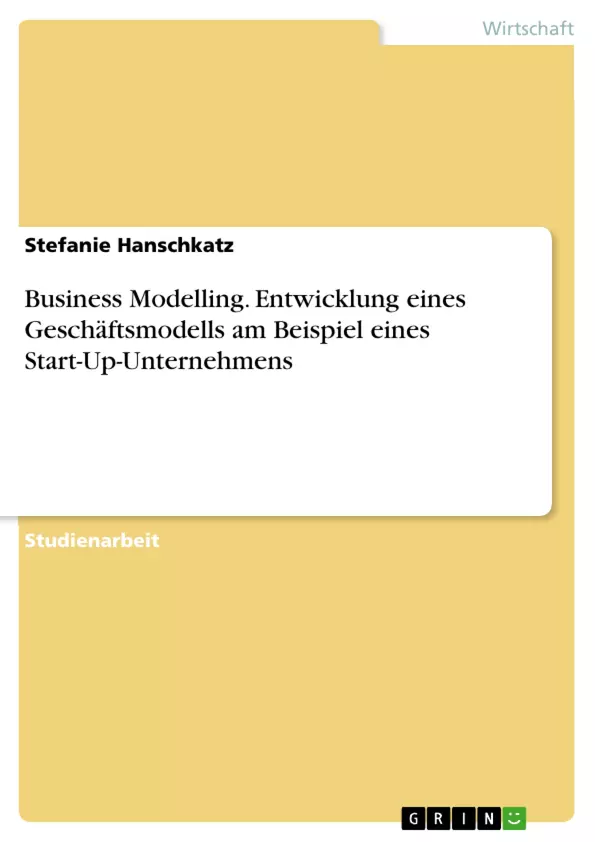Wie kann aus einer Idee ein funktionierendes Geschäftsmodell entwickelt werden? Dieser Frage soll die Arbeit nachgehen. Hierzu soll ein Prozess für Gründer beschrieben werden, der anhand einer Roadmap Meilensteine aufzeigt. Dazu sollen auch klassische betriebswirtschaftliche Instrumente genutzt und mit aktuellen Methoden kombiniert werden. Der praktische Transfer am Beispiel eines Start-Up-Unternehmens auf Malta zeigt dabei die Umsetzung der Geschäftsmodellentwicklung auf. Hier gilt es Zielmarktbesonderheiten zu untersuchen und in der Modellentwicklung einfließen zu lassen.
Für das Jahr 2018 meldete die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 70.000 Start-Ups in Deutschland. Start-Ups liegen im Trend, so ist auch der Anstieg um 10.000 Gründungen von 2017 zu 2018 zu erklären. Die Grundlage zu diesen Gründungen sollte ein Geschäftsmodell sein, welches die Frage beantwortet, wie das junge Unternehmen profitabel einen Kundennutzen stiftet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung von Geschäftsmodellen für Start-Ups
- Begriffsdefinition Start-Up
- Aufbau von Geschäftsmodellen
- Gründung eines Start-Ups
- Ideengewinnung
- Visionsentwicklung
- Best Practice
- Prototyp
- Entwicklung des Geschäftsmodells
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Geschäftsmodells für ein Start-Up-Unternehmen. Sie soll einen Prozess für Gründer beschreiben, der anhand einer Roadmap Meilensteine aufzeigt. Dabei werden klassische betriebswirtschaftliche Instrumente mit aktuellen Methoden kombiniert.
- Definition des Begriffs "Start-Up"
- Entwicklung eines Geschäftsmodells
- Die Bedeutung von Innovation für Start-Ups
- Die Rolle von Investoren und Finanzierungsquellen
- Der praktische Transfer am Beispiel eines Start-Up-Unternehmens auf Malta
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und erläutert die Relevanz von Geschäftsmodellen für Start-Ups. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe "Start-Up" und "Geschäftsmodell" definiert und verschiedene Definitionen im wissenschaftlichen Kontext vorgestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Phasen der Gründung eines Start-Ups, darunter die Ideengewinnung, die Visionsentwicklung und die Entwicklung des Geschäftsmodells.
Schlüsselwörter
Start-Up, Geschäftsmodell, Innovation, Gründung, Investoren, Finanzierungsquellen, Malta, Zielmarktbesonderheiten, Geschäftsmodellentwicklung
- Arbeit zitieren
- Stefanie Hanschkatz (Autor:in), 2021, Business Modelling. Entwicklung eines Geschäftsmodells am Beispiel eines Start-Up-Unternehmens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1038028