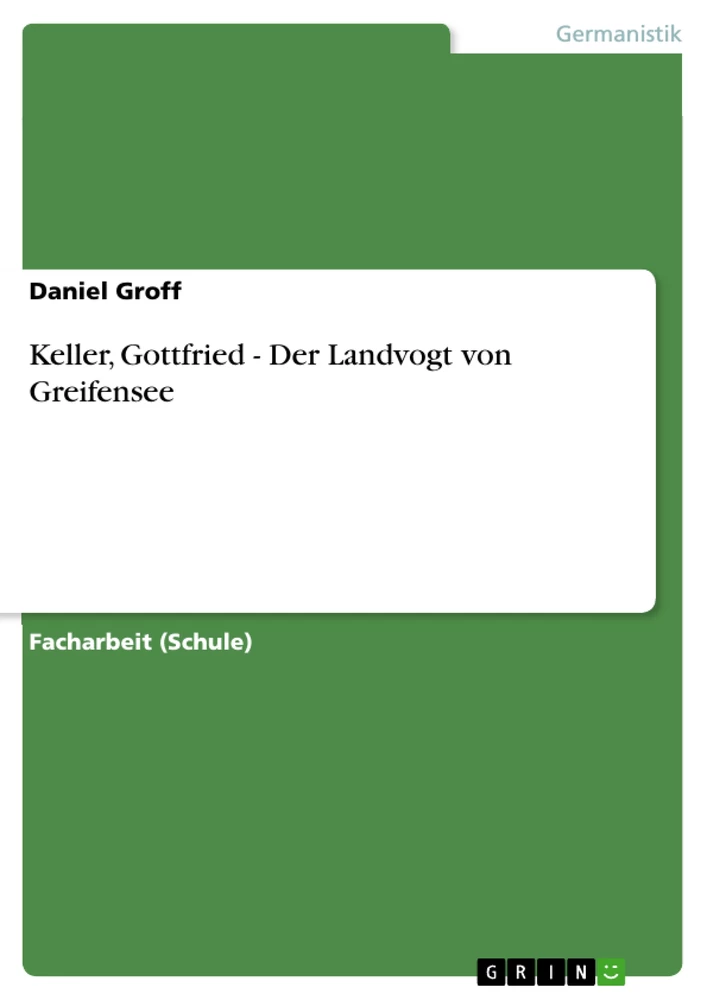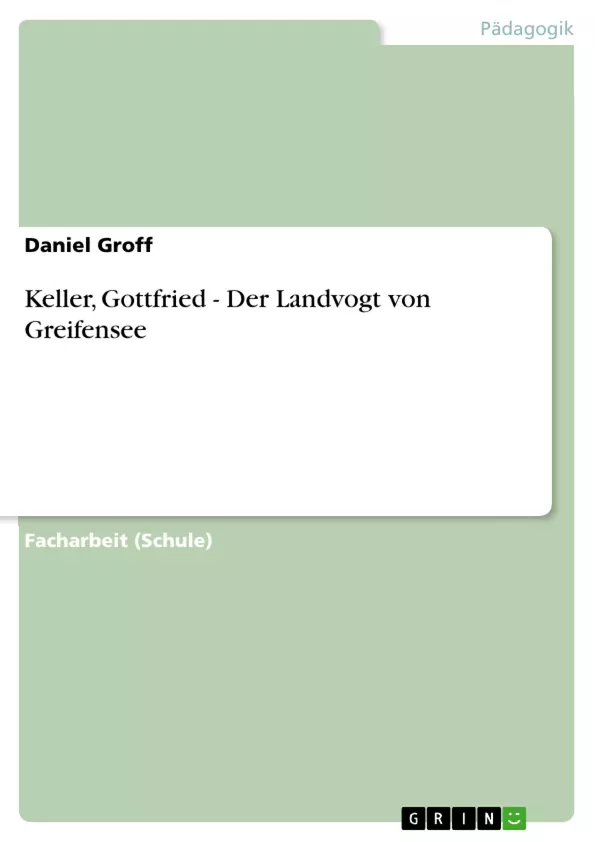Was bedeutet es, wirklich geliebt zu haben, und wie prägt diese Erfahrung ein ganzes Leben? Tauchen Sie ein in Gottfried Kellers Züricher Novellen, eine Sammlung von fünf meisterhaft verwobenen Erzählungen, die im Herzen Zürichs angesiedelt sind und ein Panorama menschlicher Beziehungen entfalten. Im Zentrum steht Salomon Landolt, der Landvogt von Greifensee, ein Mann von Welt, der in seinen besten Jahren auf eine Reihe unkonventioneller Liebschaften zurückblickt. Jede dieser Begegnungen, ob mit der feinsinnigen Salome, dem geistreichen Hanswurstel Figura Leu, der pragmatischen Wendelgard, der künstlerischen Barbara oder der anmutigen Aglaja, hat ihn auf ihre Weise geformt. Doch was geschieht, wenn diese fünf einst begehrten Frauen unerwartet zusammenkommen? Keller verwebt gekonnt die Themen Liebe, Ehe, Kunst und Bürgertum und entwirft ein fein gezeichnetes Bild der Gesellschaft im Wandel. Die Novellen, eingebettet in eine Rahmenhandlung, die die Erziehung des jungen Jacques zum Ziel hat, spiegeln Kellers eigene Auseinandersetzung mit diesen zentralen Lebensfragen wider. Entdecken Sie, wie Keller, ein Meister des Realismus, Satire und Ironie einsetzt, um die Leser zum Nachdenken über ihre eigenen Werte und Beziehungen anzuregen. Erleben Sie, wie Salomon, zwischen den Anforderungen seines Amtes und den Sehnsüchten seines Herzens, seinen inneren Frieden findet. Lassen Sie sich von Kellers detailreichen Schilderungen des Zürcher Lebens, von mittelalterlichen Szenen bis ins 19. Jahrhundert, in eine vergangene Welt entführen. Die Züricher Novellen sind nicht nur eine Sammlung von Geschichten, sondern eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den grossen Fragen des Lebens, erzählt mit dem unverkennbaren Charme und der Weisheit Gottfried Kellers, einem der bedeutendsten Schweizer Dichter und Realisten des 19. Jahrhunderts. Eine zeitlose Lektüre, die auch heute noch relevant ist und zum Nachdenken anregt.
Inhaltsverzeichnis
Biographie, Gottfried Keller
Stil, Realismus
Das Buch
Züricher Novellen
Kurzzusammenfassung
Personenerläuterung und Interpretation
Salome, der Distelfink
Figura, der Hanswurstel
Wendelgard, der Kapitän
Barbara, die Grasmücke
Aglaja, die Amsel
Salomon
Gesamtinterpretation
Schlusswort
Quellenverzeichnis
Biographie:
Gottfried Keller
Gottfried Keller wurde am 19. Juli 1819 als Sohn eines Drechslers in Zürich geboren. Nach dem frühen Tod seines Vaters, lebte die Familie in ärmlichen Verhältnissen. 1834 wurde Keller wegen eines Jugendstreiches von der Industriellen Schule verwiesen worauf er Malunterricht nahm. Sechs Jahre später ging er nach München um Landschaftsmaler zu studieren, brach das Studium jedoch nach zweieinhalb Jahre ab, da er das scheitern seiner Künstlerkarriere als Maler erkannte. Schnell bemerkte Keller, das seine Fähigkeiten im schriftstellerischen Bereich liegen. Die Veröffentlichung seiner ersten Gedichtsammlung war es dann auch, die im zu einem Stipendium in Zürich, Heidelberg und später in Berlin verhalf, wo er Geschichte, Philosophie und Literatur studierte. 1855 kehrte Gottfried Keller nach Zürich zurück. Mit dem Vorsatz dramatisch zu schreiben, verfiel er spätestens bei seinen autobiographischen Romanen, dem Realismus. Zu dieser Zeit konnte er aber noch nicht von seinen literarischen Arbeiten leben. Unter anderem litt er auch unter Depressionen, die durch seine Kleinwüchsigkeit noch verstärkt wurde. 1861 wurde Keller zum ersten Staatsschreiber des Kantons Zürich ernannt, wodurch seine dichterische Arbeit bis zu seinem Rücktritt 1876 in den Hintergrund trat.
Im Alter pflegte der Realist Brieffreundschaften mit Persönlichkeiten wie Storm oder Heyse und gewann an wachsender Anerkennung.
Keller gehört mit Fontane, Raab und Storm zu den grössten Schriftstellern des Realismus im deutschsprachigen Raum. Charakteristisch für den Meister der Novelle ist sicherlich auch sein Hang zur Satire und Ironie wie auch sein Humor und das Erzieherische in seinen Erzählungen.
1869 erhielt Gottfried Keller den Ehrendoktortitel der Universität Zürich. Einundzwanzig Jahre später, am 15.7.1890, stirbt der Realist in Zürich. Daraufhin ordnete die Stadt am 18.7.1890 die bis heute grösste Trauerfeier an.
Kurz nach Kellers Tod, veröffentlichte der Theaterleiter und Kritiker Otto Brahm ein Nachruf auf den Schweizer Dichter.:
„Schweizer war Gottfried Keller, und in der Schweiz wurde sein Sein und Dichten ganz: der treuste Sohn der Heimat, der eifrige Staatsschreiber von Zürich stand als Poet auch auf dem Boden seines Landes mit beiden Füssen. Die beste Kraft sog er aus ihm.“ [...]“Aber über diese Muster hinauf stieg Keller zu den besten und grössten aller Zeiten: zu Shakespeare, zu Goethe; und in einer goetheschen Prosa dichtete er sein Meisterstück: „Romeo und Julia auf dem Dorfe.“
Stil:
Drama:
Keller wollte „dramatisch“ schreiben. Dramas sind Tragödien, die in Theaterform geschrieben werden.
Realismus:
Den Schreibstill, in den man Gottfried Keller einstuft, nennt man poetischer Realismus. Doch was ist Realismus?
Realismus: (m., nur Sg.) 1 Lehre von einer Wirklichkeit ausserhalb des menschlichen Bewusstseins 2 ... (Das deutsche Wörterbuch)
Realismus stammt vom lateinischen Begriff res, was soviel wie Sache bedeutet. ( Sachbezug als Programm einer gesamteuropäischen Literaturbewegung) Diese Schreibweise ordnet man in die Zeitspanne von 1848, dem scheitern der Revolution, bis zum Ende der Bismarckpolitik.
In der Novelle wird Realismus auch als „Schwester des Dramas“ bezeichnet. Dafür typisch sind Rahmenerzählungen, historische Rückgriffe oder Erziehungs- und Entwicklungsromane als Spiegel der Gesellschaft. Im Mittelpunkt steht der bürgerliche Alltag, wie es auch Keller verwendet. Der Schriftsteller versucht möglichst wirklichkeitsgetreu und mit genauen Zustandsbeschreibungen seine Geschichten zu schreiben.
Das Buch:
Züricher Novellen
„Der Landvogt von Greifensee“ wurde 1878 innerhalb des Zyklus der Züricher Novellen veröffentlicht. Zu diesen Erzählungen zählen fünf Novellen, die in einer Rahmenhandlung miteinander verbunden sind. „Hadlaub“, „Der Narr auf Manegg“ und „Der Landvogt von Greifensee“ bilden den ersten, wichtigen Teil der Züricher Novellen. Ferner schliessen die Erzählungen „Das Fähnlein der sieben Aufrechten“ und „Ursula“ den Zyklus, der in der Rahmenhandlung die Erziehung eines jungen Mannes übernimmt. Jacques, ein junger
Zürcher, wird von seinem Paten mittels dieser Erzählungen erzogen, wobei Keller jeder Novelle eine bestimmte Aufgabe zuweist. Vor allem „Der Landvogt von Greifensee“ -Text spielt mit seinem Inhalt eine zentrale Rolle im Zyklus und unterstreicht mit seinem Thema die Aussage der Rahmennovelle.
1861 erscheint „Das Fähnlein der sieben Aufrechten“. Erst fünfzehn Jahre später, 1876, als Keller sein Amt als Staatsschreiber kündigt, vollendet er den Zyklus.
Die fünf Geschichten spielen sich im wesentlichen in Zürich ab. Keller lässt aber die Erzählungen in verschiedenen Jahrhunderten geschehen und zwar vom Mittelalter bis ins 19.Jahrhundert. Dies entstand vermutlich, weil Keller dank seines Amtes als Staatsschreiber neue Einblicke in die Geschichte Zürichs erhielt. Nach Kellers eigener Aussage, soll der Zyklus „im Gegensatz zu den Leuten von Seldwyla mehr positives Leben enthalten“. Keller wollte damit etwas für den Patriotismus schaffen, ganz im Gegenteil zu den negativen „Seldwyla“- Novellen.
Kurzzusammenfassung
Der in die besten Jahre gekommene Salomon, Landvogt von Greifensee, begegnet seiner ersten grossen Liebe Salome. Dabei erinnert er sich an seine anderen vier Geliebten, die ihm während seines Lebens begegneten. Von allen fünf Damen erhielt er eine Abfuhr, was ihn aber nicht daran hinderte, jede in guter Erinnerung zu behalten. In Absprache mit seiner Haushälterin, werden sie alle auf sein Schloss eingeladen, jede mit dem Glauben, alleine den Landvogt zu treffen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schmilzt „das feine spröde Eis über den Herzen“ und es wird ein gelungener Festtag.
Salomon findet seinen inneren Frieden.
Personenerläuterung und Interpretation:
Die fünf Schätze:
1. Salome, der Distelfink
Salome ist seine erste grosse Liebe und stammt aus gutem Hause. Sie wird Mademoiselle genannt und ist nach französischem Vorbild erzogen. Salomon hat eher den Draht zum Künstlerischen und nimmt nur seinen Eltern zuliebe eine Stelle im Stadtgericht an. Die ungewisse Lage des Jungen gibt unter den Müttern allerhand zu reden. Salome versteht daraus soviel, dass eine Heirat mit Salomon niemals in Frage käme, da die sichere Existenz nicht gewährleistet ist. Als sich die beiden nun doch verlieben und heiraten wollen, stellt Salomon seine Geliebte auf die Probe. Er schreibt ihr seine Bedenken, wie er, wie seine Vorfahren, mit dem ausgeben von nicht vorhandenem Geld keine Probleme hat. Ein paar Tage nachdem sie den Brief erhalten hat, schreibt sie zurück, dass die Ehe aus verschiedenen Gründen nicht zustande kommen könne. Wenige Wochen später heiratet sie einen reichen, vernünftigen Mann, der ihr die Zukunft sichert.
Salome möchte einen reichen, nicht verschwenderischen Mann heiraten, der ihre Zukunft sichert. Landolt, als erwachsengewordene Gesellschaft ist noch etwas leichtsinnig und kommt daher für die Heirat nicht in Frage.
Der Name Salome kommt auch im Markus-Evangelium vor. König Herodes erhält durch ihre Tanzkünste gefallen an dem Mädchen, sie verlangt von ihm den Haupt des Täufers Johannes, welchen sie auch erhält.
Die meisten Vogelarten leben in einem Territorium, dass sie gegen Artgenossen verteidigen. Dagegen streift der Distelfink weit umher und ist immer da anzutreffen wo Unkräuter ihre Samen tragen. Auf Salome übertragen heisst das wohl, dass sie nur jemanden heiratet, der ihr ein sicheres und wohlhabendes Leben garantiert, respektiv genug Samen bietet. Der Landolt verkörpert die Distel. Sie ist eine Korbblüte mit stacheligen Blättern und Stängel und einer rötlich-violetten Blüte. Vor der stacheligen Pflanze ist Vorsicht geboten, der junge Landolt ist verschwenderisch. Also, der Fink, der sich in die Distel setzt. Aber auch der Landvogt muss sich vor Ihr in Acht nehmen, um nicht unglücklich zu werden
2. Figura Leu, der Hanswurstel
Figura ist eine aufgestellte und witzige Person. Ihre Aufgabe ist es, am Sonntag die Leute, die die Stadt verlassen wollen in Klassen aufzuteilen, bevor sie dem Oheim vorgeführt werden. Der Landolt hört von ihr und will sie kennen lernen. Sie ist eine hübsche junge Dame, mit goldblondem Kraushaar. Um der schönen näher zu kommen, schliesst sich Salomon ihrem Bruder Martin an. Die Beiden verstehen sich gut und eine dicke Freundschaft entsteht. Sitte und Recht ist eines der obersten Gebote der Gesellschaft. Salomon und Martin müssen nach einem Verstoss beim alten Leu antraben, um eine Verwarnung zu erhalten. Figura reagiert und zieht sich vorschriftswidrige Kleidung an, während sie die drei Herren bedient. Der Tag entwickelt sich und es werden unterhaltsame Stunden. Figura und Salomon werden Freunde, doch als sich allmählich mehr entwickelt, stoppt sie das geschehen. Sie hat am Sterbebett ihrer Mutter versprochen niemals zu heiraten. Eine Erbschaftskrankheit mütterlicherseits werde sie heimkehren und ihren Geist entnehmen. Sie erkrankt nicht, und der Salomon bleibt ihre nicht erfüllte Liebe.
Figura Leu ist die bedeutendste Liebe in Salomons Leben. Ihr Name kann als „Löwenbildnis“ interpretiert werden. Figura bedeutet etwas künstlerisches, gestalterisches wie zum Beispiel ein Bild. Leu steht für den Löwen. Zusammen also das Löwenbildnis. Bei Keller steht das Pferd als männlicher Trieb, genauso könnte das Bildnis als weiblichen Trieb angesehen werden. Figura ist die Starke und Schöne, die gegen Sittenmandate und Vorschriften, Verhaltens- und Kleiderregeln verstösst. So ist sie dann auch bedroht und zwar vom Wahnsinn, der möglicherweise von der Mutter vererbt wurde. Dies ist auch der Grund ihrer Schwermut. Um diesen zu verbergen, macht sie Scherze und ist immer guter Laune. Durch dieses Verhalten erhält Figura auch ihren Spitznamen Hanswurstel, den sie auch Sinngemäss akzeptiert. Salomon gefällt diese kraftvolle Frau, die sich auch gegen die Gesellschaft auflehnt. Genau darum ist sie auch die Einzige, die seiner würdig gewesen währe.
3. Wendelgard, der Kapitän
Salomon trifft auf einen übermütigen Kerl, dem verwitweten Kapitän Gimmel. Als die Beiden sich duellieren, tritt die schöne Tochter in den Raum, an der Salomon sofort gefallen findet. Sie hat sich tief verschuldet, was für Gesprächsstoff in der Gesellschaft sorgt. Der Landvogt hilft, indem er ihr das Geld bei seiner Grossmutter besorgt, anonym versteht sich. Er will sie heiraten. Dafür braucht Wendelgard sieben Tage Bedenkfrist. Während diesen Tagen lernt sie Figura in den Bädern von Baden kennen, wo ihr Vater auf die Suche ihres zukünftigen Gatten geht. Figura merkt schnell, an was da ihr guter Freund Salomon geraten ist und inszeniert eine Treffen. Martin Leu spielt einen Wohlhabenden, worauf sich Wendelgard sofort gegen Salomon entscheidet.
Ihren Übernamen erhält Wendelgard durch ihren Vater, dem Kapitän Gimmel. Beide sind von sich und ihrem Tun überzeugt. Auch für sie kommt nur eine reiche Heirat in Frage. Ähnlich wie bei Salome, steht das Geld zwischen den Beiden.
4. Barbara, die Grasmücke
Wenn das Wetter schön und die Luft milde, klingt in der entfernten Nachbarschaft eine nette Stimme. Diese gehört Barbara. Sie erschafft Bildnisse aus Wolle, Seide oder anderen natürlichen Stoffen. Nur Gesichter und Hände werden gemalt. Bei einem Bild mit Pferden, übersteigt dies ihre malerischen Fähigkeiten und ein Lehrer wird benötigt. Der Landvogt gilt als erster Pferdezeichner Zürichs und nimmt diesen Dienst gerne an. Schnell entsteht eine Vertrautheit zwischen den beiden und es entwickelt sich eine Beziehung. Um in die künstlerischen Werke von Salomon einmal einblicken zu können, wird die ganze Familie ins Elternhaus geladen, um ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. Beim Anblick seiner werke fürchtet sich Barbara und ihr wird klar was für eine künstlerische Ader der junge Landvogt hat. Schon fast hysterisch, trennt sie sich mit der Unterstützung ihrer Eltern von Salomon. Unter diesen Umständen ist eine harmonische bürgerliche Ehe nicht möglich.
Barbara kann das Pferd, Kellers Symbol des männlichen Triebes, nicht zeichnen und benötigt Unterricht. Es scheint, als sei sie keine starke Persönlichkeit, ohne Charakter. Beim Konflikt steht der Bürger dem Künstlerherzen gegenüber. Trotz der leicht künstlerischen Ader der Familie von Barbara, hat diese Angst vor dem Sinnlichen. Seine Leidenschaft, einem Gewitter gleichzusetzen, entspricht nicht einem Bürgerlichen. Er malt die Natur, auch Gewitter, ständig in Gefahr, zu sehr dem sinnlichen zu verfallen. Barbara ist aber auch der Name der Schutzheiligen, die bei Gewitter gerufen wird. Hier steht ganz klar der Künstler dem Bürgertum gegenüber. Die schwache Barbara könnte ihm niemals die Stange halten, also ist auch sie nicht die Richtige.
5. Aglaja, die Amsel
Aglaja sieht er zum ersten mal vor einem Baum, auf dem allabendlich eine Amsel ihre Gesänge zum besten gibt. Der Anblick dieser Dame erinnert Salomon an die Agleypflanze, was er irrtümlicherweise mit dem Namen Aglaja verwechselte. Auch diesmal kommen die Zwei sich immer näher und führen eine dicke Freundschaft. Salomon offenbart ihr seine Zuneigung, die er empfindet. Er ist sich sicher endlich die Richtige gefunden zu haben. Sie treffen sich zu einem Spaziergang, beide haben sich zurechtgemacht. Sie gesteht Salomon ihre selige Liebe zu einem Geistlichen, der von der Familie nicht geduldet wird. Der Landolt kann ihr nachempfinden und fädelt geschickt die Akzeptanz zu dieser Liebe ein.
Aglaja begleitet in den griechischen Sagen den Gott der Künste. Die Bedeutung des Namens verweist auf Glanz und Anmut. Sie hat sich in einen Geistlichen verliebt, der mit seinem Beschreib eine leise Kritik an der religiösen Malerei ausübt. Aglaja hat ähnliche Probleme wie Salomon bei Figura hatte. Eine grosse Liebe, die vorerst nicht erfüllt werden kann. Ich denke genau diesen Respekt vor der grossen Liebe bewegt den Landvogt zur Mithilfe der Beiden. Doch zuletzt verliert Aglaja ihren Glanz in ihrem Witwendasein.
Salomon:
Der Landolt betreibt die Kunst im Nebenamt, dies aber mit ganzem Herzen. Als Künstler kann er auch Bürger sein. Er bleibt sich seiner treu, ebenso wie seine einzige wahre Liebe, Figura. Für Salomon gibt es keinen Monat Mai, dem Monat der Liebe. Er kann nur im ehelosen Bürgertum existieren. Der Landvogt ist ein „Original“ und nur er kann in dieser Zusammensetzung als Künstler und Bürger existieren. Vor Gericht demonstriert er seinen Damen, dass auch er über die Gerechtigkeit in der Ehe richten kann und das, obwohl er unverheiratet ist, auch noch ausgesprochen gut. Mit diesem Rosengericht richtet er auch gleichzeitig seine fünf Schätze, denen nun ein Licht aufgeht.
Gesamtinterpretation:
In der Figur des Salomon Landvogt von Greifensee hat Keller einen historischen Mann gefunden, in dem er seine Autobiographie ausführen konnte. Die Novelle spielt im wesentlichen am 31.Mai 1784, dem letzten Tag des „Liebesmonats“. Auch nicht ganz zufällig beginnt die Geschichte am „Kaiser Heinrichs Tag“. Der Typ des jungen noch zu erziehenden „grünen Heinrich“, schliesst bereits auf eine Autobiographie.
Die Novelle zeigt auf, wie sich „Kunst, Künstler und die bürgerliche Tüchtigkeit, wie sich Liebe und Ehe, wie Erfüllung und Versagen, notwendige Einschränkung und volles Menschentum“ zueinander verhalten. Immer wieder schreibt er gegen die Ehe. Es kann keine Erfüllung durch die Ehe geben. Bei ihm nicht und auch bei der gefährdeten Figura nicht, die ansonsten mit ihrem Leben bezahlt hätte. Auch die Grossmuter spricht sich gegen die Ehe aus. Zum Tödlein meint sie: „Sieh her, so sehen Mann und Frau aus, wenn der Spass vorbei ist! Wer wird denn lieben und heiraten wollen!“ Mit der Ehe geht die Selbständigkeit verloren und somit tritt der Tod ein. Zu erwähnen ist, dass Keller zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester lebte und bis zu seinem Tod keine Ehe einging. Am Schluss bringt die Zeit Rosen. Diese symbolisieren den Schlussstrich, den Keller macht. Dazu kommt, dass es ein Affe ist der die Rosen überbringt. Hier werden nochmals deutlich die zweite Aussage aufgezeichnet. Nämlich das Verhältnis zwischen der vernünftigen und nüchternen bürgerlichen Gesellschaft und der unvernünftigen künstlerischen Muse.
Schlusswort:
Ich muss zugeben, als ich dieses Buch ausgewählt habe hatte ich absolut keine Ahnung auf was ich mich da einlasse. Das Einzige was mich reizte war, einen grossen schweizer Schriftsteller zu lesen und zu studieren. Als ich dann das Buch zum ersten mal durchgelesen hatte verlor ich wohl etwas Farbe im Gesicht. Ich fühlte mich total überfordert schon alleine deshalb, weil ich keine Sekundärliteratur finden konnte, die mich auf den „richtigen“ Weg leiten sollte, ausgenommen der Anhang des Reclamheftes. Nachdem ich mich dann in das Buch stürzte, schaute doch plötzlich mehr heraus als ich erwartet hatte. Stück für Stück ging es voran und ich bekam sogar Spass daran. Gut, ich muss zugeben es gab auch die eine und andere Stunde der Verzweiflung bei denen ich kurz vor dem Aufgeben stand. Im grossen und Ganzen bin ich mit meinen Erkenntnissen zufrieden, habe aber etwas mühe diese zu verdeutschen.
Das Buch hat mir erst im zweiten Anlauf gefallen, dies vermutlich weil ich nach dem ersten mal lesen zuwenig mitnehmen konnte. Ich glaube diese Geschichte hat durchaus auch heute noch seine Gültigkeit und Aussagekraft.
Quellenverzeichnis
- „Gottfried Keller- Der Landvogt von Greifensee“, Reclams Universal-Bibliothek
- „Nachwort- von Bernd Neumann“, Reclams Universal-Bibliothek
- „Keller- Der Landvogt von Greifensee“, Textausschnitt Kindlers
- „Gottfried Keller“, Microsoft Encarta
- „Gottfried Keller“, www.gutenberg.aol.de
- „Otto Brahm: Kritiken und Essays“, von Fritz Martini, Zürich 1964
- „Das deutsche Wörterbuch“, Knaur
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der „Landvogt von Greifensee“-Analyse?
Die Analyse umfasst eine Biographie von Gottfried Keller, Informationen zu seinem Stil (Realismus), eine Zusammenfassung und Interpretation der „Züricher Novellen“, insbesondere des „Landvogt von Greifensee“. Sie enthält auch Erläuterungen und Interpretationen der Charaktere Salome, Figura, Wendelgard, Barbara und Aglaja, sowie eine Gesamtinterpretation des Werkes und ein Schlusswort.
Wer war Gottfried Keller?
Gottfried Keller (1819-1890) war ein Schweizer Schriftsteller und Dichter des Realismus. Er war bekannt für seine Novellen, Romane und Gedichte. Er arbeitete auch als Staatsschreiber in Zürich.
Was ist der Realismus im Kontext von Gottfried Kellers Werk?
Der Realismus, insbesondere der poetische Realismus, ist ein Schreibstil, der versucht, die Wirklichkeit möglichst getreu darzustellen, oft mit genauen Beschreibungen des bürgerlichen Alltags. Keller verwendete Elemente des Realismus in seinen Novellen und Romanen, um ein Spiegelbild der Gesellschaft zu schaffen.
Was sind die „Züricher Novellen“?
Die „Züricher Novellen“ sind ein Zyklus von fünf Novellen, die durch eine Rahmenhandlung miteinander verbunden sind. Sie spielen hauptsächlich in Zürich in verschiedenen Jahrhunderten und dienen der Erziehung eines jungen Mannes namens Jacques.
Wer sind die fünf Frauen, die in der Analyse des „Landvogt von Greifensee“ erwähnt werden?
Die fünf Frauen sind Salome, Figura, Wendelgard, Barbara und Aglaja. Sie sind Salomons ehemalige Geliebte, die er auf sein Schloss einlädt. Jede Frau wird detailliert beschrieben und ihre Beziehung zu Salomon wird analysiert.
Wer ist Salome und welche Rolle spielt sie in der Novelle?
Salome ist Salomons erste grosse Liebe. Sie wird als Mademoiselle beschrieben und stammt aus gutem Hause. Sie verlässt Salomon, weil er keine sichere Zukunft bieten kann und heiratet stattdessen einen reichen Mann. Sie wird mit einem Distelfink verglichen, der nur dort hingeht wo er genug Samen findet.
Wer ist Figura Leu und welche Bedeutung hat sie für Salomon?
Figura Leu ist eine witzige und aufgestellte Person. Sie ist Salomons bedeutendste Liebe, aber sie heiratet ihn nicht, da sie ein Versprechen gegeben hat und an eine mögliche Erbkrankheit glaubt. Sie wird als starke und schöne Frau dargestellt, die gegen gesellschaftliche Normen verstösst.
Wer ist Wendelgard und warum heiratet sie Salomon nicht?
Wendelgard ist die Tochter eines Kapitäns. Sie ist verschuldet und sucht eine reiche Heirat. Sie entscheidet sich gegen Salomon, nachdem sie von Figura getäuscht wurde und einen wohlhabenderen Mann kennengelernt hat.
Wer ist Barbara und welche Rolle spielt ihre künstlerische Ader bei ihrer Trennung von Salomon?
Barbara ist eine Künstlerin, die Bildnisse aus Wolle und Seide erschafft. Sie trennt sich von Salomon, weil sie Angst vor seiner künstlerischen Leidenschaft hat und der Meinung ist, dass eine harmonische bürgerliche Ehe unter diesen Umständen nicht möglich ist.
Wer ist Aglaja und warum kann sie nicht mit Salomon zusammen sein?
Aglaja ist eine anmutige Frau, die in einen Geistlichen verliebt ist. Salomon hilft ihr, diese Liebe zu ermöglichen, obwohl er selbst Gefühle für sie hat.
Was ist die Gesamtinterpretation des „Landvogt von Greifensee“?
Die Novelle zeigt die Beziehungen zwischen Kunst, Künstlern und bürgerlicher Tüchtigkeit, sowie zwischen Liebe und Ehe. Sie behandelt Themen wie Erfüllung, Versagen, notwendige Einschränkung und volles Menschentum. Sie kritisiert die Ehe als einschränkend und plädiert für die Freiheit des Individuums.
Welche Quellen wurden für die Analyse verwendet?
Zu den Quellen gehören „Gottfried Keller- Der Landvogt von Greifensee“ (Reclams Universal-Bibliothek), „Nachwort- von Bernd Neumann“ (Reclams Universal-Bibliothek), „Keller- Der Landvogt von Greifensee“ (Textausschnitt Kindlers), „Gottfried Keller“ (Microsoft Encarta, www.gutenberg.aol.de), „Otto Brahm: Kritiken und Essays“ (von Fritz Martini, Zürich 1964), „Das deutsche Wörterbuch“ (Knaur) und „Die häufigsten Vogelarten der Schweiz“ (Das Beste).
- Citation du texte
- Daniel Groff (Auteur), 2001, Keller, Gottfried - Der Landvogt von Greifensee, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103855