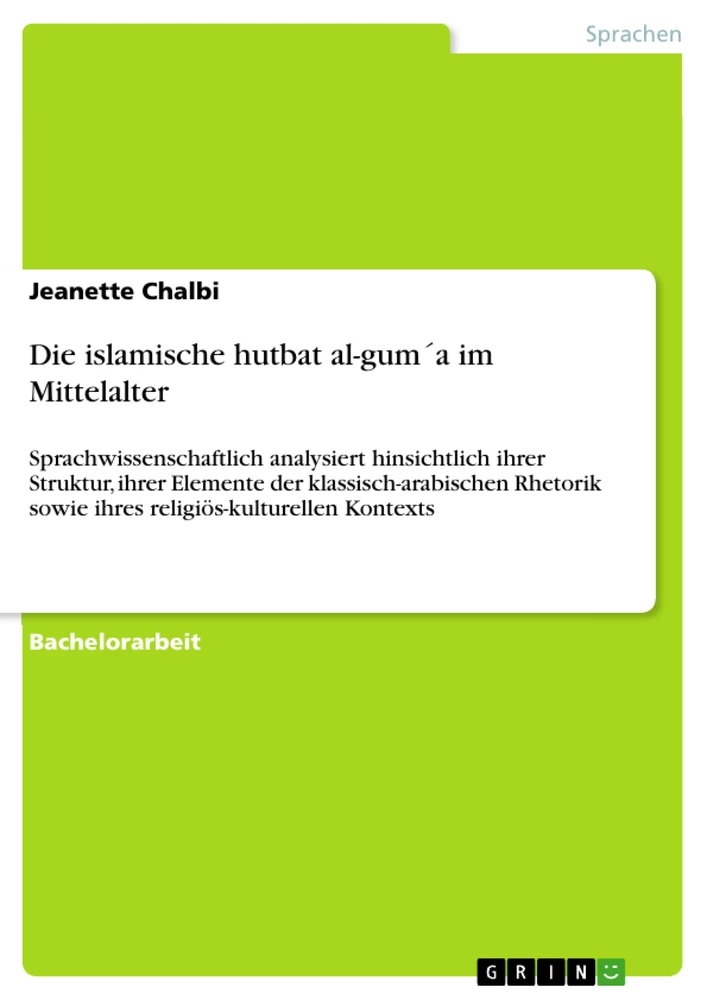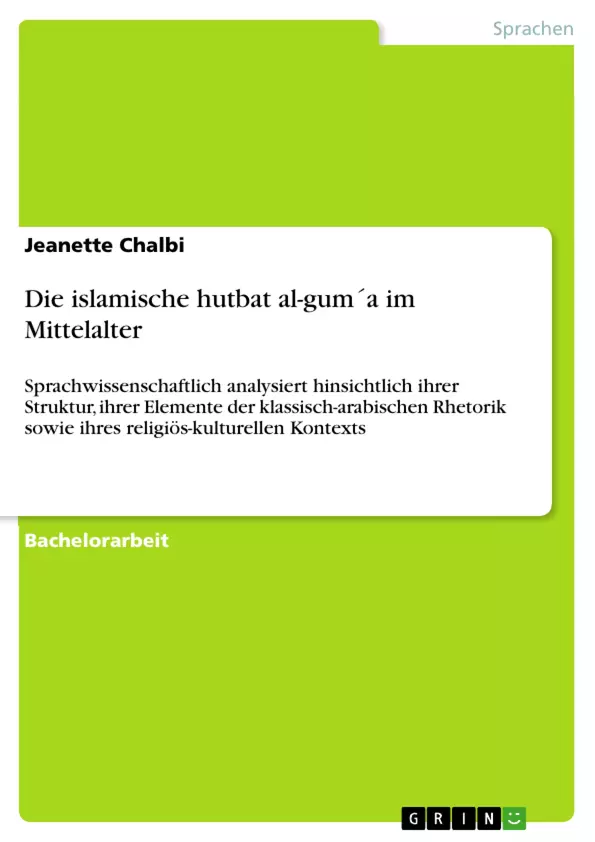Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des mittelalterlichen Islams und entdecken Sie die verborgenen Kräfte der Freitagspredigt (ḥutbat al-ğumʿa)! Diese tiefgreifende Analyse enthüllt die ḥutba nicht nur als religiöse Verpflichtung, sondern als einflussreiches Instrument der Kommunikation, das die Gesellschaft prägte und politische Diskurse anheizte. Erforschen Sie die kunstvolle Architektur dieses einzigartigen Textgenres, von den präzisen Regeln des Aufbaus (arkān al-ḥutba) bis hin zur meisterhaften Anwendung der klassisch-arabischen Rhetorik (al-balāgha), die Zuhörer in ihren Bann zog. Entdecken Sie, wie die Freitagspredigt im goldenen Zeitalter der arabischen Gelehrsamkeit (ca. 1000-1500 n. Chr.) als Spiegelbild der sozialen, religiösen und politischen Strömungen diente und die Menschen im arabisch-islamischen Raum auf einzigartige Weise verband. Diese Arbeit analysiert die sprachlichen Feinheiten, die rituelle Bedeutung und die performative Kraft der ḥutba, um ihre Rolle als Medium der Überzeugung und sozialen Kohäsion zu beleuchten. Untersucht werden der historische Ursprung, die Entwicklung der Predigttradition innerhalb der Sunna, sowie die einflussreiche Rolle des Predigers (ḥāṭib) und dessen Fähigkeit, durch Körpersprache und Stimme die Massen zu bewegen. Erfahren Sie, wie die Genreanalyse nach Peter Muntigl angewendet wird, um die vielschichtige Struktur und Funktion der ḥutba zu entschlüsseln und die Wechselwirkung zwischen Text, Kontext und Publikum zu verstehen. Diese Analyse bietet neue Einblicke in die Bedeutung der Oralität im islamischen Mittelalter und zeigt, wie die Freitagspredigt zur Verbreitung von Wissen, zur Festigung von Werten und zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beitrug. Lassen Sie sich entführen in eine Zeit, in der das gesprochene Wort Macht besaß und die Freitagspredigt das Herzstück der islamischen Gemeinschaft bildete, ein unverzichtbares Werkzeug zur Gestaltung der Weltanschauung und des sozialen Lebens. Diese Arbeit ist nicht nur eine wissenschaftliche Untersuchung, sondern eine Reise in die Vergangenheit, die uns die Bedeutung der Kommunikation und die Kraft der Worte vor Augen führt und die ḥutbat al-ğumʿa als einen Schlüssel zum Verständnis der mittelalterlichen arabischen Gesellschaft präsentiert, inklusive Transkription und Übersetzung eines Originaltextes.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- 1. ḥutbat al-ğumʿa „die Freitagspredigt“
- 1.1 Ursprung
- 1.2 Tradition und Ritus
- 1.3 Prediger: ḥāṭib, wāʿiz oder qāṣṣ?
- 2. Textgenre ḥutba
- 2.1 Aufbau und Gliederung: arkān al-ḥutba
- 2.2 Sprache
- 2.3 al-balāgha: Rhetorik, Stil und ihre Mittel
- 2.4 Körpersprache und Stimme
- 3. ḥutba und die mittelalterliche arabische Gesellschaft
- 3.1 Wirkung des Textes
- 4. Fazit
- 5. Originaltext
- 5.1 Transkription des Gedichts
- 5.2 Übersetzung der ausgewählten Abschnitte
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die islamische Freitagspredigt (ḥutbat al-ğumʿa) im Mittelalter als eigenständiges Textgenre. Die Analyse betrachtet sprachwissenschaftliche Aspekte, den religiös-kulturellen Kontext und den historischen Hintergrund. Der Fokus liegt auf dem arabisch-islamischen Raum während des „Goldenen Zeitalters“ der arabischen Gelehrsamkeit (ca. 1000-1500 n. Chr.).
- Die sprachliche Struktur und Elemente der klassischen arabischen Rhetorik in der ḥutba.
- Der religiös-kulturelle Kontext und die soziale Funktion der Freitagspredigt.
- Der historische Ursprung und die Entwicklung der ḥutba.
- Die Rolle des Predigers und die Wirkung der Predigt auf die mittelalterliche Gesellschaft.
- Die Anwendung der Genreanalyse nach Peter Muntigl auf die ḥutba.
Zusammenfassung der Kapitel
1. ḥutbat al-ğumʿa „die Freitagspredigt“: Dieses Kapitel beleuchtet den Ursprung und die Entwicklung der Freitagspredigt im Islam. Es wird erläutert, wie sich die ḥutba von einer informellen Versammlung zu einem festen Bestandteil des islamischen Rituals entwickelte, obwohl der Koran selbst die Predigt nicht explizit erwähnt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Sunna und den frühen Überlieferungen, die den Aufbau und die Abläufe des Freitagsgottesdienstes definieren. Die Rolle der frühen Gemeindeversammlungen und die allmähliche Institutionalisierung der ḥutba werden detailliert dargestellt, untermauert durch historische Beispiele und Überlieferungen, die die Entwicklung der etablierten Rituale und deren Bedeutung verdeutlichen.
2. Textgenre ḥutba: Dieses Kapitel analysiert die ḥutba als Textgenre. Es werden der Aufbau, die sprachlichen Mittel, die rhetorischen Strategien (al-balāgha) und die Bedeutung der Körpersprache und Stimme des Predigers untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung der stilistischen und rhetorischen Elemente, die den Erfolg und die Wirkung der Predigt garantierten. Anhand von Beispielen aus der Literatur wird gezeigt, wie die Predigt auf höchstem sprachlichen Niveau gehalten wurde und wie diese sprachliche Eleganz im religiös-kulturellen Kontext verankert ist. Die Analyse verdeutlicht die kunstvolle Verflechtung von Sprache, Rhetorik und Performance.
3. ḥutba und die mittelalterliche arabische Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Wirkung der ḥutba auf die mittelalterliche arabische Gesellschaft. Es werden die sozialen, politischen und religiösen Implikationen der Freitagspredigt untersucht, sowie ihre Funktion als Kommunikations- und Integrationsinstrument. Die Analyse zeigt auf, wie die ḥutba nicht nur religiöse Botschaften übermittelte, sondern auch als Plattform für gesellschaftliche und politische Diskurse diente. Die Wirkung und die Reichweite dieser Predigten werden ausführlich dargelegt und in den historischen Kontext eingebettet. Es wird erklärt, wie diese eine wichtige Rolle im Alltag der Bevölkerung spielte und einen bedeutenden Einfluss auf das gesellschaftliche Leben ausübte.
Schlüsselwörter
Freitagspredigt (ḥutbat al-ğumʿa), klassisch-arabische Rhetorik, al-balāgha, Genreanalyse, Islam, Mittelalter, islamischer Mittelperiod, Oralität, Sunna, ḥāṭib, Wirkung, sozio-kultureller Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse der Freitagspredigt (ḥutbat al-ğumʿa)?
Diese Bachelorarbeit analysiert die islamische Freitagspredigt (ḥutbat al-ğumʿa) im Mittelalter als eigenständiges Textgenre. Die Analyse betrachtet sprachwissenschaftliche Aspekte, den religiös-kulturellen Kontext und den historischen Hintergrund. Der Fokus liegt auf dem arabisch-islamischen Raum während des „Goldenen Zeitalters“ der arabischen Gelehrsamkeit (ca. 1000-1500 n. Chr.).
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse behandelt folgende Themenschwerpunkte:
- Die sprachliche Struktur und Elemente der klassischen arabischen Rhetorik in der ḥutba.
- Der religiös-kulturelle Kontext und die soziale Funktion der Freitagspredigt.
- Der historische Ursprung und die Entwicklung der ḥutba.
- Die Rolle des Predigers und die Wirkung der Predigt auf die mittelalterliche Gesellschaft.
- Die Anwendung der Genreanalyse nach Peter Muntigl auf die ḥutba.
Was ist die ḥutbat al-ğumʿa und wie entwickelte sie sich?
Die ḥutbat al-ğumʿa ist die islamische Freitagspredigt. Die Analyse beleuchtet ihren Ursprung und ihre Entwicklung vom informellen Charakter zu einem festen Bestandteil des islamischen Rituals. Die Bedeutung der Sunna und der frühen Überlieferungen für den Aufbau und die Abläufe des Freitagsgottesdienstes wird hervorgehoben.
Wie wird die ḥutba als Textgenre analysiert?
Die ḥutba wird als Textgenre analysiert, wobei der Fokus auf dem Aufbau, den sprachlichen Mitteln, den rhetorischen Strategien (al-balāgha) und der Bedeutung der Körpersprache und Stimme des Predigers liegt. Es werden die stilistischen und rhetorischen Elemente untersucht, die den Erfolg und die Wirkung der Predigt garantierten.
Welche Rolle spielte die ḥutba in der mittelalterlichen arabischen Gesellschaft?
Die Analyse beleuchtet die Wirkung der ḥutba auf die mittelalterliche arabische Gesellschaft und untersucht ihre sozialen, politischen und religiösen Implikationen. Die ḥutba diente nicht nur zur Übermittlung religiöser Botschaften, sondern auch als Plattform für gesellschaftliche und politische Diskurse.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Analyse relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Freitagspredigt (ḥutbat al-ğumʿa), klassisch-arabische Rhetorik, al-balāgha, Genreanalyse, Islam, Mittelalter, islamischer Mittelperiod, Oralität, Sunna, ḥāṭib, Wirkung, sozio-kultureller Kontext.
- Citar trabajo
- Jeanette Chalbi (Autor), 2019, Die islamische hutbat al-gum´a im Mittelalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1038714