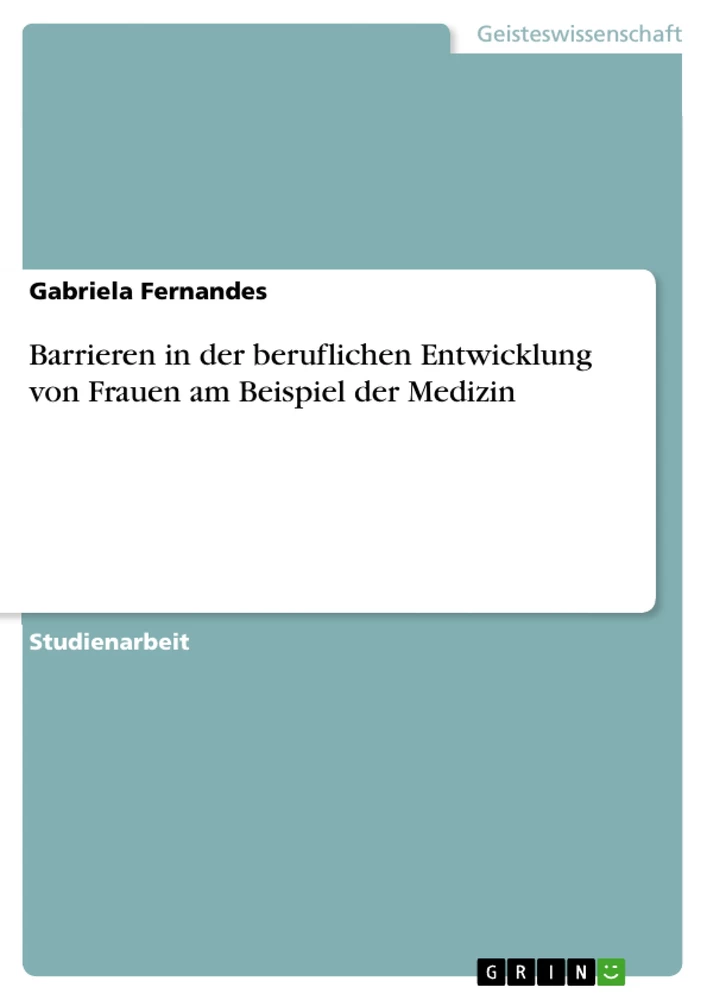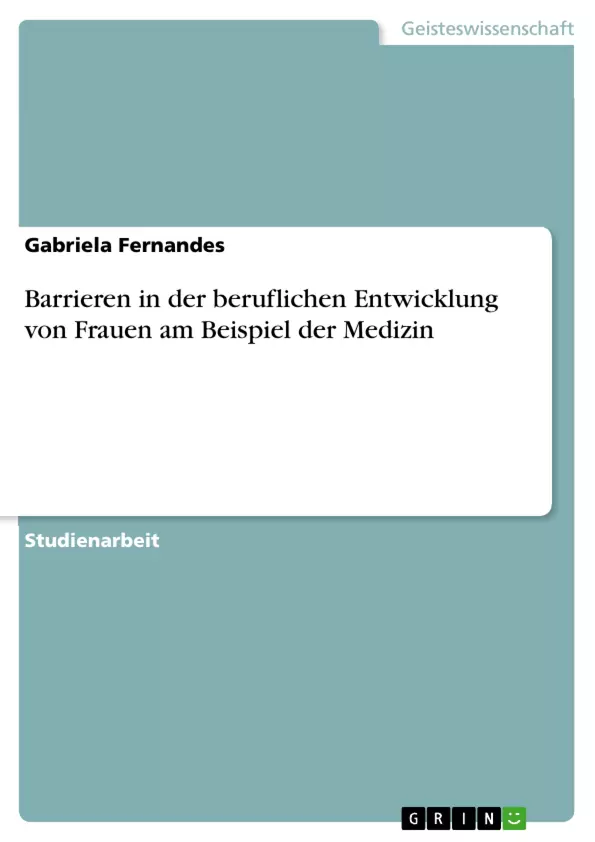Inhaltsverzeichnis
Einführung
Einige Fakten zur beruflichen Entwicklung in der Medizin
Äußere Barrieren
Untersuchungsergebnisse
- Rolle der Frau
- Karriere
- Rollenkonflikt
- Selbstwertgefühl und berufliches Selbstvertrauen
- Geschlechtsrollenorientierung
Diskussion
Literatur
1. Einführung
Allgemeiner Tatbestand ist, daß die beruflichen Laufbahnen von Frauen weit hinter ihren Fähigkeiten, ursprünglichen Zielen und Hoffnungen zurück bleiben . Als markantes Beispiel dafür kann die Situation der Medizinerinnen gelten.
Die Hälfte der Studienanfänger (Medizin) ist weiblich. Studentinnen steigen mit hoher Motivation ins Studium ein. Warum aber bleibt der Anteil von Frauen bei berufstätigen Ärzten seit Jahren konstant (etwa 1/4)?! Warum sind Frauen in prestigeträchtigen und
führenden Positionen unterrepräsentiert?! Warum übt jede dritte Ärztin in Deutschland ihren Beruf nicht aus?!
Der Schwerpunkt von M. Sieverdings Untersuchung ist die Beantwortung dieser Fragen aus psychologischer Perspektive: Welche psychischen (inneren) Barrieren erleben, erfahren Frauen beim Verfolgen ihrer beruflichen Ziele?
Psycholog. Barrieren, z.B. traditionelle Geschlechtsrollenerwartungen, fehlendes berufliches Selbstvertrauen, Rollenkonflikte zwischen Beruf und Familie, werden auch in anderer Literatur als die häufigsten psychologischen Barrieren genannt.
Ä ußere Barrieren in der beruflichen Entwicklung von Frauen sind z.B. fehlende berufliche Förderung von Frauen, Geschlechtsdiskriminierung bei Einstellung bzw. Beförderung, Mangel an Kinderbetreungseinrichtungen etc.
Wichtig ist dabei, die Verschränkung von psychologischen und äußeren Barrieren, die als sich bedingend verstanden und untersucht werden müssen (z.B. psychische Reaktionen als verinnerlichte gesellschaftliche Erwartungen, als Kompromiß zwischen inneren Bedürfnissen und äußeren Anforderungen: Entwicklung innerhalb der geschlechtsspezifischen Sozialisation in Elternhaus, Schule, Beruf etc..).
2. Einige Fakten zur beruflichen Entwicklung in der Medizin
Trotz des hohen Frauenanteils in der Medizin sind immer noch geschlechtsspezifische Segregationen festzustellen.
a) auf horizontaler Ebene: 40% der Frauen arbeiten in außerklinischen Tätigkeitsfeldern (Behörden/Körperschaften), aber nur 22% in Praxen, die als prestigeträchtiger angesehen werden. Frauen verfügen seltener über eine fachärztliche Zusatzqualifikation. 1988 hatten nur 42% der Frauen einen Facharzt, aber 75% der Männer. Frauen bekommen seltener unbefristete Verträge. Zum Beispiel bekamen nur 2% der Frauen gegenüber 16% der Männer (Seemann) einen unbefristeten Vertrag für eine fachärztliche Weiterbildung.
b) auf vertikaler Ebene:
Frauen sind immer noch in führenden Positionen unterrepräsentiert: nur 4,1% der Professorenstellen waren 1987 von Frauen besetzt und nur 4-5% der Frauen saßen in Chefarztpositionen.
Schließlich sind Medizinerinnen häufiger arbeitslos als Mediziner.
Josephine Mesletzky ergänzt weitere bestehende Tatsachen:
Frauen zeigen eine geringere geographische Flexibilität, wenn sie eine Familie haben, auf die Mobilität von Männern hat dies allerdings kaum Einfluss.
Medizinerinnen haben eher Partner, die ihnen in sozioökonomischen Merkmalen (Bildung, Gehalt, ..) ähneln, Mediziner leben eher in traditionellen, asymmetrischen Partnerschaftsverhältnissen und können daher mehr Unterstützung von ihren Partnern bekommen, da diese oft nicht berufstätig sind.
„ Weibliche “ und „ männliche “ Fachgebiete
Nach Jutta Schmitt sind Frauen vor allem in folgenden Fachgebieten zu finde: Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinderheilkunde, Anästesiologie, (außerdem in Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie Psychiatrie, Augenheilkunde, Neurologie) Männer überwiegen deutlich in Orthopädie, Chirurgie, Neurochirurgie, Urologie (ferner in Allgemeinmedizin, Radiologie, Pathologie, Innere Medizin, HNO-Heilkunde), welches gleichzeitig die prestigeträchtigsten Fächer sind (festgemacht an Einkommen, Ausbildungsdauer, Apparateintensität).
Schmitt betont, daß dies eine sozial bedingte Wahl sei. Weibliche Gebiete werden bevorzugt, weil sie Fähigkeiten aufweisen, die historisch als weibliche Fähigkeiten konstruiert wurden.
3. Äußere Barrieren
Äußere Barrieren, auch bezeichnet als soziale oder externe Barrieren, werden von Monika Sieverding definiert als äußere Einflüsse, die Frauen daran hindern entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten adäquat und erfolgreich an der Berufswelt zu partizipieren. Diese können folgendermaßen aussehen: Traditionelle Geschlechtsrollenerwartungen anderer, z.B. die Bezeichnung als „Rabenmutter“ führen dazu, daß Frauen in ihren instrumentellen Anteilen nicht wahrgenommen bzw. ernstgenommen werden. Medizinerinnen werden auf ihre expressive Rolle und Qualitäten (einfühlsam sein) festgeschrieben. Verhalten sich Frauen entgegen diesen Erwartungen. Sind sie also sachlich, durchsetzungsfähig und dominant erleben sie Nichtbeachtung, Erstaunen oder z.B. sexistische Kommentare, gelten als unweiblich (als männlich stereotypisierte Eigenschaften werden sanktioniert).Fehlende Unterstützung und Entmutigung haben Einfluss auf die Frauen. So wurden 50% der Frauen und 14% der Männer von Eltern (vor allem Müttern!), Professoren und Berufsberatern davon abgeraten in die Medizin zu gehen. Druck wird ausgeübt, daß Frauen „Frauenfächer“ (Kinderheilkunde, Psychiatrie) wählen, da sie den „natürlichen“ Fähigkeiten und Interessen entsprächen. Die Wahl des Fachgebietes ist also vielmehr das Ergebnis von positiver Verstärkung und Vermeidung von Konflikten als ein „Naturgesetz“. Die immer noch ungerechte Aufteilung familiärer Aufgaben und der Mangel an Kinderbetreungseinrichtungen lassen nur wenig zeitliche Ressourcen für die berufliche Entwicklung. Vo n der außerberuflichen Belastung durch Familie sind immer noch überwiegend Frauen betroffen. Weitere Barrieren sind Diskriminierung bei Einstellung/Beförderung, Vorurteile und Kämpfen-müssen um die Anerkennung als Ärztin. Schon die Erwartung von Diskriminierung stellt eine Barriere dar, indem bestimmte Wege gar nicht gewählt werden, um Geschlechtsdiskriminierung zu vermeiden. Außerdem erleben Frauen die desillusionierenden Erlebnisse im Berufseintritt als schwerer zu verarbeiten. Und schließlich wird Frauen der Aufstieg erschwert, da kaum Förderung durch professionelle Mentoren (sponsorship) oder Vorgesetzte erfolgt. Angesichts dieser äußeren Hindernisse stellt sich aber die Frage: Was unterscheidet die Frauen, die sich trotz äußerer Barrieren durchsetzen vo n denen, die aufgeben? Um die Unterrepräsentation von Frauen in nichttraditionellen Berufsfeldern (wie der Medizin) zu erklären, müssen noch andere Faktoren hinzugezogen werden, nämlich psychische Barrieren.
Allgemeines zur Untersuchung
Monika Sieverding hat dazu im SS 89 eine Studie mit MedizinstudentInnen der FU durchgeführt.
Insgesamt 450 Personen haben teilgenommen. Es gab 4 Untersuchungsgruppen:
Studienanfänger im 2. und 3.Semester, unterteilt in weiblich und männlich. Und jeweils weibliche und männliche Studierende, die in ihrem Praktischen Jahr waren, also am Studienende.
5.1 Rolle der Frau
Es hat sich bestätigt, daß Medizinstudenten traditionellere Vorstellungen von der Rolle der Frau vertreten als Medizinstudentinnen. Medizinstudenten haben eine traditionellere Einstellung, allerdings wird die Frauenfrage zur Kinderfrage gemacht (das Kind erlebe angeblich einen Mangel, wenn die Mutter).
Trotz Studien, die belegen, daß die Berufstätigkeit der Mutter nicht schädlich für das Kind ist, gilt immer noch die ungeschriebene Norm: "Eine gute Mutter schränkt ihre Berufstätigkeit ein oder gibt sie auf, sobald sie Kinder bekommt.
Zur These vom schädlichen Einfluß der Berufstätigkeit der Mutter läßt sich folgendes sagen: Die Berufstätigkeit der Mutter stellt nur eine Variable unter vielen dar, die die Entwicklung des Kindes beeinflussen. Weitere Variablen sind: die Einstellung der Mutter zu ihren Kindern und zu ihrer beruflichen Tätigkeit, die Zufriedenheit der Mutter mit ihrer Lebenssituation und ihrer beruflichen Tätigkeit, die Einstellung des Mannes zur Berufstätigkeit der Frau, die Erziehungsstile der Eltern und die Verfügbarkeit einer Ersatzbetreuung (nach Lehr, 1969, 1973).
Eine andere Studie ergab, daß außerfamiliäre Betreuung (schon vor dem 6. Lebensmonat) keine Schäden für das Kind bewirken muß. Wichtig ist aber immer die Stabilität der Betreuung. Kinder aus Kleinkindergärten zeigen durchaus eine sozial kompetente und reife Entwicklung.
Fazit: Eine Rebellion gegen die Ungerechtigkeit dieser "Arbeitsteilung: Kindeserziehung übernimmt die Mutter" ist fast unmöglich, weil die "Mutterliebe“ zu einer inneren Verpflichtung bei Frauen wird (Sozialisation), wobei bei Verletzung dieser "natürlichen" Verpflichtung Schuldgefühle entstehen (innere Barrieren!).
Die Hypothese, daß Frauen am Ende des Medizinstudiums eine traditionellere Einstellung zur Rolle der Frau als Frauen am Anfang des Medizinstudiums haben, konnte nicht bestätigt werden.
Ein Drittel der Studentinnen am Ende des Studiums stimmt den Vorurteilen zu, ca. 45% der Studentinnen am Anfang des Studiums stimmt zu und 60% der Studenten stimmt zu. Studentinnen am Ende des Studiums lehnen deutlicher die Auffassung ab, daß ein kleines Kind unter der Berufstätigkeit leidet bzw. lehnen moralische Verurteilungen gegenüber Berufstätigkeit und Muttersein ab. Männliche Befragte lehnen diese Vorurteile weniger stark ab. Zusammenfassend kann man sagen: Frauen sollen nach Meinung der Studenten wie Männer die Möglichkeit haben, berufstätig zu sein. Sie können auch eine berufl. Karriere anstreben, solange sie allein leben und keine Familie haben. Doch wenn sie Mütter werden, hat ihre Mutterrolle eindeutig Priorität vor der Berufsrolle zu haben. Eine Mutter, die das nicht tut, ist eine "Rabenmutter".
Die Hypothese, daß Medizinstudentinnen mit einer traditionelleren Einstellung zur Rolle der Frau seltener eine Karriere anstreben und ihren Karrierewunsch für unrealistischer halten als Frauen, die die traditionelle Einstellung ablehnen, hat sich nicht bestätigt.
5.2 Karriere
Die Definition nach Hennig & Jardim (1987) lautet: Karriere ist eine bewußte Entscheidung für langfristiges Weiterkommen im Beruf.
Karrieremotivation (Super 1980) wird als das Ausmaß angesehen, in dem eine Person Engagement in einer beruflichen Karriere als zentral in ihrem Leben ansieht.
Am Studienanfang gibt es kaum Geschlechtsunterschiede, der Karrierewunsch ist sogar größer bei Frauen als bei Männern. Am Studienende finden wir Folgendes: Karrierewunsch und Erwartungen haben bei Männern zu- bei Frauen abgenommen.
Was sind die Gründe dafür?
Der Berufseintrittsschock (Gebert & v. Rosenstiel 1981) ist die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der eintretenden Person und den Anforderungen der Organisation.
Männer streben allerdings trotzdem eine berufliche Karriere an, Frauen nur halb so oft. Das heisst, der Berufseinstrittsschock führt zu unterschiedlichen Konsequenzen.
Die frustrierenden Faktoren sind die gleichen, aber es gibt Unterschiede in der Bewertung. Typische Verarbeitungsstrategien von Männern sind: realistisch sein, „jeden Tag wenigstens eine gute Tat“, Distanzierung durch Humor und Sarkasmus und eine „jetzt erst recht“- Einstellung. Gründe für Demotivierung von Frauen sind: Zweifel am Sinn der Tätigkeit, Selbstzweifel, Antizipation fehlender Unterstützung und Antizipation von Diskriminierung als Frau.
Männern fällt also scheinbar die Anpassung leichter. Sieverding meint allerdings dazu, daß Männer keine Alternative haben und einen hohen Preis zahlen. Sie werden u.a. häufiger krank und haben häufiger Alkoholprobleme.
5.3 Rollenkonflikt
Bestätigt wurde, daß Medizinstudentinnen den Konflikt zwischen familiärer und beruflicher Rolle stärker erleben als Medizinstudenten. Nicht bestätigt werden konnte, daß Frauen am Studienende ihn stärker erleben als Frauen am Studienanfang.
Studentinnen halten es für deutlich schwieriger als Studenten, Kind und Beruf miteinander zu vereinbaren. Frauen erleben den Konflikt deutlicher.
Am Ende des Studiums wird der Konflikt von beiden Geschlechtern als größer angesehen als am Anfang des Studiums.
Karrieremotivation und Kinder: Für Frauen, die bereits ein Kind haben, scheint der Konflikt - beide Bereiche zu vereinbaren- schwerwiegender. Das wirkt sich auf die Karrieremotivation aus. Nur noch 3 von 14 Müttern streben am Ende des Studiums eine berufliche Karriere an. Reale Schwierigkeiten und erlebter Konflikt drängen zu einer "entweder, oder"- Entscheidung.
Medizinstudenten, die Väter sind, streben hingegen weiterhin eine berufliche Karriere an - genauso wie ihre kinderlosen Kommilitonen.
5.4 Selbstwertgefühl und berufliches Selbstvertrauen
Ergebnisse: Es gibt keine Geschlechtsunterschiede im globalen Selbstwertgefühl. Der Karrierewunsch hängt vom Selbstwertgefühl ab. Berufliche Selbstwirksamkeitserwartung bedingt, ob jemand in dem gewählten Berufsfeld bleibt und sich gegen äußere Barrieren durchsetzt (Hackett & Betz 1981). Es gibt keine generelle Geschlechtsunterschiede im beruflichen Selbstvertrauen („Career self-efficacy“), aber in bezug auf die Anforderungen des Berufs: Frauen weisen ein niedrigeres berufliches Selbstvertrauen auf. Sie unterschätzen ihre Fähigkeiten besonders in Konkurrenz- oder Bewertungssituationen. Hackett und Betz (1981) nennen folgende Gründe: Faktoren in der weiblichen Geschlechtsrollen-Sozialisation, das Fehlen von nichttraditionellen weiblichen Rollenmodellen und wenig Ermutigung nichttraditionelle Aktivitäten auszuüben. Bei Frauen sind Realisierungserwartungen des Karrierewunsch abhängig vom Selbstwertgefühl, nicht aber bei Männern, da sie ihre Realisierungserwartungen hauptsächlich auf äußere Gründe gründen.
Selbstkonzept - Berufskonzept
Die Ähnlichkeit zwischen (eigenem!) Berufskonzept und Selbstkonzept hängt mit der Karrieremotivation und den Realisierungserwartungen zusammen. Nach der Theorie von Super (1951) ist berufliches und persönliches Wohlergehen am wahrscheinlichsten, wenn Inhalte des Berufs und des Privatlebens übereinstimmen.
Am Anfang des Studiums gibt es keine generellen Geschlechtsunterschiede in den Selbstkonzepten, allerdings sind die Frauen signifikant leistungsorientierter. Am Ende des Studiums findet man folgende Unterschiede: Männer sind leistungsorientierter, Frauen verfügen über mehr expressive und weniger instrumentelle Eigenschaften. Instrumentelle Eigenschaften werden erst am Ende des Studiums als förderlicher als expressive Eigenschaften betrachtet. Am Anfang des Studiums gibt es keine generellen Geschlechtsunterschiede in den Berufskonzepten (für erforderlich gehaltene Merkmale sind:
Leistungsstreben, Instrumentalität, Selbstbehauptung und expressive Eigenschaften).
Ä hnlichkeit bzw. Diskrepanz zwischen Selbstkonzept und Berufskonzept
Personen mit einer niedrigen Diskrepanz zwischen Selbstkonzept und Berufskonzept streben häufiger eine berufliche Karriere in der Medizin an und halten ihren Wunsch für realistischer als Personen mit einer hohen Diskrepanz. Am Ende des Studiums findet man folgende Unterschiede: Frauen fallen heraus gegenüber Männern und Frauen am Studienanfang: Sie haben ein extrem „männliches“ Berufskonzept und gleichzeitig ein extrem „weibliches“ Selbskonzept. Feminine Studentinnen weisen die größte Diskrepanz zwischen Berufskonzept und Selbstkonzept auf, maskuline Studenten die geringste. Zum Beispiel wird Instrumentalität als besonders förderlich gesehen, selbst halten sich die Studentinnen allerdings für besonders wenig selbstbehauptend.
Daraus folgt, das ein feminines Selbstkonzept eine direkte psychologische Barriere für eine berufliche Karriere in der Medizin darstellt.
5.5 Geschlechtsrollenorientierung
Geschlechtsrollenorientierung wird definiert als Erwartungen darüber, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen für Männer oder Frauen typisch, sozial angemessen sind. Es gibt vier Geschlechtsrollentypen (jeweils für Frauen und Männer): undifferenzierte, feminine, androgyne und maskuline Personen.
Feminin sind Personen, die vermehrt expressive Eigenschaften haben und wenig instrumentelle (Wert auf der jeweiligen Skala über/unter dem Median) Für maskuline Geschlechtsrollentypen gilt der umgekehrte Fall.
Andogyn ist jemand, bei dem instrumentelle und expressive Eigenschaften gleich stark vorhanden sind (beide Skalenwerte liegen über dem Median).
Undifferenziert sind Personen, die sowohl wenig expressive als auch wenig instrumentelle Eigenschaften haben.
Die Aufteilung jeweils für Frauen und Männer ist relativ gleichverteilt, außer am Ende des Studiums, wo es mehr maskuline Männer und mehr feminine Frauen gibt.
Die Geschlechtsrollenorientierung hat Einfluss auf die karriererelevanten Variablen: Instrumentelle Personen, die vor allem unter den androgynen und maskulinen Typen zu finden sind, haben ein größeres globales Selbstwertgefühl und höhere berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen, diese sind wiederum förderlich für berufliche Hoffnungen, für Realisierungserwartungen und für eine berufliche Karriere.
Das heißt, geringe Instrumentalität stellt eine psychologische Barriere dar. Allerdings ist die relevante Variable nicht das Geschlecht, sondern die Geschlechtsrollenorientierung. Wenn man die Geschlechtsrollenorientierung als moderierende Variable kontrolliert, verschwinden die generellen Geschlechtsunterschiede.
Durchschnittlich haben Frauen am Ende des Studiums niedrigere Werte in den karriererelevanten Variablen, aber wenn man die Geschlechtsrollentypen genauer betrachtet, zeigt sich, daß die femininen, undifferenzierten Frauen zwar eine größere Diskrepanz zwischen Berufs- und Selbstkonzept aufweisen, niedrigeres Selbstwertgefühl und niedrigeres berufliches. Selbstvertrauen haben, seltener eine Karriere anstreben und weniger an die Verwirklichung ihres Karrierewunsches glauben.
Die andogynen, maskulinen Frauen ze igen aber eher günstige psychologische Voraussetzungen für eine berufliche Karriere wie die Mediziner auch (kein Unterschied in Realisierungserwartungen und beruflichen Zielen).
Wieso werden die Frauen femininer?
Die Hypothese, daß Frauen mittlerweile Müt ter geworden sind, was eine feminine Geschlechtsrollenorientierung bewirkt haben könnte, hat sich nicht bestätigt. Auch die Frauen ohne Kinder werden im Lauf des Studiums immer femininer im Selbstkonzept Sieverding schlägt als Grund eine „antizipatorische Feminisierung“ vor, als Reaktion auf die frustrierende Situation beim Berufseintritt (Berufseintrittsschock, fehlende Instrumentalität, geringe Realisierungserwartungen). Die Feminisierung im Selbstkonzept könnte ein Mechanismus sein, wie Medizinerinnen diese Unvereinbarkeit (Kognitive Dissonanz ) lösen: Sie werden als Reaktion auf die "instrumentelle Welt" nicht instrumenteller, sondern expressiver und wählen die gesellschaftlich gutgeheißene traditionell weibliche Alternative: „Hausfrau und Mutter“. Die Antizipatorische Feminisierung im Selbstkonzept wäre dann eine Vorbereitung auf diese traditionelle Rolle. Für M ist dieser Weg keine Alternative, da er gesellschaftlich kaum akzeptiert wird.
6. Diskussion
Wie können innere Barrieren abgebaut werden?
- Strategien üben, um Diskrepanzen zwischen Idealen und Realität besser zu verarbeiten.
- Geschlechtsspezifische Sozialisation von Kindern beeinflussen
- Auflösung innerer Voraussetzung für Auflösung äußerer Barrieren?
- Warum setzen sich Frauen nicht mehr für ihre Rechte ein? Wie?
- Auflösung innerer Barrieren nötig, denn z.B. Mütter, die die Rabenmutter-Position einnehmen, werden keine Kindergärten nutzen. Aber die Erforschung psychologischer Faktoren darf nicht zur Konsequenz haben, daß Quotierung und Antidiskriminierungsbemühungen aufgegeben werden. Denn die psychischen Barrieren können auch als verinnerlichte gesellschaftliche Erwartungen gesehen werden.
Literatur:
- Sieverding, M. (1990) Psychologische Barrieren in der beruflichen Entwicklung von Frauen. Das Beispiel der Medizinerinnen. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart.
- Schmitt, J. Unterschiede auf den zweiten Blick: „weibliche“ und „männliche“ Fachgebiete in der Medizin. In Studierende und studierte Frauen: Ein ost-west-deutscher Vergleich. Stein, R.H. & Wetterer, A. (Hrsg.). IAG Frauenforschung. Verlag Jenior & Pressler. Kassel. 1994.
Häufig gestellte Fragen zu "Psychologische Barrieren in der beruflichen Entwicklung von Frauen. Das Beispiel der Medizinerinnen"
Was ist das Hauptthema der Untersuchung?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die psychologischen (inneren) Barrieren, die Frauen bei der Verfolgung ihrer beruflichen Ziele in der Medizin erleben. Sie untersucht, warum trotz des hohen Frauenanteils im Medizinstudium Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind und warum ein signifikanter Teil der Ärztinnen ihren Beruf nicht ausübt.
Welche äußeren Barrieren werden identifiziert?
Äußere Barrieren umfassen fehlende berufliche Förderung, Geschlechtsdiskriminierung bei Einstellung und Beförderung, sowie Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen. Diese Barrieren sind eng mit psychologischen Barrieren verknüpft und bedingen sich gegenseitig.
Welche Fakten zur beruflichen Entwicklung in der Medizin werden genannt?
Trotz des hohen Frauenanteils bestehen geschlechtsspezifische Segregationen. Frauen sind auf horizontaler Ebene häufiger in außerklinischen Tätigkeitsfeldern tätig und seltener in Praxen. Auf vertikaler Ebene sind sie in führenden Positionen unterrepräsentiert. Zudem sind Medizinerinnen häufiger arbeitslos als Mediziner. Sie zeigen auch eine geringere geografische Flexibilität, wenn sie eine Familie haben.
Welche "weiblichen" und "männlichen" Fachgebiete werden unterschieden?
Frauen sind häufiger in Fachgebieten wie Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinderheilkunde und Anästhesiologie tätig, während Männer in Orthopädie, Chirurgie, Neurochirurgie und Urologie überwiegen. Die Wahl der Fachgebiete wird als sozial bedingt angesehen.
Wie werden äußere Barrieren definiert?
Äußere Barrieren werden als äußere Einflüsse definiert, die Frauen daran hindern, entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten adäquat und erfolgreich am Berufsleben teilzunehmen. Beispiele sind traditionelle Geschlechtsrollenerwartungen, fehlende Unterstützung und Entmutigung, ungerechte Aufteilung familiärer Aufgaben und Diskriminierung.
Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?
Monika Sieverding führte im SS 89 eine Studie mit MedizinstudentInnen der FU durch. Insgesamt 450 Personen nahmen teil, unterteilt in Studienanfänger (2. und 3. Semester) und Studierende im Praktischen Jahr, jeweils weiblich und männlich.
Welche Rolle spielt die traditionelle Rollenverteilung?
Medizinstudenten vertreten tendenziell traditionellere Vorstellungen von der Rolle der Frau als Medizinstudentinnen. Die Frauenfrage wird oft zur Kinderfrage gemacht, wobei argumentiert wird, dass das Kind leidet, wenn die Mutter berufstätig ist.
Wie verändert sich der Karrierewunsch im Laufe des Studiums?
Am Studienanfang gibt es kaum Geschlechtsunterschiede im Karrierewunsch. Am Studienende haben Karrierewunsch und -erwartungen bei Männern zugenommen, bei Frauen jedoch abgenommen. Dies wird auf den Berufseintrittsschock und unterschiedliche Bewältigungsstrategien zurückgeführt.
Wie wird der Rollenkonflikt erlebt?
Medizinstudentinnen erleben den Konflikt zwischen familiärer und beruflicher Rolle stärker als Medizinstudenten. Für Frauen mit Kindern scheint der Konflikt besonders schwerwiegend zu sein und wirkt sich negativ auf die Karrieremotivation aus.
Welche Rolle spielen Selbstwertgefühl und berufliches Selbstvertrauen?
Es gibt keine generellen Geschlechtsunterschiede im globalen Selbstwertgefühl. Allerdings weisen Frauen ein niedrigeres berufliches Selbstvertrauen in Bezug auf die Anforderungen des Berufs auf und unterschätzen ihre Fähigkeiten in Konkurrenzsituationen. Die Realisierungserwartungen des Karrierewunsches hängen bei Frauen vom Selbstwertgefühl ab, bei Männern jedoch nicht.
Wie beeinflusst die Geschlechtsrollenorientierung die Karriere?
Instrumentelle Personen (androgyne und maskuline Typen) haben ein größeres globales Selbstwertgefühl und höhere berufliche Selbstwirksamkeitserwartungen, was sich positiv auf die beruflichen Hoffnungen und Realisierungserwartungen auswirkt. Geringe Instrumentalität stellt eine psychologische Barriere dar. Frauen werden im Laufe des Studiums femininer, was als "antizipatorische Feminisierung" interpretiert wird.
Welche Strategien können innere Barrieren abbauen?
Strategien umfassen das Üben von Strategien zur besseren Verarbeitung von Diskrepanzen zwischen Idealen und Realität, die Beeinflussung der geschlechtsspezifischen Sozialisation von Kindern und die Auflösung innerer Voraussetzungen für die Auflösung äußerer Barrieren.
- Quote paper
- Gabriela Fernandes (Author), 2000, Barrieren in der beruflichen Entwicklung von Frauen am Beispiel der Medizin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/103910