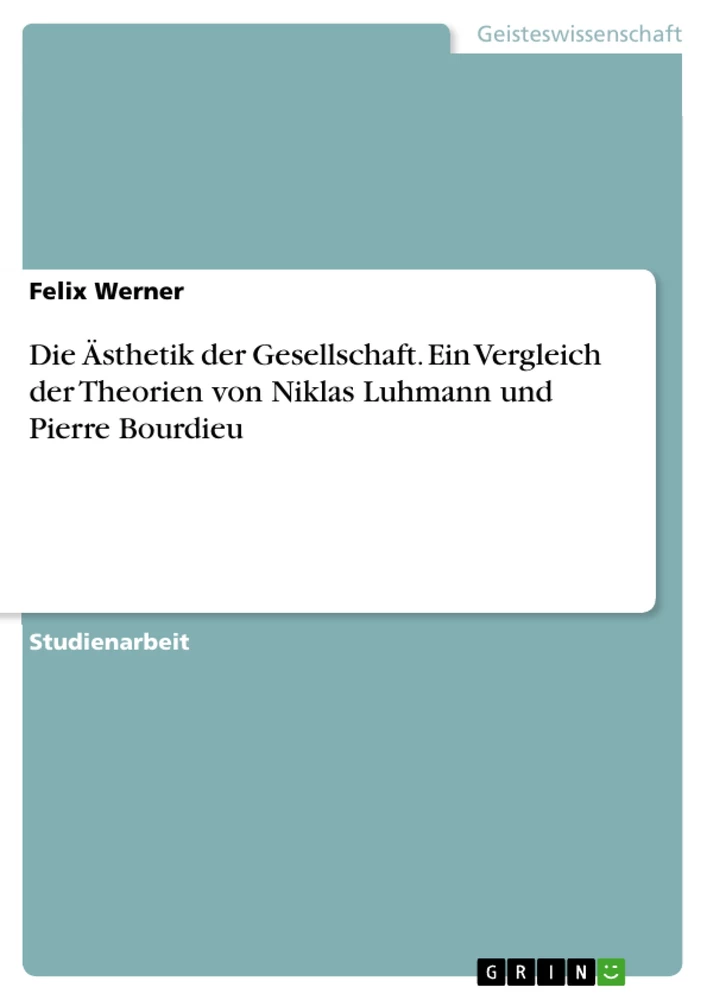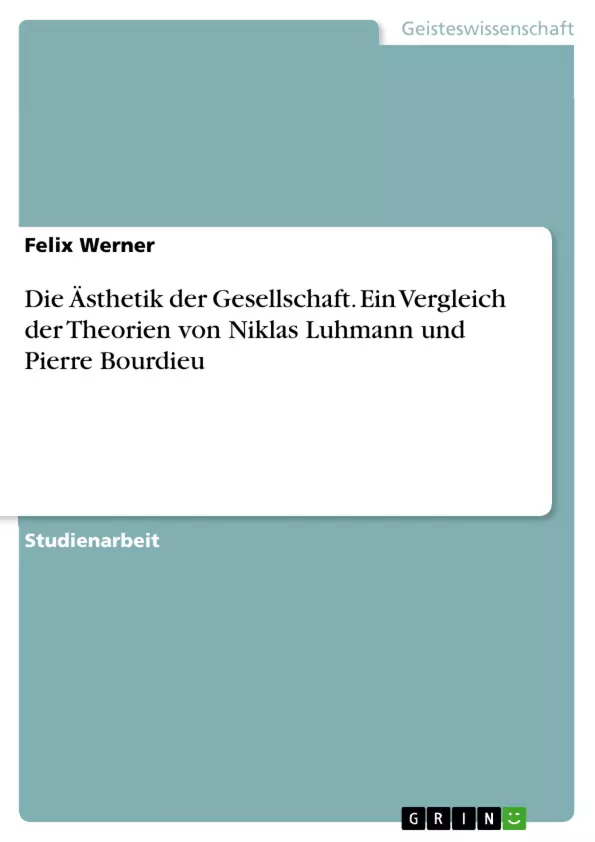Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff und der begrifflichen Selbstabstraktion der Ästhetik. Als essentially contested concept ist Ästhetik wesensmäßig umstritten, wobei unterschiedliche Zuschreibungsweisen und ästhetische Empfindungen das Ergebnis eines Ausdifferenzierungsprozesses von Wertvorstellungen darstellen. In der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Ästhetik scheint also Konsens darüber zu herrschen, dass ihrerartige Empfindungen und Verweisungszusammenhänge subjektiv seien, dass sie sich begründen in den Differenzen der sozialen Norm, der Wertvorstellung, dem eigenen Geschmack.
Die daraus resultierende Inkonvergenz bestreitet trotzdem nicht die Vorstellung, der Ästhetik wäre ein entsprechendes Normenverständnis vorausgesetzt – also dass es Grenzen bezüglich der Möglichkeiten gäbe, was als ästhetisch beschrieben werden kann und was nicht – und das veranlasst dazu, etwaige Entstehungsprozesse gesellschaftlicher Leitvorstellungen der Ästhetik aufzudecken und ebenjene Grenzsetzungen auszuarbeiten.
Dass die Lösung dieser Inkonvergenz des Ästhetikbegriffes mit unterschiedlich ausgestalteten Definitionsvorschlägen behoben wäre, die dann um Deutungshoheit konkurrieren, mag ernsthaft bezweifelt werden. Stattdessen geht es um die Frage, ob und wie ein entsprechendes Begriffsverständnis von Ästhetik in der Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Wertvorstellungen entsteht, wie es erzeugt wird und sich verändert.
Dafür wird im Rahmen der Arbeit in zwei soziologische Theorien eingeführt, die, gleichsam als Gesellschaftstheorien geeignet, zu einer Antwort dieser Frage befähigt scheinen: die selbstreferentielle Theorie der sozialen Systeme von Niklas Luhmann und die Feldtheorie von Pierre Bourdieu. Dabei soll erläutert werden, wie ästhetische Vorstellungen und Zuschreibungen im Rahmen komplexer soziokultureller respektive sozioökonomischer Prozesse entstehen und sich wechselseitig beeinflussen. Zum Schluss werden anhand einiger empirischer Beispiele anhand von verschiedenen Zeitungen und Magazinen die Distinktion des Ästhetischen vollzogen. Neben den jeweiligen Hauptwerken werden dafür auch eine Vielzahl weiterer Monographien, Aufsätze und Interviews mit einbezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Begriff der Ästhetik
- Niklas Luhmanns Theorie der sozialen Systeme
- Pierre Bourdieus Feldtheorie
- Ästhetik der Gesellschaft
- Luhmanns Kunstsystem
- Bourdieus Kunstfeld
- Theorievergleich
- Ästhetik als Differenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Entstehung und Veränderung ästhetischer Wahrnehmungen und Zuschreibungen in der Gesellschaft mithilfe der Gesellschaftstheorien von Niklas Luhmann und Pierre Bourdieu zu untersuchen. Dabei wird der Fokus auf die Frage gelegt, wie sich Ästhetik in der Gesellschaft vorgegeben wird und welche Leitvorstellungen über Ästhetik und Kunst entstehen.
- Die Entstehung des Ästhetikbegriffs in der Gesellschaft
- Der Einfluss gesellschaftlicher Wertvorstellungen auf ästhetische Wahrnehmungen
- Die Rolle von Kunst und Kultur in der Gestaltung ästhetischer Normen
- Die Anwendung von Systemtheorie und Feldtheorie auf die Analyse von Ästhetik
- Die Bedeutung von Differenz und Abgrenzung im ästhetischen Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zum Begriff der Ästhetik
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Verständnis des Begriffs der Ästhetik. Es wird erläutert, wie unterschiedlich der Begriff in der Gesellschaft verwendet und interpretiert wird. Der Text beleuchtet die historischen und soziokulturellen Prozesse, die die Entwicklung des Begriffs beeinflusst haben.
2. Niklas Luhmanns Theorie der sozialen Systeme
Dieses Kapitel stellt die Theorie der sozialen Systeme von Niklas Luhmann vor. Es wird die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Systemen und die Funktionsweise sozialer Systeme erläutert. Insbesondere wird die Bedeutung von Kommunikation und Differenz für die Entstehung und Funktionsweise sozialer Systeme hervorgehoben.
3. Pierre Bourdieus Feldtheorie
Dieses Kapitel widmet sich der Feldtheorie von Pierre Bourdieu. Es wird die Funktionsweise von Feldern als gesellschaftlichen Strukturen erläutert. Der Text beleuchtet den Einfluss von Kapitalformen und Machtstrukturen auf die Entwicklung von Feldern. Die Rolle von habitus als internalisierte Normen und Werten wird ebenfalls behandelt.
4. Ästhetik der Gesellschaft
Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Ästhetik in der Gesellschaft im Lichte der Theorien von Luhmann und Bourdieu. Es wird die Entstehung von Kunstsystemen und Kunstfeldern sowie die wechselseitige Beeinflussung von ästhetischen Vorstellungen und sozioökonomischen Prozessen beleuchtet. Die Kapitel untersuchen außerdem die Funktion von Kunst als Mittel der sozialen Distinktion.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieses Textes umfassen: Ästhetik, soziale Systeme, Feldtheorie, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Kunst, Kultur, Gesellschaft, Differenz, Abgrenzung, Wertvorstellungen, Geschmack, Habitus, Distinktion, Kommunikation, Normen, Kapital, Macht, Sozioökonomie.
- Citation du texte
- Felix Werner (Auteur), 2021, Die Ästhetik der Gesellschaft. Ein Vergleich der Theorien von Niklas Luhmann und Pierre Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1039272