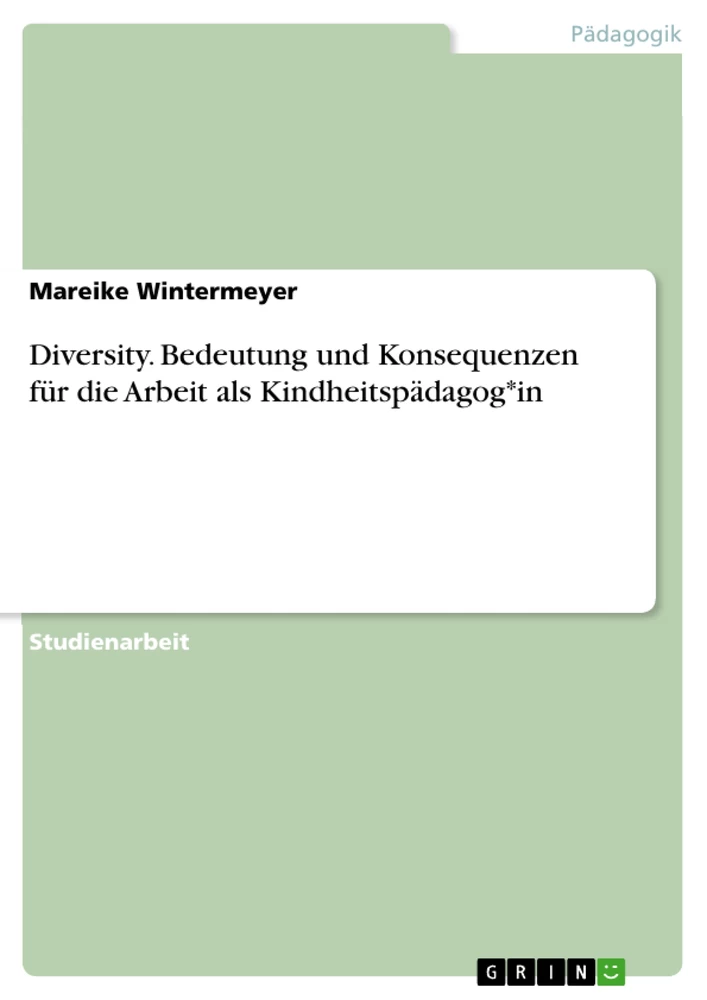Kulturelle, religiöse und genderspezifische Unterschiede nehmen Einfluss auf das alltägliche Leben aller Menschen. Doch auf welche Art und Weise begegnen sie uns? Und wie wirkt sich dies auf die pädagogische Arbeit mit Kindern in der Kindertageseinrichtung aus?
Das übergeordnete Thema „Diversity“ und die damit verbundene Frage nach Bedeutung und Konsequenzen für die Arbeit als Kindheitspädagog*innen ist Ausgangspunkt meiner Ausführungen. Dabei gehe ich zunächst auf die Begrifflichkeit der Kultur ein und erläutere damit zusammenhängende Dimensionen. Im darauffolgenden Abschnitt wird es um das Thema Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung und ihre Entwicklungsursachen gehen. Am Beispiel des Anti-bias-Projekts greife ich dann die vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung von Kindern auf, bevor ich mich der interkulturellen Pädagogik, ihrer Entstehung und den zu erreichenden Zielen widme.
Anschließend thematisiere ich die Strömungen, geschichtliche Hintergründe und Absichten sogenannter Integrationspädagogik, welche Anlass vieler Diskussionen ist und der in unserer heutigen Gesellschaft eine besondere Rolle zukommt. Danach werfe ich einen Blick auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Menschen, die Gegenstand der zu Beginn erwähnten Pädagogik der Vielfalt darstellen, bevor ich mich mit der interreligiösen Pädagogik und der facettenreichen Bedeutung von Religionen auseinandersetze. Im letzten Abschnitt meiner theoretischen Annäherung an das Schwerpunktthema befasse ich mich mit dem wichtigen Bildungsinhalt der Sakralraumpädagogik, deren Ziele auch im Orientierungsplan Baden-Württemberg festgehalten sind.
Im Anschluss an die theoretische Auseinandersetzung widme ich mich den Kritikpunkten vier der eingeführten theoretischen Grundlagen und ihren Begrifflichkeiten. Dabei führe ich Argumente unterschiedlicher Positionen auf und versuche auch, Lösungsansätze für die Problematik mit einzubringen. Im letzten Teil der Hausarbeit wird es um die Relevanz von Vielfalt für die pädagogische Praxis gehen, bei der ich sowohl auf Umsetzungsmöglichkeiten zum Erfahren von Diversität in Kindertageseinrichtungen als auch auf die Haltung und das Denken der pädagogischen Fachkraft Bezug nehmen werde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Theoretische Annäherung an das Schwerpunktthema
- Kultur
- Genderpädagogik
- Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung
- Interkulturelle Pädagogik
- Integrationspädagogik
- Pädagogik der Vielfalt
- Interreligiöse Pädagogik
- Sakralraumpädagogik mit Kindern
- Kritische Auseinandersetzung mit den dargestellten theoretischen Grundlagen
- Kritik am Kulturbegriff
- Kritik an der Sonderpädagogik und der integrativen Pädagogik, kritischer Blick auf zieldifferentes vs. einheitliches Lernen
- Biologischer versus kultureller Rassismus
- Ist eine Pädagogik der Vielfalt bzw. Inklusion in unserer Gesellschaft überhaupt möglich?
- Relevanz für die pädagogische Praxis
- Diversity in der Kindertageseinrichtung
- Haltung der Fachkraft
- Schlusswort/ Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema „Diversity“ und dessen Bedeutung und Konsequenzen für die Arbeit als Kindheitspädagog*innen. Sie analysiert verschiedene theoretische Konzepte, die mit Diversität zusammenhängen, wie Kultur, Genderpädagogik, Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung, interkulturelle Pädagogik, Integrationspädagogik, Pädagogik der Vielfalt, interreligiöse Pädagogik und Sakralraumpädagogik.
- Erläuterung des Begriffs „Kultur“ und seiner Relevanz im Kontext von Vielfalt
- Analyse von Genderpädagogik und den Herausforderungen im Umgang mit geschlechtsspezifischen Stereotypen
- Diskussion der Entstehung und Auswirkungen von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung
- Untersuchung der Konzepte der interkulturellen und integrativen Pädagogik und ihrer Bedeutung für die Arbeit mit Kindern
- Bewertung der „Pädagogik der Vielfalt“ und der interreligiösen Pädagogik im Hinblick auf die Förderung von Inklusion und Respekt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung von „Diversity“ und die Frage nach deren Konsequenzen für die Arbeit als Kindheitspädagog*innen in den Mittelpunkt. Sie führt das Zitat „Ich bin nicht du und ich weiß dich nicht“ (Prengel, 2006, S. 185) ein, welches die Grundhaltung der Pädagogik der Vielfalt beschreibt. Des Weiteren werden die zentralen Fragen der Arbeit beleuchtet und der Aufbau der Hausarbeit skizziert.
Hauptteil
Theoretische Annäherung an das Schwerpunktthema
Dieser Abschnitt befasst sich mit verschiedenen theoretischen Konzepten, die mit Diversity in Verbindung stehen. Zunächst wird der Begriff „Kultur“ erläutert und verschiedene Definitionen sowie die Dimensionen von Individualismus und Kollektivismus vorgestellt.
Danach wird die Genderpädagogik behandelt, mit Fokus auf die Entwicklung des Geschlechterbewusstseins bei Kindern und die Entstehung von geschlechtsspezifischen Stereotypen.
Der Abschnitt geht auch auf Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung sowie ihre Entwicklungsursachen ein und stellt das Anti-bias-Projekt als Beispiel für vorurteilsbewusste Bildung vor.
Im Anschluss werden die interkulturelle Pädagogik, ihre Entstehung und ihre Ziele, sowie die Integrationspädagogik, ihre historischen Hintergründe und ihre aktuelle Relevanz diskutiert.
Dieser Teil der Arbeit stellt auch die Pädagogik der Vielfalt und die interreligiöse Pädagogik vor, wobei die facettenreiche Bedeutung von Religionen beleuchtet wird.
Zum Abschluss wird die Sakralraumpädagogik mit Kindern als ein wichtiger Bildungsinhalt behandelt.
Kritische Auseinandersetzung mit den dargestellten theoretischen Grundlagen
Dieser Abschnitt nimmt die theoretischen Konzepte des Hauptteils unter kritische Betrachtung. Es werden Argumente unterschiedlicher Positionen zu den Kritikpunkten an den Begriffen „Kultur“, Sonderpädagogik und integrative Pädagogik, sowie zum biologischen und kulturellen Rassismus dargestellt.
Relevanz für die pädagogische Praxis
Dieser Teil behandelt die Umsetzung von Diversity in der Kindertageseinrichtung und beleuchtet die Haltung und das Denken der pädagogischen Fachkraft im Umgang mit Vielfalt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema „Diversity“ in pädagogischen Kontexten, insbesondere in der Arbeit mit Kindern. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Kultur, Genderpädagogik, Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung, Interkulturelle Pädagogik, Integrationspädagogik, Pädagogik der Vielfalt, Interreligiöse Pädagogik, Sakralraumpädagogik, Inklusion, Bildung, Erziehung, Kindertageseinrichtung, Fachkraft.
- Quote paper
- Mareike Wintermeyer (Author), 2018, Diversity. Bedeutung und Konsequenzen für die Arbeit als Kindheitspädagog*in, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1039838