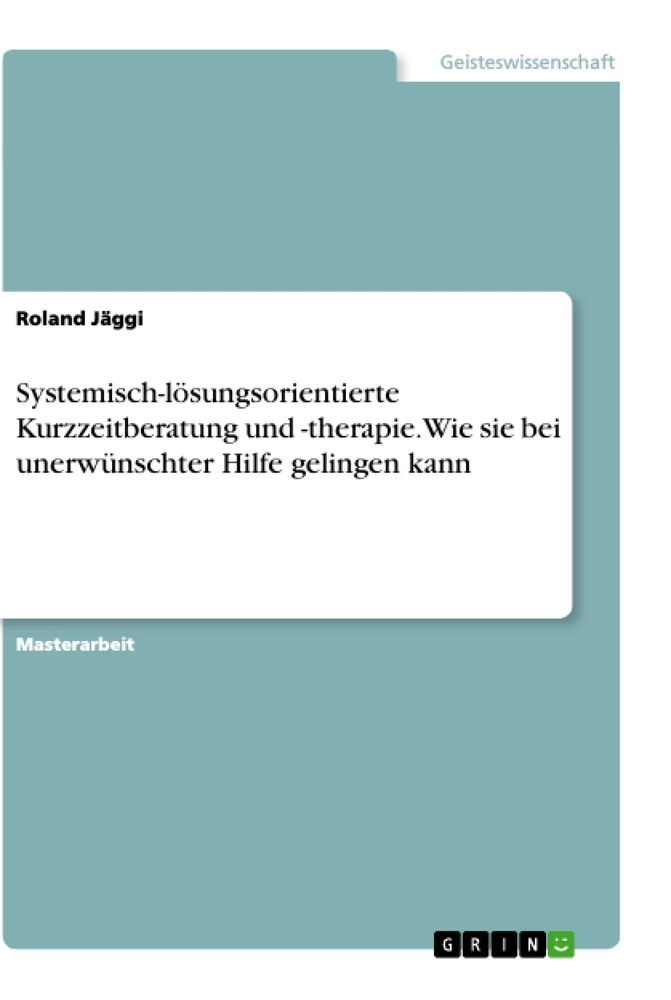Die vorliegende MAS Thesis beschäftigt sich mit der systemisch-lösungsorientierten Beratung und Erhöhung von intrinsischer Motivation unter erschwerten Bedingungen, nämlich im Zwangskontext der Sozialpädagogischen Familienbegleitung (SPF). Diese basiert im Wesentlichen auf einer Unfreiwilligkeit der Klientel und fremdinitiierter Kontaktaufnahme. Wie Beratung trotz unverhandelbarer Ziele und unterschiedlicher Problemdefinitionen hilfreich sein kann und welche Methoden des systemisch-lösungsorientierten Ansatzes dabei förderlich sind, werden in dieser MAS vorgestellt.
Dazu erfolgt in einem ersten Schritt eine Auseinandersetzung mit Zwang, was unter Zwangskontexten im rechtlichen Sinn verstanden wird und welche unterschiedlichen Formen es gibt. Zudem wird die Sozialpädagogische Familienbegleitung als Arbeitsfeld vorgestellt. In einem zweiten Teil werden Widerstandsfaktoren, Umgang mit Reaktanz und deren positiven Funktionen zusammengeführt und anschliessend daraus handlungsorientierte Kriterien für die Methodenwahl definiert. Resultierend darauf werden themenrelevante Aspekte und Grundhaltungen des systemisch-lösungsorientierten Ansatzes und der Motivierenden Gesprächsführung herausgearbeitet und mit Hilfe eines empirischen Praxismodells ergänzt.
Ziel vorliegender Arbeit ist eine Annäherung an das Phänomen des Zwangskontextes in der SPF und eine Antwort darauf, welche theoriegeleiteten Methoden und evidenzbasierten Wirkfaktoren in der Beratung eingesetzt werden sollten. Darüber hinaus werden Ergebnisse dargelegt, wie es Fachkräften gelingen kann, die Klientel trotz Widerstand für eine Zusammenarbeit zu motivieren, wie Ambivalenzen positiv genutzt werden können und welche Chancen und Herausforderungen sich dabei zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation und Begründung der Themenwahl
- 1.2 Idee und Anliegen
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 1.4 Eingrenzung des Themas, zentrale Fragestellung
- 1.5 Relevanz für die Soziale Arbeit und Praxisfeld
- 2. Der systemisch-lösungsorientierte Ansatz SLOA
- 2.1 Entstehung des SLOA
- 2.2 Fachlicher Diskurs
- 2.3 Grundannahmen und Grundhaltung des SLOA
- 2.4 Elemente des SLOA und Beziehungstypen
- 2.5 Grundbegriffe im SLOA
- 2.5.1 Selbstorganisation/Autonomie
- 2.5.2 Konstruktivismus
- 2.5.3 Zirkularität
- 2.6 Zusammenfassung
- 3. SPF und Zwangskontext
- 3.1 Entstehung und Geschichte der SPF
- 3.2 Was ist SPF?
- 3.3 Definition von Zwang und Zwangskontext
- 3.4 Zwangskontext in der SPF
- 3.5 Formen von Zwangskontexten in der SPF
- 3.6 Doppel- und Trippelmandat in der Sozialen Arbeit
- 3.7 Macht und ethische Diskussion
- 3.8 Professionelle Haltung im Zwangskontext
- 3.9 Erfolgreiche Methoden im Zwangskontext
- 3.10 Das Beratungsgespräch im Zwangskontext aus lösungsorientierter und systemischer Sicht
- 3.11 Unterschiede im SLOA
- 3.12 Was ist Motivation und Motivation im Zwangskontext?
- 3.13 Motivationsfaktoren und Motivationsprozesse im Zwangskontext
- 3.14 Zusammenfassung
- 4. Widerstand
- 4.1 Definition von Widerstand
- 4.2 Formen von Widerstand und Abgrenzung zum Widerstandbegriffs
- 4.3 Umgang und Haltung gegenüber Widerstand in der Motivierenden Gesprächsführung
- 4.4 Umgang und Haltung gegenüber Widerstand im SLOA
- 4.5 Umgang und Haltung gegenüber Widerstand in der SPF
- 4.6 Gemeinsamkeiten der Motivierenden Gesprächsführung und dem SLOA
- 4.7 Ursachen und Formen von Reaktanz
- 4.8 Auftreten und Ursachen für Widerstand
- 4.9 Positive Funktionen von Widerstand
- 4.10 Zusammenfassung
- 5. Wirkfaktoren im Zwangskontext der SPF
- 5.1 Begriffsklärung Wirkfaktoren
- 5.2 Wirkfaktoren in der Beratung
- 5.2.1 Beziehungs- und Rollengestaltung
- 5.2.2 Problemerfassung
- 5.2.3 Auftragsklärung und Arbeitsbündnis
- 5.2.4 Ressourcen- und Stärkenorientierung
- 5.2.5 Gelingende Kooperation
- 5.2.6 Motivierende Gesprächsführung
- 5.2.7 Motivorientierte Beziehungsgestaltung
- 5.3 Aussertherapeutische Faktoren
- 5.4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende MAS Thesis beschäftigt sich mit der systemisch-lösungsorientierten Beratung und der Erhöhung von intrinsischer Motivation in Zwangskontexten der Sozialpädagogischen Familienbegleitung. Sie untersucht, wie Beratung trotz unverhandelbarer Ziele und unterschiedlicher Problemdefinitionen hilfreich sein kann und welche Methoden des systemisch-lösungsorientierten Ansatzes dabei förderlich sind.
- Analyse des Zwangskontextes in der Sozialpädagogischen Familienbegleitung (SPF)
- Erfassung von Widerstandsfaktoren und dem Umgang mit Reaktanz in diesem Kontext
- Entwicklung von Handlungskriterien für die Auswahl geeigneter Methoden des systemisch-lösungsorientierten Ansatzes
- Identifizierung und Darstellung von Wirkfaktoren, die zur Motivation der Klientel trotz Widerstand beitragen
- Bewertung von Chancen und Herausforderungen im Einsatz des systemisch-lösungsorientierten Ansatzes in Zwangskontexten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Motivation und Begründung der Themenwahl erläutert, den Aufbau der Arbeit beschreibt und die Relevanz für die Soziale Arbeit und das Praxisfeld SPF beleuchtet. Anschliessend werden die Entstehung, die Grundannahmen und -haltungen sowie die Grundbegriffe des systemisch-lösungsorientierten Ansatzes (SLOA) dargestellt. Kapitel 3 widmet sich der SPF und dem Zwangskontext, wobei die Entstehung und Geschichte der SPF, die Definition von Zwang, die verschiedenen Formen von Zwangskontexten und die ethische Diskussion der Machtverhältnisse behandelt werden. Der Umgang mit Widerstand im Zwangskontext wird in Kapitel 4 untersucht. Dabei werden die verschiedenen Formen von Widerstand, die Ursachen und positiven Funktionen von Reaktanz sowie die Gemeinsamkeiten der Motivierenden Gesprächsführung und dem SLOA im Umgang mit Widerstand thematisiert. Kapitel 5 beschäftigt sich mit Wirkfaktoren in der Beratung im Zwangskontext und beleuchtet die Bedeutung von Beziehungs- und Rollengestaltung, Problemerfassung, Auftragsklärung, Ressourcenorientierung, Kooperation und motivierender Gesprächsführung.
Schlüsselwörter
Sozialpädagogische Familienbegleitung, Zwangskontext, systemisch-lösungsorientierter Ansatz, Motivierende Gesprächsführung, Widerstand, Reaktanz, Motivationsfaktoren, intrinsische Motivation, Wirkfaktoren, Beziehungsarbeit, Empowerment, professionelle Haltung, ethnische Aspekte.
- Quote paper
- Roland Jäggi (Author), 2021, Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeitberatung und -therapie. Wie sie bei unerwünschter Hilfe gelingen kann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040127