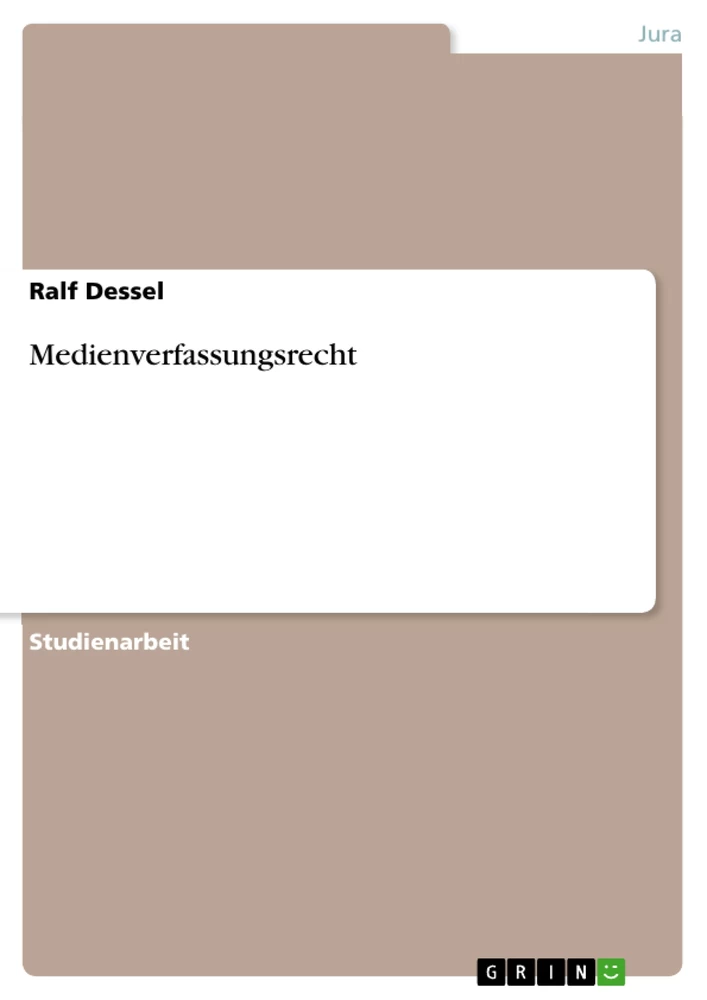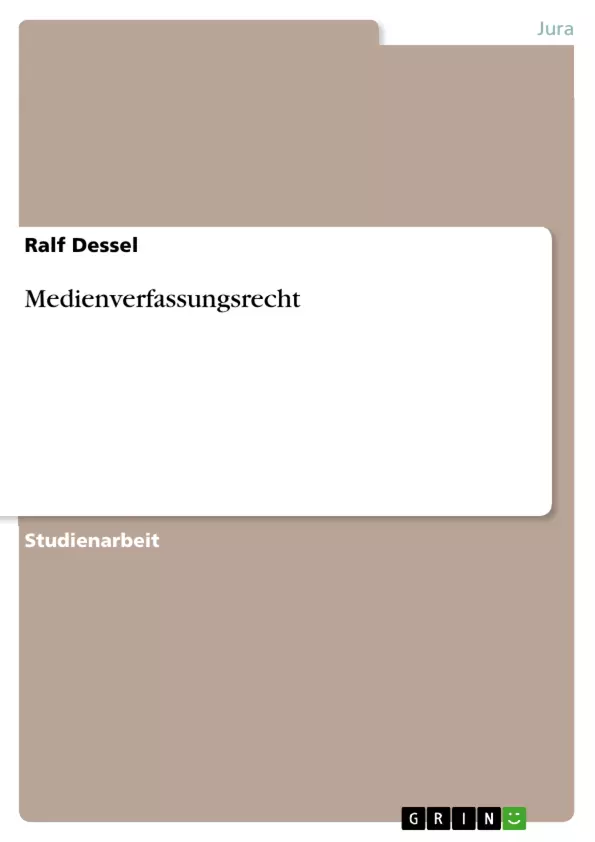Inhaltsverzeichnis
Frage
1. Gesetzgebungsrecht der Länder
1.1. Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes aus Art. 73 Nr. 7 GG, Postwesen und Tele kommunikation,
1.1.1. Definition Internet
1.1.2. Individual- oder Massenkommunikation
1.1.3. Regelungsbefugnis für Telekommunikationsinhalte
1.1.3.1. Internet als Rundfunk
1.1.3.2. Eingrenzung des weiten Rundfunkbegriffs
1.1.3.3. Zwischenergebnis
1.2. Konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis, Art. 72, 74 I Nr. 11 GG, Recht der Wirtschaft
1.3. Befugnis zur Rahmengesetzgebung aus Art. 75 I 1 Nr. 2 GG, allgemeine Rechtsverhält nisse der Presse
1.3.1. keine Anwendbarkeit des Pressebegriffs auf das Internet
1.3.2. Anwendbarkeit des Pressebegriffs auf das Internet
1.3.3. Streitentscheid
1.3.4. Erfordernis einer bundesgesetzlichen Regelung
1.3.5. Voraussetzungen des Art. 75 II GG
1.3.6. Zwischenergebnis
1.4. Zwischenergebnis
1.5. Kompetenzergänzungen
2. Ergebnis
3. Verwaltungskompetenz des Bundes Frage
1. Rechte der Inhaltsanbieter
1.1. Grundrechte aus Art. 5 I GG
1.1.1. Schutzbereich Meinungsäußerungsfreiheit, Art. 5 I 1 1. Alt. GG
1.1.2. Schutzbereich Pressefreiheit, Art. 5 I 2 1. Var. GG
1.1.3. Schutzbereich Rundfunkfreiheit, Art. 5 I 2 2. Var. GG
1.1.4. Eingriff in die Schutzbereiche
1.1.5. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
1.1.5.1. Schranke der allgemeinen Gesetze
1.1.5.2. Schranken aus dem Jugendschutz
1.1.5.3. Schranken-Schranken
1.1.5.3.1. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
1.1.5.3.2. Wechselwirkungslehre
1.1.5.3.3. Zensurverbot, Art. 5 I 3 GG
1.1.6. Zwischenergebnis
1.2. Kunstfreiheit, Art. 5 III 1 1. Alt. GG
1.2.1. Schutzbereich
1.2.2. Eingriff
1.2.3. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
1.2.4. Zwischenergebnis
1.3. Fernmeldegeheimnis, Art. 10 I 3. Alt. GG
1.3.1. Schutzbereich
1.3.2. Eingriff
1.3.3. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
1.3.3.1. Schranke des einfachen Gesetzesvorbehalts
1.3.3.2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
1.3.4. Zwischenergebnis
2. Recht der Nutzer als Konsumenten
2.1. Informationsfreiheit, Art. 5 I 1 2. HS GG
2.1.1. Schutzbereich
2.1.2. Eingriff
2.1.3. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
2.1.4. Zwischenergebnis
2.2. Fernmeldegeheimnis, Art. 10 I 3. Alt. GG
3. Rechte der Provider
3.1. eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb, Art. 14 I 1 GG
3.1.1. Schutzbereich
3.1.2. Zwischenergebnis
3.2. Berufsfreiheit, Art. 12 I 1 GG
3.2.1. Schutzbereich
3.2.2. Eingriff
3.2.3. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
3.2.3.1. Schranke des Gesetzesvorbehalts
3.2.3.2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
3.2.4. Zwischenergebnis
4. Ergebnis
Ralf Dessel
Fachsemester 07
Prof. Dr. U. Rühl
Hausarbeit im Schwerpunkt
„Wirtschaftsverwaltungsrecht“
Themenbereich „Medienverfassungsrecht“
Prof. Dr. U. RühlWintersemester 2000/ 2001
Hausarbeit (09.02.2001)
im Schwerpunkt „Wirtschaftsverwaltungsrecht“,
Themenbereich „Medienverfassungsrecht“
(fiktiver)Sachverhalt:
Zwischen der Bundesregierung, den Landesregierungen und den sie tragenden Parteien in Bundestag und Länderparlamenten gibt es einen breiten Konsens, dass der Verbreitung von (Kinder-) Pornografie, Gewaltdarstellungen, Aufforderungen zur Gewalt und rassistischer, nazistischer und neonazistischer Propaganda entgegengetreten werden muss. Daher hat es sich bisher als Hindernis einer effektiven Bekämpfung erwiesen, dass die genannten, in Deutschland strafbaren Medieninhalte über das Internet verbreitet werden. Kinderporno- grafie und NS-Propaganda etc. werden vom Ausland aus verbreitet; sie liegen auf Servern im Ausland, die nicht dem Zugriff der deutschen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden unterliegen. Selbst dann, wenn eine Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfo lgungs- behörden angebahnt worden ist, entziehen sich die Anbieter strafbarer Medieninhalte der Verfolgung, indem sie mit ihren Servern in ein „sicheres“ Land wechseln. Strafverfolgung ist dadurch nahezu unmöglich. Darüber hinaus besteht aber Konsens, dass die Strafverfo l- gung zu spät kommt, und dass eigentlich eine effektive Prävention (Gefahrenabwehr) er- forderlich wäre. Da die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern dieser Entwick- lung nicht tatenlos zusehen wollen, wird auf Vorschlag einer Kommission von Internetex- perten folgende Lösung des Problems erwogen:
- Durch neuere Entwicklungen der Software gibt es effektive Filter, die bestimmte
Medieninhalte und Internetadressen (URL) erkennen, „herausfiltern“ und blockieren können - den Internetfilter gegen strafbare Inhalte (IFSTRI).
- Es wird eine Behörde eingerichtet, die das Internet auf strafbare Medieninhalte hin
durchsucht und die Internetadressen (URL) von ausländischen Servern ermittelt, diesen Erkenntnisstand ständig aktualisiert und den Filter entsprechend anpasst.
- Da die allermeisten privaten Nutzer des Internet ihren Zugang durch einen „Provi-
der“ erlangen, werden die Provider (wie T-Online, AOL etc.) gesetzlich verpflich- tet, den IFSTRI vorzuschalten, so dass strafbare Medieninhalte nicht mehr ins Land gelangen können. Andere Institutionen mit einem Zugang ins Internet, wie Unive r-
sitäten, Firmen usw.; müssen ebenfalls den Filter vorschalten, damit Umgehungs-
möglichkeiten ausgeschlossen werden.
Es besteht zudem Einigkeit, dass der Internetfilter nur benutzt werden soll, um Medienin- halte abzublocken, die Straftaten von erheblichem Gewicht darstellen würden, weil sie sich z.B. gegen die Menschenwürde oder andere wichtige Verfassungsgüter richten, wie z.B. Volksverhetzung und Aufforderung zum Rassenhass (§ 130 StGB), Gewaltdarstellungen im Sinn von § 131 StGB, Pornografie im Sinn von § 184 StGB, insbesondere sexuellen Mißbrauch von Kindern (§ 184 Abs. 3 StGB), Kriegsverherrlichung, Anleitung zu Strafta- ten nach § 130 a StGB, nazistische und neonazistische Propaga nda im Sinn von §§ 86, 86 a StGB.
Die federführende Bundesregierung möchte sich über die verfassungsrechtliche Zulässig- keit des Vorhabens „Internetfiltergesetz“ (ITFG) Gewissheit verschaffen, bevor mit der Ausarbeitung der rechtstechnischen Details in einem Gesetzentwurf begonnen wird. Es soll deshalb ein Rechtsgutachten eingeholt werden zu den folgenden Grundsatzfragen:
1. Kann das Ziel mit einem Bundesgesetz erreicht werden oder fällt die Materie in den Kompetenzbereich der Länder, so dass ein Länderstaatsvertrag erforderlich wäre?
2. Wären ein entsprechendes Bundesgesetz oder ein Länderstaatsvertrag gleichen Inhalts materiell verfassungsgemäß? (Dabei sind Rechte der Nutzer und der Provider zu be- rücksichtigen.)
Aufgabenstellung: Erstellen Sie das Rechtsgutachten!
Bearbeiterhinweis: Technische Fragen wie z.B., ob heutige Internetfilter technisch geeig- net sind, den Zweck zu erreichen, sind nicht zu erörtern. Es handelt sich um einen fiktiven Fall und es ist zu unterstellen, dass es in der Zukunft technisch effektive und trennscharfe Filter gibt, die „zulässige“ Inhalte unberührt lassen (Problem des sog. Overblocking).
Bearbeitungszeit und Abgabe: Die Bearbeitungszeit beträgt ab 09.02.2001 vier Wochen; Abgabetermin ist Montag, der 12.03.2001 bis 24.00 Uhr, roter Kasten (Fachbereichsve r- waltung) oder Außenbriefkasten (Universitätsallee). Bei Postzusendung gilt der Poststempel. Die Postadresse lautet: Prof. Dr. U. Rühl, Universität Bremen, Fachbereich 6 Rechtswissenschaft, Universitätsallee GW 1, 28359 Bremen.
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Frage 1
Fraglich ist zunächst, ob die Gesetzgebungskompetenz für den Erlaß des Internetfiltergesetzes beim Bund oder bei den Ländern liegt.
1. Gesetzgebungsrecht der Länder
Nach Art. 30, 70 I GG haben die Länder grundsätzlich das Recht zur Gesetz- gebung, soweit sich nicht aus dem Grundgesetz eine Verleihung von Gestzge- bungsbefugnissen an den Bund ergibt. Dies kann insbesondere im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes nach Art. 71 GG i.V.m. Art. 73 GG bzw. nach Art. 72 GG i.V.m. Art. 74 GG bei der konkurrierenden Gesetz- gebung der Fall sein. Daneben kommt auch eine Rahmengesetzgebungskom- petenz aus Art. 75 GG in Betracht.
1.1. Ausschließliche Gesetzgebung des Bundes aus Art. 73 Nr. 7 GG,
Postwesen und Telekommunikation, Die Befugnis des Bundes könnte sich aus Art. 73 Nr. 7 GG ergeben. Dann müßte das Internetfiltergesetz einen Regelungsgegenstand betreffen, der unter den Begriff der Telekommunikation iSv. Art. 73 Nr. 7 GG zu fassen ist. Unter Telekommunikation, die vom Inhalt her das gleiche umfaßt, wie der bis 1994 im GG aufgeführte Begriff des „Fernmeldewesens“1, wird die Übermitt- lung von Informationen auf fernmeldetechnischem Weg, also mittels analoger oder digitaler elektromagnetischer Schwingungen, leitungsgebunden oder drahtlos verstanden, wobei der Begriff entwicklungsoffen ist.2Zum Begriff der Telekommunikation zählen neben den Fernmeldediensten u.a. auch alle derzeitigen und künftigen Formen der Individual- und Massen- kommunikation,3insbesondere auch der Rundfunk iSv. Art. 5 I 2 GG.4Wo hier die Multimediadienste einzuordnen sind - zu denen auch die ver- schiedenen Angebote des Internet zählen - und der inhaltlich die Möglichkeit betrifft, weltweit elektronisch gespeicherte Informationen jeglicher Art abzu- rufen und zu versenden, ist noch nicht genau festgelegt.5
1.1.1. Definition Internet
Das Internet ist das weltweit größtes Computernetzwerk, das aus mehreren Millionen fest angeschlossenen Rechnern (Knotenrechner) in etwa 30 000 Computernetzen besteht. Die Anwender haben die Möglichkeit, per Persona l- computer, Modem und entsprechender Software im Internet Online-Dienste zu nutzen, in Datenbanken zu recherchieren oder Nachrichten zu empfangen und zu verschicken, wobei der Zugang zum Internet von verschiedenen Service- Providern gegen eine monatliche Gebühr angeboten wird. Das Angebot an Diensten im Internet umfaßt u.a. elektronische Post (Email), Dateitransfer, Diskussionsforen zu unterschiedlichsten Themenbereichen, elektronische Zeitschriften und Datenbankabfragen.6
1.1.2. Individual- oder Massenkommunikation
Es ist umstritten, ob das Internet zur Individual- oder zur Massenkommunika- tion zu zählen ist. Diese mögliche Abgrenzung ist wichtig im Hinblick auf die Frage, ob und ggf. inwieweit auf Grundlage des Art. 73 Nr. 7 GG der Bund neben den technischen auch die inhaltlichen Aspekte der Telekommunikation regeln darf.7
Mit dem geplanten Internetfiltergesetz und der daraus resultierenden Verpflichtung für die Provider und anderen Zugangsanbieter, den Internetfilter gegen strafbare Inhalte (IFSTRI) vorzuschalten, wird zwar grundsätzlich eine technische Frage der Telekommunikation berührt. Da dieser Filter aber darauf abzielt, bestimmte Inhalte zu blockieren und darüber hinaus eine Behörde eingerichtet werden soll, die festlegt, welche Inhalte von dem Filter erfaßt werden sollen, ist mit dem Gesetz nicht nur eine technische, sondern auch eine inhaltliche Regelung der Telekommunikation verbunden.
Unumstritten umfaßt diese Kompetenznorm im Bereich des Rundfunks für den Bund nur die Befugnis, die fernmeldetechnische Seite, nicht aber dessen programminhaltliche Seite zu regeln.8
Nach wohl h.M. stand früher dem Reich und steht heute dem Bund die Befug- nis zu, für die Teilnahme am individualkommunikativen Telegraphen- und Fernsprechdienst als Voraussetzung festzulegen, daß z. B. auch anstößige Äu ßerungen unterblieben.9Diese Kompetenz des Bundes dürfte wegen der Vergleichbarkeit auch für den Internetdienst „Email“ gelten10, so daß für diesen Bereich auch eine inhaltliche Regelungskompetenz auf Grundlage des Art. 73. Nr. 7 GG gegeben ist.
Bestimmte Dienste im Internet, wie z.B. über das Internet ausgestrahlte, über bestimmte Homepages „anzuwählende“ Radioprogramme, stellen reine Massenkommunikation dar; aber auch andere Interne tangebote, wie z.B. offene Diskussionsforen, enthalten noch massenkommunikative Elemente, jedoch mit starken individualkommunikativen Prägungen.11
Danach umfaßt das Internet neben rein individualkommunikativen Diensten und ausschließlich massenkommunikativen Bereichen auch Dienste, die beiden Formen nicht oder nicht eindeutig zuzurechnen sind.12
Damit ist abschließend festzuhalten, daß eine eindeutige Zuordnung des Internets als ganzes zu einem der beiden Bereiche nicht möglich ist.
1.1.3. Regelungsbefugnis für Telekommunikationsinhalte
Da das Internet sowohl Individual- als auch Massenkommunikation umfaßt und nicht einem Bereich exklusiv zuzuordnen ist, ist zu klären, inwieweit Art.
73 Nr.7 GG auch die Kompetenz für den Bundesgesetzgeber enthält, inhaltli- che Fragen der Massenkommunikation im Internet zu regeln. Teilweise wird aufgrund des „ersten Rundfunkurteils“ des BVerfG und der darin aufgestellten Differenzierung von technischen und inhaltlichen Aspek- ten13angenommen, die Kompetenz des Bundes erstrecke sich für jede mögli- che Telekommunikationsform, insbesondere auch im Bereich der Neuen Me- dien, nur auf die technische Seite.14
Danach wäre der Erlaß des Internetfiltergesetzes mit seinem auch inhaltsre- gelnden Charakter nicht aufgrund Art. 73 Nr. 7 GG durch den Bund möglich. Ein anderer Teil der Literatur zieht zusätzlich zu dem vorgenannten Urteil auch das „Direktruf-Urteil“15des BVerfG heran und geht, sofern es sich nicht um Rundfunk handelt, danach von einem sehr weiten, auch Inhaltsrege- lungen zulassenden Kompetenztitel aus, da das „erste Rundfunkurteil“ und die darin gemachten Aussagen zum Inhalt von Telekommunikation sich nur auf Rundfunkinhalte beziehen soll.16
Daher ist für die Anwendbarkeit dieser Auffassung fraglich, ob das Internet mit seinen massenkommunikativen Diensten unter den Rundfunkbegriff zu subsumieren ist. Wenn und soweit dies nicht der Fall ist, wären nach dieser Auffassung auch inhaltliche Regelungen im Rahmen der Zuständigkeit für Telekommunikation möglich. Unterfällt aber die Massenkommunikation im Internet dem Rundfunkbegriff, wäre in jedem Fall, auch nach der weiten Kompetenzauffassung, eine inhaltliche Regelung nicht zulässig.
1.1.3.1. Internet als Rundfunk
Der Begriff des Rundfunks, der im GG nicht näher bestimmt ist, wird unter Zugrundelegung der Reichweite der Rundfunkgarantie aus Art. 5 I 2 GG defi- niert als ein für die Allgemeinheit bestimmter, Darbietungen aller Art umfas- sender Dienst, der fernmelde- bzw. telekommunikationstechnisch verbreitet wird.17
Das Internet hält neben den rein individuellen Diensten auch eine Vielzahl von an die Allgemeinheit gerichtete Darbietungen aller Art in Form von z.B. Text-, Bild- oder Tonübertragungen als Abruf- oder Zugriffsdienste bereit. Die Verbreitung geschieht mittels elektrischer Schwingungen, ist mithin als telekommunikationstechnisch zu bezeichnen.18
Danach wäre dieser große massenkommunikative Bereich des Internets dem Rundfunk zuzuordnen.
1.1.3.2. Eingrenzung des weiten Rundfunkbegriffs
Fraglich ist jedoch, ob diese drei Elemente eine ausreichende Abgrenzung des Rundfunks von anderen Massenkommunikationsmittel erlauben oder ob weitere Kriterien zur Abgrenzung erforderlich sind, damit sich der Rundfunkbegriff nicht zu stark ausweitet und somit alle nicht ausschließlich individua l- kommunikativen Dienste mit umfaßt.19
Anknüpfungspunkt für eine Eingrenzung des Rundfunkbegriffs könnte der aus den einfachgesetzlichen Regelungen entnommene funktionale Rundfunkbegriff sein, wonach ein Dienst dann zum Rundfunk zählt, wenn ein planhaftes, ablaufendes, redaktionell gestaltetes Gesamtprogramm bzw. der Zugriff darauf angeboten wird.20
Grundsätzlich unterscheiden sich die Abruf- und Zugriffdienste, wie z.B. das WWW, von zeitlich ablaufenden und redaktionell gestalteten Fernseh- und Hörfunkprogrammmen.21
Damit bleibt festzuhalten, daß der Rundfunkbegriff neben den individua l- kommunikativen Diensten auch nicht für den überwiegenden Teil der massenkommunikativen Dienste gilt. Hiervon ausgenommen ist lediglich der Empfang von Internetradio, auf den auch diese einschränkende Definition des Rundfunkbegriffs zwingend zutrifft.22
1.1.3.3. Zwischenergebnis
Trotz der Eingrenzung des Rundfunkbegriffs durch die zusätzlichen Anforderungen ist ein, wenn auch nur geringer Teil in Form des Internetradios, der a- ber auch dazu geeignet ist, in diesem konkreten Fall einen Teil der für das Gesetzesvorhaben relevanten Straftaten, wie z.B. die Volksverhetzung oder Aufforderung zum Rassenhaß, zu begehen, unter den Rundfunkbegriff zu subsumieren. Eine Kompetenz zum Erlaß inhaltsregelnder Vorschriften scheidet für das reine Internetradio nach beiden Auffassungen aus.
Für die übrigen massenkommunikativen Dienste ist im Hinblick auf die mög- liche Kompetenz, auch inhaltliche Aspekte auf Grundlage des Art. 73 Nr. 7 GG zu regeln entscheidend, welcher der unter 1.1.3. aufgeführten Auffassun- gen gefolgt wird.
Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG23war es mit Blick auf die mei- nungsbildende Wirkung des Massenmediums „Rundfunk“ im wesentlichen Sinn und Zweck, die inhaltlichen Regelungen in die Kompetenz der Länder zu geben, eine möglichst breit angelegte Möglichkeit zur Meinungsbildung zu gewährleisten, die nicht „zentral“ durch den Bund gesteuert wird. Unter die- sem Aspekt ist, auch unter der besonderen Berücksichtigung des Normzwecks des Internetfiltergesetzes davon auszugehen, daß der Ausschluß der Kompe- tenz, Inhaltsregelungen zu treffen, für alle unter den Begriff der Telekommunikation fallenden massenkommunikativen Dienste gilt.
Damit ist auch nach der Ansicht, die von einem weitreichenden Kompetenzbe- reich, der nur inhaltliche Regelungen im Bezug auf Rundfunkinhalte aus- schließt, eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Gesetz insoweit ausgeschlossen, als im Hinblick auf Massenkommunikation die inhaltliche Seite des Internetfilters betroffen ist. Eine Gesetzgebungskompetenz für den Bund nach Art. 73 Nr. 7 GG ist danach nur für den technischen Bereich des Internetfiltergesetzes vorhanden sowie für die rein individualkommunikativen Dienste gegeben.
1.2. Konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis, Art. 72, 74 I Nr. 11 GG,
Recht der Wirtschaft Eine Befugnis zum Erlaß des Internetfiltergesetzes könnte sich auch aus Art.
74 I Nr. 11 GG ergeben, wonach der Bund das Recht der konkurrierenden Gesetzgebung für den Bereich der Wirtschaft hat.
Die Kompetenz umfaßt nicht nur den Erlaß von Vorschriften, die sich in ir- gendeiner Form auf die Erzeugung, Herstellung und Verteilung von Gütern des wirtschaftlichen Bedarfs beziehen, sondern auch alle anderen das wir t- schaftliche Leben und die wirtschaftliche Betätigung als solche regelnden Normen, die wirtschaftsregulierenden oder -lenkenden Inhalt haben.24Insoweit könnte im Hinblick auf die Provider, in deren wirtschaftliche Betäti- gung mit der Verpflichtung, den Filter vorzuschalten, zumindest mittelbar eingegriffen wird, dem geplanten Gesetz ein wirtschaftlich lenkender Inhalt zugebilligt werden, was in Bezug auf diesen Teilaspekt eine Gesetzgebungs- kompetenz des Bundes aus Art. 74 I Nr. 11 GG begründen könnte. Durch das angestrebte Gesetz sollen erheblich strafbare Internetinhalte abge- blockt werden. Insoweit hat der Internetfilter einen präventiven Charakter. Die Befugnis aus Art. 74 I Nr. 11 GG erlaubt dem Bund auch, sicherheits- rechtliche Regelungen zu erlassen, wenn sie sich als Annex des Rechts der Wirtschaft darstellen und der Zweck der gesetzlichen Regelung sich nicht al- lein auf die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beschränkt.25
Das geplante Gesetz soll erlassen werden, da eine Strafverfolgung für die An bieter der strafbaren Inhalte nur schwer möglich ist. Zweck des Gesetzes ist daher ausdrücklich die Prävention, also die Gefahrenabwehr in der Form, daß die strafbaren Inhalte blockiert werden.
Folglich dient das Gesetz alleine der Gefahrenabwehr und ist nicht nur ledig- lich Annex einer wirtschaftregulierenden oder -lenkenden Norm. Vielmehr stellt sich andersherum die mögliche, geringe wirtschaftliche Relevanz des Internetfiltergesetzes für die Zugangsanbieter als Reflex der Gefahrenabwehr dar.
Eine Gesetzgebungsbefugnis des Bundes zum Erlaß des Internetfiltergesetzes aus Art. 74 I Nr. 11 GG besteht daher nicht.
1.3. Befugnis zur Rahmengesetzgebung aus Art. 75 I 1 Nr. 2 GG, all-
gemeine Rechtsverhältnisse der Presse Eine Kompetenz des Bundes zum Erlaß des Internetfiltergesetzes könnte sich aus der Rahmenkomompetenz des Art. 75 I 1 Nr. 2 GG ergeben. Dies setzt voraus, daß das Internet oder bestimmte Dienste unter den Begriff der „Presse“ zu subsumieren sind.
Der Pressebegriff im Sinne dieser Kompetenznorm hat denselben Inhalt wie der in Art. 5 I 2 GG.26Der somit weit auszulegende Pressebegriff umfaßt jedenfalls alle zur Verbreitung an die Allgemeinheit geeigneten und bestimmten Druckerzeugnisse, nicht nur Zeitungen, Zeitschriften und andere Periodika, wobei der Begriff entwicklungsoffen ist.27
1.3.1. keine Anwendbarkeit des Pressebegriffs auf das Internet
Bei der Bestimmung, ob etwas unter den Begriff der Presse zu fassen ist, wird traditionell in Abgrenzung zum Rundfunk mit dem Wesen der körperlosen Übertragung auf die stofflich-gegenständliche Verkörperung des Gedankenin- halts abgestellt.28In den Landespressegesetzen werden darüber hinaus auch Ton- und Bildträger, wie z.B. Schallplatten, Ton- und Videokassetten erfaßt.29
Selbst, wenn man hier entgegen der h.M.30die Definition in den Landespres segesetzen zur Erweiterung des verfassungsrechtlichen Pressebegriffs heranzieht, wonach neben dem Papier auch Ton- und Bildträger erfaßt werden sollen, ändert nichts an dem Erfordernis der hiernach notwendigen stofflichgegenständlichen Verkörperung des Inhalts.
Infolgedessen fällt die körperlose Verbreitung von Gedankeninhalten in Ra h- men von massenkommunikativen Diensten im Internet nicht unter den tradit i- onellen Pressebegriff.
1.3.2. Anwendbarkeit des Pressebegriffs auf das Internet
Der Pressebegriff ist entwicklungsoffen und umfaßt auch Vervielfältigung un- ter Anwendung neuerer technischer Formen.31Daher wird von einer anderen Ansicht die Auffassung vertreten, daß auch die „elektronische Presse“ sowie pressegleiche Dienste unter den kompetenzrechtlichen Pressebegriff zu fassen seien.32Für die Einordnung dieser Dienste unter den Pressebegriff soll nicht allein auf den Weg der Verbreitung abgestellt werden, sondern auf die Stel- lung des Konsumenten.33
1.3.3. Streitentscheid
Eine streng traditionelle Auslegung des Pressebegriffs, die alleine auf Weg und Form der Verbreitung abstellt, führt im Hinblick auf die neuen Medien zu Abgrenzungsproblemen.34
Ein starres Festhalten an dem Kriterium der Verkörperung würde dazu führen, daß die Entwicklungsoffenheit des Pressebegriffs extrem eingeschränkt wäre und nicht die fortschreitende technische Entwicklung berücksichtigt werden könnte.
Im Internet sind neben den presseähnlichen Abrufdiensten, wie z.B. in Newsgroups, auch vielfach „herkömmlich“ gedruckte Zeitungen mit ihren Ausgaben in digitalisierter Form und teilweise auch dazu ergänzenden Ange- boten vertreten.35Um den Pressebegriff entsprechend der Auffassung des BVerfG offen für Fortentwicklung zu halten, ist es nur konsequent, für Pres semedien, die der Presse zuzuordnen sind und die die Verbreitung über das Internet nur zusätzlich oder ergänzend nutzen, eine Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes anzunehmen.36
Fraglich ist jedoch die Bewertung von Text- und/ oder Bildangeboten, die ü- ber das Internet verbreitet werden und die über kein gleichzeitig verbreitetes körperliches Pendant in Form eines Druckerzeugnisses verfügen. Diese Grup- pe dürfte in den verschiedenen Internetdiensten den größten Raum einneh- men.37
Im Hinblick auf diese technische Entwicklung erscheint es problematisch, weiterhin an dem Merkmal der stofflichen Verkörperung festzuhalten. An- knüpfungspunkt für eine Beurteilung könnte daher zumindest im Hinblick auf das Lesen bzw. Betrachten eines stehenden Textes die vergleichbare Rezipien- tenstellung sein.38
Es macht keinen Unterschied, ob der Leser den Text von einem Druckwerk oder einem Bildschirm abliest. Gleiches muß auch für verknüpfte Text und Bildseiten oder für reine Bildseiten gelten, da diese auch in verkörperten Druckwerken abgebildet werden könnten.
Für diese Dienste im WWW und auch für Homepages oder Newsgroups, bei denen, wie bei der Nutzung eines gedruckten Presseerzeugnisses, die Mög- lichkeit der Selektion und anschließenden Rezeption das Hauptmerkmal ist39, ist eine Einordnung unter den kompetenzrechtlichen Pressebegriff vorzune h- men. Der Pressebegriff ist also für diese Dienste des Internet anwendbar.
1.3.4. Erfordernis einer bundesgesetzlichen Regelung
Nach Art. 75 I 1 GG i.V.m. Art. 72 II GG muß für die Begründung der Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes eine bundesgesetzliche Rege- lung zur Wahrung u.a. einheitlicher Rechtsverhältnisse erforderlich sein. "Rechtseinheit“ bedeutet das Gelten gleicher Rechtsnormen für die gleiche Angelegenheit im ganzen Bundesgebiet.40Der Begriff "Wahrung" muß auch in einem dynamischen Sinne verstanden werden, nicht nur die Aufrechterha l- tung umfassend, sondern auch die Schaffung von Einheitlichkeit.41
Die Erforderlichkeit einer Bundesregelung ist idR. nicht gegeben, wenn die Länder im Hinblick auf den angestrebten Zweck geeignete Regelungen in absehbarer Zeit erlassen werden.42
Hier besteht unter Bund und den Ländern Einigkeit, daß eine entsprechende Regelung zur Einführung des Internetfilters getroffen werden soll, weshalb davon auszugehen ist, daß die Länder - ihre Zuständigkeit vorausgesetzt - ei- gene Regelungen treffen werden. Insofern könnten Zweifel an der Erforder- lichkeit bestehen.
Gleichzeitig wird jedoch das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 72 II GG angenommen, wenn der Regelungsgegenstand die Grenzen eines Bundeslandes oder sogar die Grenzen zum Ausland überschreitet. Insoweit wird ein spezifischer Sachgrund für eine Bundesregelung angenommen.43Im vorliegenden Fall geht es darum, nach deutschem Recht strafbare Internetinhalte präventiv auszufiltern; gerade auch solche, die auf ausländischen Servern bereitgestellt und somit dem Zugriff deutscher Strafverfolgungsbehörden werden. Das Problem überschreitet also nicht nur die einzelnen Ländergrenzen, sondern auch die Grenzen der Bundesrepublik.
Diese Tatsache ist bei der Prüfung der Erforderlichkeit mit Blick auf eine ef- fektive Prävention stärker zu gewichten, als die Wahrscheinlichkeit des Erlas- ses inhaltsgleicher Vorschriften durch die Länder in absehbarer Zeit. Die Voraussetzungen des Art. 75 I 1 GG i.V.m. Art. 72 II GG sind mithin er- füllt.
1.3.5. Voraussetzungen des Art. 75 II GG
Fraglich ist, wie detailliert die Regelungen des Bundes im Bereich der Rahmengesetzgebung sein dürfen.
Grundsätzlich erlaubt die Gesetzgebungskompetenz nach Art. 75 I GG nur den Erlaß von Rahmenvorschriften, die der Ausfüllung durch die Landesge- setzgebung fähig und bedürftig sind.44Nur unter den strengen Voraussetzun- gen des Art. 75 II dürfen in Ausnahmefällen in Einzelheiten gehende oder unmittelbar geltende Regelungen erlassen werden. Ein solcher Ausnahmefall ist gegeben, wenn es Gründe mit einem ausreichenden Gewicht gibt, die diese Ausnahme rechtfertigen.45
Im Hinblick auf den Sinn und Zweck der Rahmenkompetenz, nämlich den Gesetzgebungsspielraum der Länder zu erhalten, müssen die für die Gewährung einer Ausnahme sprechenden Gründe desto gewichtiger sein, je mehr der Spielraum des Gesetzgebers eingeschränkt wird.46
Hier geht es darum, wegen der extrem schwierigen strafrechtlichen Ahndungsmöglichkeiten, ausschließlich Straftaten von erheblichem Gewicht im Vorfeld zu verhindern. Die in Rede stehenden Straftaten haben ausweislich der Abschnittsbezeichnungen im StGB als Schutzrichtung u.a. die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die Sicherung des demokratischen Rechtsstaates oder die Gewährung der sexuellen Selbstbestimmung zum Gegenstand, die wiederum selbst Gegenstand oder Ausfluß aus tragenden Verfassungsprinzipien oder elementaren Grundrechten sind.
Insofern handelt es sich um gewichtige Gesichtspunkte, zu deren Schutz eine schnelle und detaillierte Umsetzung der Vorschriften über den Internetfilter erfordern. Ein Ausnahmefall, der eine möglichst weit in Einzelheiten gehende und unmittelbar geltende Regelung erforderlich macht, liegt damit vor.
1.3.6. Zwischenergebnis
Für die dem Pressebegriff unterliegenden Dienste47besteht die Kompetenz des Bundes zur Rahmengesetzgebung nach Art. 75 I 1 Nr. 2 GG, 75 II GG i.V.m. Art. 72 GG.
1.4. Zwischenergebnis
Damit steht dem Bund die Kompetenz zum Erlaß von Gesetzen nach Art. 73. Nr.7 GG ausschließlich für die rein individualkommunikativen Internetdienste sowie die technische Seite des Internetfilters zu.
Für neben den verkörperten Druckerzeugnissen zeitgleich und zusätzlich oder ergänzend im Internet veröffentlichten Presseerzeugnisse sowie für die Diens- te im WWW, für Homepages und Newsgroups, die unter den Pressebegriff zu fassen sind, hat der Bund die Rahmengesetzgebungskompetenz nach Art. 75 I 1 Nr. 2 GG, 75 II GG i.V.m. Art. 72 GG.
1.5. Kompetenzergänzungen
Fraglich ist weiterhin, ob für die Internetdienste, die explizit keiner der o.g. Kompetenznormen des Bundes unterfallen, wie z.B. dem lediglich dem Versenden von Dateien ohne jegliche Kommunikation dienenden File Trans- fer Protocol (ftp), eine Kompetenzergänzung des Bundes gegeben ist. Hier kommen insbesondere die „Kompetenz kraft Sachzusammenhangs“ und die sog. „Annexkompetenz“ in Betracht, wobei umstritten ist, ob es sich hier- bei um sich ausschließende Kompetenze n48oder aber bei der Annexkompe- tenz um einen Unterfall der Kompetenz kraft Sachzusammenhangs49handelt. Aufgrund neuerer Rechtsprechung des BVerfG50ergänzt ein enger Sachzu- sammenhang die zugewiesene Kompetenz nur dann, wenn die entsprechende Materie verständlicherweise nicht geregelt werden kann, ohne dass zugleich eine nicht ausdrücklich zugewiesene andere Materie mitgeregelt wird, wenn also das Übergreifen unerlässliche Voraussetzung für die Regelung der zuge- wiesenen Materie ist.
Aufgrund dieser Ausführungen, die insbesondere im Bezug auf die untrennbaren Zusammenhänge auch für die Annexkompetenz gemacht wurden51, läßt sich entnehmen, daß beide Figuren der Kompetenzergänzung als zumindest weithin identisch anzusehen sind.52
Zusätzlich wird in der Entscheidung des BVerfG53die Figur des „Schwer- punktes der Gesamtregelung“ erörtert. Danach ist eine Teilregelung, die bei isolierter Betrachtung einer Materie zuzurechnen wäre, die nicht in die Zu- ständigkeit des Bundesgesetzgebers fällt, gleichwohl der Kompetenz zuzu- rechnen, wenn sie mit dem kompetenzbegründenden Schwerpunkt der Ge- samtregelung derart eng verzahnt ist, daß sie als Teil dieser Gesamtregelung erscheint.
Diese drei angesprochenen Kompetenzergänzungen enthalten ähnliche z.T. übereinstimmende Ansätze, die sich in weiten Bereichen überschneiden.54Da her wird im Folgenden, bei der Prüfung einer möglichen Kompetenzergä n zung auf den Schwerpunkt der Gesamtregelung abgestellt.
Mit den unter 1.4. festgestellten Kompetenzen für die technische Seite des In- ternetfilters und für die inhaltlichen Fragen des größten Teils der im Internet angebotenen Dienste liegt der Schwerpunkt einer Regelung für den Internetfil- ter bereits in der Kompetenz des Bundes. Um eine wirksame Prävention vor den schweren Straftaten zu erreichen, is t es erforderlich, auch die z.Zt. beste- henden und nach der Prüfung der Bundeskompetenz dem Bund noch nicht zu- gewiesenen Teilbereiche, wie z.B. die ftp-Dienste, in einer Norm zu regeln, da häufig gerade auf diese anonymen Dienste ausgewichen wird, um die strafba- ren Text oder Bilddateien zum Abruf bereitzustellen bzw. zu versenden. Aber auch die rasante technische Entwicklung der einzelnen Internetdienste und die laufende Schaffung neuer Dienste zeigt, daß die gesamte Regelungsmaterie sehr stark verzahnt ist.
Daher ist, da bereits der größte Teil der einzelnen Internetbereiche im Hin- blick auf das Internetfiltergesetz in die Regelungszuständigkeit des Bundes aufgrund der Rahmenkompetenz nach Art. 75 I 1 Nr. 2 GG, 75 II GG i.V.m. Art. 72 GG fällt, dieser große Teil als Schwerpunkt der Gesamtregelung anzu- sehen, so daß die anderen nicht mit erfaßten Dienste des Internets bei verstän- diger Würdigung als Teil dieser Gesamtregelung erscheinen müssen. Dies gilt auch für den gefahrenabwehrrechtlichen Aspekt der Regelung, da Normen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen, e- weils dem Sachgebiet zuzuordnen sind, zu dem sie in einem notwendigen Zu- sammenhang stehen.55
Abschließend ist noch fraglich, ob ggf. wie die für die einzelnen Dienste gegebenen Kompetenzen zusammengefaßt werden können.
Nach der h.M. ist es möglich, daß der Bund seine Gesetzgebungskompetenzen aus verschiedenen Bereichen auch kombiniert.56Eine solche Mehrfachzustän- digkeit oder auch „Mosaikkompetenz“ ist verfassungsrechtlich unproblema- tisch, soweit sie im Zuständigkeitsbereich ein und desselben Kompetenzträ- gers verbleibt.57
2. Ergebnis
Damit besitzt der Bund für den Erlaß des Internetfiltergesetzes die Kompetenz aus Art. 73. Nr.7 GG und Art. 75 I 1 Nr. 2 GG, 75 II GG i.V.m. Art. 72 GG.
3. Verwaltungskompetenz des Bundes
Fraglich ist, ob der Bund die für die Ausführung des Internetfiltergesetes angedachte Behörde einrichten darf.
Den Ländern steht, unabhängig von der jeweiligen Gesetzgebungskompetenz für einen bestimmten Bereich58, die Verwaltungskompetenz nach Art. 30, 83 GG zu, sofern sich aus dem GG nichts anderes ergibt.
Dem Bund könnte die Verwaltungskompetenz aus Art. 87 III 1 GG zustehen, der die Möglichkeit vorsieht, für Angelegenheiten, für die der Bund die Ge- setzgebungskompetenz hat, Bundesoberbehörden bzw. bundesunmittelbare öffentlich-rechtliche Körperschaften oder Anstalten einzurichten, wobei der Umfang bis zur Entscheidung des BVerfG zum Kreditwesengesetz umstritten war.59
Nach dem Sachverhalt soll eine Behörde eingericht et werden, die lediglich die Aufgabe hat, die Quellen für die schwer strafbaren Inhalte aus dem Internet herauszusuchen und entsprechend den Filter zu aktualisieren. Ein weiterer Unterbau wird nicht benötigt. Es handelt sich also um eine selbständige Bundesoberbehörde, die für das gesamte Bundesgebiet zuständig ist und durch Einspruchsgesetz errichtet werden kann.60
Der Bund hat also aus Art. 87 III 1 GG auch die Kompetenz, die Behörde ein- zurichten.
Frage 2
Damit das Internetfiltergesetz materiell verfassungsgemäß ist, darf es weder gegen die Grundrechte der Nutzer, noch gegen die Grundrechte der Provider verstoßen.
1. Rechte der Inhaltsanbieter
Die Nutzer des Internets sind sowohl die Anbieter von bestimmten Diensten, als auch die Konsumenten. In Diskussions foren z.B. können die Rollen häufig und in kurzer zeitlicher Abfolge wechseln.61Daher erscheint es angezeigt bei den Rechten der Konsumenten auch mögliche Grundrechte der Anbieter der in Rede stehenden strafrechtlichen Inhalten zu prüfen.
1.1. Grundrechte aus Art. 5 I GG
1.1.1. Schutzbereich Meinungsäußerungsfreiheit, Art. 5 I 1 1. Alt. GG
Die Anbieter der von dem Internetfiltergesetz betroffenen strafbaren Inhalte könnten durch die Regelung in ihrem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung aus Art. 5 I 1 1. Alt. GG verletzt sein.
Die Meinungsäußerungsfreiheit schützt die Äußerung und Verbreitung einer Meinung in Wort, Schrift und Bild. Meinung ist jedes Werturteil unabhängig von seinem thematischen Gehalt und seiner politischen Zweckrichtung.62Meinungen sind gekennzeichnet durch das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens63, wobei unerheblich ist, ob sie wahr oder unwahr sind, bzw. ohne daß es darauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos, emo- tional oder rational ist, als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos ein- geschätzt wird.64Umfaßt sind nach der überwiegenden Meinung auch Tatsa- chenbehauptungen, mit Ausnahme von erwiesenen oder bewußt unwahren Tatsachenbehauptungen.65
Im Zusammenhang mit einem Teil der für den Internetfilter relevanten Strafta- ten, insbesondere bei der Volksverhetzung und Aufforderung zum Rassenhaß, der Kriegsverherrlichung sowie nazistischer und neonazistischer Propaganda werden unzweifelhaft Meinungen geäußert und auch Tatsachenbehauptungen aufgestellt, die damit vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit erfaßt sind.
Häufig wird aber gerade in diesem Zusammenhang auch die sog. „Auschwitz- lüge“, also das öffentliche Äußern von Zweifeln am Wahrheitsgehalt von Be- hauptungen über deutsche Greueltaten gegen Juden geäußert. Hierbei handelt es sich jedoch um eine erwiesen unwahre Tatsachenbehaup- tung. Sie fällt daher nicht unter den Schutzbereich des Art. 5 I 1 1. Alt. GG.66Als Verhalten ist das Äußern und das Verbreiten der Meinungen geschützt, wobei die drei angeführten Medien Wort, Schrift und Bild nicht abschließend sind.67Daher wird angenommen, daß auch die Verbreitung über die „neuen Medien“ vom Schutzbereich erfaßt wird.68
Hier erfolgt die Verbreitung der Meinungen über das Internet, daß sich vorwiegend der Schrift und des Bildes bedient, aber auch in Form von Tondokumenten erfolgen kann.
Durch das beabsichtigte Gesetz wird der Schutzbereich der Meinungsäußerungsfreiheit berührt.
1.1.2. Schutzbereich Pressefreiheit, Art. 5 I 2 1. Var. GG
Wie bereits oben zu Frage 1 unter 1.3. ausgeführt sind bestimmte Dienste im Internet unter den formellen Pressebegriff, der dem materiellen Pressebegriff des Art. 5 I 2 1. Var. GG entspricht, zu subsumieren, so daß das Gesetz auch gegen die Pressefreiheit der Inhaltsanbieter im Bereich dieser Dienste versto- ßen könnte.
Durch die Pressefreiheit sind neben der Beschaffung der Information auch die Verbreitung von Nachrichten und Meinungen geschützt.69Der Schutzbereich ist also betroffen.
1.1.3. Schutzbereich Rundfunkfreiheit, Art. 5 I 2 2. Var. GG
Die Rundfunkfreiheit dient der Gewährleistung freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung.70Aus diesem Grund ist auch jede Vermittlung von Information und Meinung geschützt.71
Unter 1.1.3.3. zu Frage1 wurde bereits festgestellt, daß der Rundfunkbegriff seinem Inhalt nach nur auf das Angebot des Internetradios anwendbar ist. Da aber auch über diesen Dienst theoretisch die relevanten strafbaren Inhalte vermittelt werden können, ist für diesen Teilbereich auch der Schutzbereich der Rundfunkfreiheit berührt.
1.1.4. Eingriff in die Schutzbereiche
Ferner müßte ein Eingriff in den Schutzbereich vorliegen.
Einen Eingriff in die Schutzbereiche stellt jedes Verbot, eine bestimmte Mei- nung zu äußern dar; aber auch jede Be- und Verhinderung einer Meinungsäu- ßerung und Verbreitung sowie jede Beeinträchtigungen der technischen, orga- nisatorischen, Voraussetzungen und der Betrieb von Presse und Rundfunk.72Durch den Internetfilter soll verhindert werden, daß bestimmte schwer strafba- ren Inhalte über die einzelnen Dienste des Internets im Bereich der Bundesre- publik verbreitet werden können.
Ein Eingriff in die Grundrechte liegt in dem beabsichtigten Gesetz vor.
1.1.5. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
Die festgestellten Eingriffe stellen nur dann keine Verletzung der Meinungsäußerungs-, der Presse und der Rundfunkfreiheit dar, wenn sie verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind.
1.1.5.1. Schranke der allgemeinen Gesetze
Die Freiheiten aus Art. 5 I GG sind nicht vorbehaltlos gewährleistet. Sie fin- den ihre Schranken nach Art. 5 II GG in den Vorschriften der allgemeine n Ge- setze.
Allgemein ist ein Gesetz nicht bereits dann, wenn es lediglich abstraktgenerell formuliert ist, da dieser Zusatz ansonsten neben dem Verbot des Einzelfallgesetzes aus Art. 19 I GG überflüssig wäre.73
Nach der „Sonderrechtslehre“ liegt ein allgemeines Gesetz vor, wenn es sich nicht gegen eine bestimmte Meinung als solche richtet.74
Nach der „Abwägungslehre“ handelt es ich um ein allgemeines Gesetz, wenn eine Rechtsgüterabwägung zwischen der Meinungsfreiheit und dem im Gesetz geschützten Rechtsgut ergibt, daß letzteres überwiegt.75
In der mittlerweile ständigen Rechtsprechung des BVerfG seit der „Lüth- Entscheidung“76werden diese beiden Auffassungen heute in der Weise kom- biniert, daß ein allgemeines Gesetz dann vorliegt, wenn es sich nicht gegen die Äußerung einer Meinung als solche richtet, sondern vielmehr dem Schutz ei- nes schlechthin, ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung zu schützenden Rechtsguts dient, das gege nüber der Betätigung der Meinungsfreiheit Vorrang hat.
Mit dem geplanten Internetfiltergesetz sollen u.a. Straftaten nach §§ 86, 86 a und § 130 StGB verhindert werden. Diese Straftaten richten sich gegen den demokratischen Rechtsstaat bzw. gegen die öffentliche Ordnung. Insbesondere § 130 schützt darüber hinaus auch die Menschenwürde.
Insofern wird mit dem Gesetz nicht an eine bestimmte Meinung als solche angeknüpft, sondern es sollen andere grundlegende Verfassungsentscheidungen und Grundrechte geschützt werden. Diesen Verfassungsnormen ist gegenüber den Grundrechten der Meinungsäußerungs-, der Presse- und der Rundfunkfreiheit der Vorrang einzuräumen.
Das Internetfiltergesetz stellt daher ein allgemeines Gesetz iSv. Art. 5 II GG und somit eine Schranke für die Grundrechte dar.
1.1.5.2. Schranken aus dem Jugendschutz
Neben den allgemeinen Gesetzen können nach Art. 5 II GG auch speziell Bestimmungen zum Schutz der Jugend das Rechte aus Art. 5 I GG beschränken. Hierunter fallen Bestimmungen zur Abwehr von der Jugend drohender Gefahren, wie sie von Inhalten ausgehen können, die Gewalttätigkeiten und Krieg verherrlichen, Haß auf andere Menschen provozieren oder sexuelle Vorgänge in grob schamverletze nder Weise darstellen.77
Wie bereits ausgeführt, sind genau diese Inhalte beispielhaft als Motiv für den Erlaß des Internetfiltergesetzes aufgeführt; mithin stellt das Gesetz auch eine Bestimmung zum Schutz der Jugend dar.
1.1.5.3. Schranken-Schranken
Die Regelungen des beabsichtigten Internetfiltergesetzes können ihrerseits a- ber auch nicht uneingeschränkt in die Rechte des Art. 5 I GG eingreifen. In diesem Zusammenhang ergeben sich Beschränkungen insbesondere aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und für das Recht auf freie Meinungsäuße- rung aus der Wechselwirkungstheorie, der die gleiche Wirkung zukommt wie im Hinblick auf die übrigen Grundrecht der Grundsatz der ve rfassungskon- formen Auslegung.78
1.1.5.3.1. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Das Gesetz müßte auch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen.
Im Rahmen des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ist zunächst zu prüfen, ob das Gesetz geeignet ist, den angestrebten Zweck, nämlich die Verhinde- rung schwerer Straftaten durch die Verbreitung von Internetinhalten, zu errei- chen, wobei bereits eine Förderung des gewünschten Erfolges als ausreichend angesehen wird.79
Mit dem geplanten Gesetz sollen die gewerblichen Zugangsanbieter, die soge- nannten Access-Provider, aber auch alle anderen Zugang zum Internet vermit- telnden Institutionen verpflichtet werden, den Internetfilter vorzuschalten, damit die genannten und vergleichbare strafbare Inhalte nicht mehr in der Bundesrepublik angeboten und damit zum Nutzer gelangen können. Die allermeisten der Nutzer erlangen ihren Zugang zum Internet und damit zu den in Rede stehenden Inhalten über die genannten Access-Provider. Gleiches gilt auch für die Anbieter der Inhalte, die sich zum „upload“ der Inhalte ins Internet der Access-Provider bedienen müssen. Lediglich ein geringer Teil der Nutzer verschafft sich auf anderen Wegen Zugang zum Internet, z.B. über aus- ländische Provider, die nicht der Verpflichtung unterliegen würden, den Filter zu schalten. Letztere Gruppe dürfte aber im Hinblick auf den für die erforder- liche Verbindung benötigten telefonischen Zugang und der damit verbundenen hohen Kosten sehr gering sein.80
Aus diesem Grund ist das geplante Gesetz geeignet, den gewünschten Erfolg in einem sehr großen Maße zumindest zu fördern.
Weiterhin muß das Gesetz zur Abwehr der Gefahren erforderlich sein. Der Gesetzgeber muß von mehreren gleich geeigneten Mitteln dasjenige wählen, welches zugleich den geringstmöglichen Eingriff darstellt.81Mit dem Internetfiltergesetz soll verhindert werden, daß strafbare Internetin- halte, die z.T. auf ausländischen Servern „lagern“, in Deutschland angeboten und hier verbreitet werden können. Um einen möglichst weitreichenden prä- ventiven Einsatz eines Filters zu ermöglichen, ist es sinnvoll, den Filter an ei- ner Stelle zu plazieren, die zum einen schwer zu umgehen und zum anderen kontrollierbar ist. Aus diesem Grund scheidet z.B. eine möglicherweise denk- bare Verpflichtung, jeden einzelnen PC mit Internetzugang mit einem entspre- chenden Filter zu versehen aus, da so eine Kontrolle der Einhaltung nahezu unmöglich und damit Umgehung der Regelung und ein „upload“ der fragli- chen Inhalte durch den Einzelnen möglich wäre.
Auch ein anderes gleich geeignetes Mittel, das den beabsichtigten Zweck er- reichen kann, ist nicht ersichtlich; die Regelung ist mithin auch erforderlich. Schließlich muß das Gesetz auch angemessen, d.h. verhältnismäßig im engeren Sinne sein. Der Eingriff bzw. die Beeinträchtigung, die der Eingriff für den einzelnen Anbieter bedeutet, und der mit dem Eingriff verfolgte Zweck müssen in einem gewichteten und wohl abgewogenem Verhältnis zu-einander stehen.82Der mit dem Gesetz verfolgte Zweck, nämlich auf der Seite der Anbieter die Bereitstellung der betreffenden Inhalte, darf also nicht er-kennbar im Mißverhältnis zu der Beeinträchtigung durch den Eingriff stehen. Es ist also zwischen der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und den durch die betreffenden Strafrechtsnormen geschützten Rechtsgüter auf der anderen Seite abzuwägen.
Die Meinungsfreiheit ist für die demokratische Ordnung des Grundgesetzes schlechthin konstituierend.83Dies muß auch für die Verbreitung von me i- nungsrelevanten Inhalten über Presse und Rundfunk ge lten. Den Grundrechten kommt also innerhalb der Verfassung eine zentrale Bedeutung zu. Auf der anderen Seite ist der Staat aus Art. 1 I GG verpflichtet, die Men- schenwürde zu achten und zu schützen. Ein Ausfluß der Menschenwürde ist auch der Schutz der ungestörten Entwicklung Minderjähriger84, die durch den Konsum der strafbaren Internetinhalte, aber auch z.B. als Opfer im Bereich der von Anbietern verbreiteten Kinderpornografie nachhaltig gefährdet ist. In diesem Bereich des Jugendschutzes ist die Menschenwürde eindeutig höher einzustufen als die Rechte aus Art. 5 I GG.
Daneben ist durch das Anbieten und Verbreiten von verfassungsfeindlichen Inhalten, z.B. durch Volksverhetzung, rassistische Äußerungen, Kriegsver- herrlichung oder der Anleitung zu Straftaten, auch das Interesse des Staates dahingehend berührt, als ihm die Befugnis zustehen muß, seine freiheitlich demokratische Grundordnung, die ja gerade auch das Recht auf freie Mei- nungsäußerung sichert, vor diesen Angriffen zu schützen.85Insoweit muß auch hier das Recht auf freie Meinungsäußerung zurückstehen.
Die Einschränkung, die die Anbieter der auszufilternden Inhalte durch diese Regelung hinzunehmen haben, beschränken sich auf das Verbot des Anbietens und Verbreitens von strafbaren Inhalten. Auch dieser Aspekt spricht dafür, die Meinungsäußerungsfreihe it sowie die Presse- und Rundfunkfreiheit hinter die mit dem Filter zu schützenden Rechtsgüter zurücktreten zu lassen. Das Gesetz ist daher im Hinblick auf die Anbieter der Inhalte auch angemes- sen und entspricht somit insgesamt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
1.1.5.3.2. Wechselwirkungslehre
Zusätzlich zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist die vom BVerfG in der „Lüth-Entscheidung“86aufgestellte Wechselwirkungslehre zu berücksichtigen, wonach das beschränkende Gesetz seinerseits in seiner das Grundrecht be- schränkenden Wirkung wieder eingeschränkt werden muß, d.h. bei der Ausle- gung des Gesetzes muß der Wertegehalt des Grundrechtes unangetastet ble i- ben.
Wie bereits oben unter 1.1.3.3.1. dargelegt, bezieht sich der Filter und die da- mit verbundene Einschränkung der Meinungsfreiheit nur auf solche Inhalte, die in schwerer Weise gegen Strafrechtsnormen verstoßen würden. Damit können andere, auch kritische oder mit der Rechtsordnung nicht zwingend im Einklang stehende Meinungen weiter geäußert und verbreitet werden. Damit bleibt die freie Meinungsäußerung und Verbreitung im wesentlichen weiterhin möglich.
1.1.5.3.3. Zensurverbot, Art. 5 I 3 GG
Als eine weitere Schranken-Schranke für die Grundrechte aus Art. 5 I GG, nicht als selbständiges Grundrecht87, ist nach absolut h.M. das Zens urverbot aus Art. 5 I 3 GG anzusehen.
Umstritten ist, ob von dem Verbot nur die sogenannte Vor-88oder aber auch die Nachzensur89erfaßt ist. Dieser Streit kann jedoch dahin stehen, wenn sich das beabsichtigte Gesetz jedenfalls als Maßnahme der Vorzensur darstellt. In verschiedenen Verfahren hat das BVerfG, daß in Art. 5 I 3 lediglich ein Verbot der Vor- und Präventivzensur sieht, ausgeführt, daß hierunter einschränkende Maßnahmen vor der Herstellung oder Verbreitung eines Geisteswerkes, insbesondere das Abhä ngigmachen von behördlicher Vorprüfung und Genehmigung seines Inhalts zu verstehen sind.90
Teilweise wird die Auffassung vertreten, daß unter Berücksichtigung der Ra- tio des Zensurverbotes im Bereich der Grundfreiheiten aus Art. 5 GG ein ge- nerelles Verbot besteht, präventiv tätig zu werden. Danach ist nicht nur die systematische Gefahrerforschung, sondern die Gefahrenabwehr im Kommuni- kationsbereich generell bedenklich.91Begründet wird dies damit, daß zwar ge- rade in dem bei dem Gesetz in Frage stehenden strafrechtlichen Bereich ein gesellschaftlicher Konsens die Verwerflichkeit betreffend besteht, aber sich der jeweils „Sich-Äußernde“ dem Risiko einer nachträglichen strafrechtlichen Verfolgung aussetzt und daher das Zensurverbot eine Gefahrenabwehr nicht zuläßt.92
Diese Ansicht ist zumindest solange nachvollziehbar, wie zumindest die tat- sächliche Möglichkeit besteht, gegen die Personen vorzugehen, die entspre- chende strafbare Inhalte verbreiten. Im Bereich des Internets liegt das Problem aber gerade darin, daß der Zugriff der deutschen Strafverfolgungsbehörden von den allermeisten Inhaltsanbietern inzwischen durch die Nutzung ausländ i- scher Server zu Verbreitung ihrer Inhalte unmöglich gemacht wird. Hinzu kommt auch die Anonymität, mit der diese Inhalte im weltweiten Internet ver- breitet werden können.
Aus diesen Gründen ist im Hinblick auf das Internetfiltergesetz eine andere Meinung vorzugswürdig, wonach nicht die Gefahrenabwehr als solches ausgeschlossen, sondern nur ein generelles Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unter den Begriff der Vorzensur zu fassen ist.93
Bei der geplanten Vorgehensweise ist nicht die Möglichkeit der Äußerung an sich betroffen, wohl aber der ebenfalls vor einer Zensur geschützte Bereich einer möglichen Verbreitung in Deutschland über das Medium Internet. Vor einer Verbreitung ist aber nicht eine Genehmigung einzuholen, die eine grundsätzlich verbotene Verbreitung erlaubt. Vielmehr stellt sich das Vorge- hen so dar, daß bei einer Entdeckung solcher Inhalte die entsprechenden Que l- len im Internet präve ntiv an den Filter „gemeldet“ wird und somit der Zugang zu dieser Quelle über das Internet von Deutschland aus dann nicht mehr mö g- lich ist. Damit ist die Maßnahme eine weniger intensive Form der Gefahren- abwehr und somit nicht als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu qualifizieren.
Fraglich ist daher, ob das Vorgehen als Nachzensur anzusehen ist. Die Nach- zensur umfaßt u.a. nachträgliche Kontrollmaßnahmen94, die nach Beginn der Verbreitung mit dem Ziel ansetzen, eine weitere Betätigung zu be- oder ver- hindern.95
Die Tatsache, daß die Kontrollmöglichkeit der Inhalte durch die Behörde vor- aussetzt, daß die fraglichen Inhalte zunächst veröffentlicht werden müssen, damit die Behörde Kenntnis erlangen und reagieren kann, setzt zunächst die Verbreitung voraus. Das Verfahren könnte sich daher begrifflich als Nachze n- sur darstellen.
Nach einer Mindermeinung ist durch das Zensurverbot des Art. 5 I 3 GG auch die Nachzensur verboten, um die Kommunikationsgrundrechte wirksam zu schützen.96
Nach dem Beginn der Verbreitung der betreffenden Inhalte über das Internet müssen sich die Inhalte an den für die Freiheiten aus Art. 5 I 1, 2 an den für sie geltenden Schranken messen lassen. Sofern man der Auffassung der Min- dermeinung folgen würde, würden die Schranken des Art. 5 GG leerlaufen. Insofern ist mit der h.M. davon auszugehen, daß von dem Zensurverbot nur die Vorzensur erfaßt wird.
Das Gesetz verstößt daher nicht gegen das Zensurverbot des Art. 5 I 3 GG.
1.1.6. Zwischenergebnis
Das Gesetz verstößt nicht gegen die Meinungsäußerungs-, die Presse- und Rundfunkfreiheit der Inhaltsanbieter aus Art. 5 I 1 1. Alt. GG.
1.2. Kunstfreiheit, Art. 5 III 1 1. Alt. GG
Es ist zunächst zu prüfen, ob das Grundrecht die Kunstfreiheit aus Art. 5 III 1
1. Alt. GG betroffen ist. Dies ist dann der Fall, wenn in den Schutzbereich des Grundrechts eingegriffen wurde.
1.2.1. Schutzbereich
Fraglich ist zunächst, was alles unter den Kunstbegriff im Sinne dieser Vorschrift zu fassen ist. Die Bestimmung der Kunst kann über den materialen97, den formalen98oder den sog. offenen Kunstbegriff99erfolgen, wobei einzelnen Begriffe vom BVerfG nebeneinander genutzt werden.
Kunst liegt aber auf jeden Fall vor, wenn der formale Kunstbegriff erfüllt ist, der an die Zuordnung eines Werkes zu einem bestimmten Werktyp anknüpft. Durch das Gesetz soll auch die Verbreitung von Pornographie, soweit sie ge- gen § 184 StGB verstößt, unterbunden werden. Z.Zt. erfolgt die Verbreitung im Internet zum größten Teil über das Medium der Fotografie. Fotos als Werktyp sind insbesondere in der heutigen Zeit als künstlerischer Werktyp anerkannt. Dem steht auch nicht entgegen, daß es sich um Pornographie ha n- delt, da diese nach der Rechtsprechung des BVerfG nicht vom Schutzbereich der Kunstfreiheit ausgeschlossen sein soll.100
Der formale Kunstbegriff ist insoweit erfüllt und der Schutzbereich der Kuns t- freiheit ist betroffen.
1.2.2. Eingriff
Das Gesetz müßte ferner einen Eingriff in die Kunstfreiheit nach Art. 5 III 1 1. Alt. GG darstellen.
Ein Eingriff in die Kunstfreiheit ist u.a. dann gegeben, wenn durch staatliche Maßnahmen der Wirkbereich, also die Vermittlung des Werkes an Dritte, beeinträchtigt wird.101
Durch das Internetfiltergesetz ist es dem Anbieter von Kunst in Form von pornographischen Darstellungen nicht mehr möglich, diese über das Internet an Konsumenten in Deutschland zu verbreiten, wenn die betreffenden Inhalte ausgefiltert werden. Ein Eingriff liegt mithin vor.
1.2.3. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
Die Kunstfreiheit unterliegt keinem Gesetzesvorbehalt.102Auch finden die Schranken des Art. 5 II GG oder des Art. 2 I GG keine Anwendung auf die Kunstfreiheit.103Eine Einschränkung kann sich aber aus anderen verfassungsmäßig geschützten Werten ergeben, was eine Abwägung der kollidierenden Güter notwendig macht.104
Die Vorschriften des § 184 StGB dienen unmittelbar oder mittelbar dem Ju- gendschutz105, dem u.a. aus Art. 2 I GG i.V.m. Art 1 I GG ein verfassungs- rechtlicher Schutz zukommt.106Diese beiden Rechte müssen im Wege der praktischen Konkordanz zum Ausgleich gebracht werden, wobei vorrangig der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen ist.107Hinsichtlich der Geeignetheit und Erforderlichkeit des Internetfiltergesetzes kann auch beim Jugendschutz auf die unter 1.1.5.3.1 gemachten Ausführun- gen verwiesen werden.
Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung ist der Eingriff in die Kunstfreiheit gegen den verfolgten Zweck, hier dem Jugendschutz, abzuwägen. Durch den Filter wird in Deutschland die Verbreitung der Kunstform „Porno- graphie“ über das Internet verhindert. Durch diese Form der Verbreitung ist ohne eine entsprechende Ausfilterung jedem jugendlichen Internetkonsumen- ten ein Zugang zu den verschiedensten pornographischen Darstellungen sehr leicht möglich. Gerade auch die sog. „harte Pornographie“ iSv. § 184 III StGB wird wegen der erschwerten Ahndungsmöglichkeiten über das Internet ver breitet. Insbesondere auch diese Darstellungen sind geeignet, Kinder und Jugendliche sittlich schwer zu gefährden.108
Durch das Internetfiltergesetz soll präventiv nur die strafbare Verbreitung pornographischer Inhalte über das Internet verhindert werden. Es bestehen a- ber auch noch andere Möglichkeiten die als Kunst einzustufende Pornographie im Rahmen des rechtlich Zulässigen zu verbreiten. Der Wirkbereich des Künstlers, der ohnehin geringer als der Werkbereich geschützt ist109, wird daher nur geringfügig beeinträchtigt.
Aufgrund der Tatsache, daß der Staat wegen des verfassungsrechtlichen Ra n- ges des Jugendschutzes gefordert ist, diesen zu gewährleisten, ist aus den dar- gestellten Gründen die Einschränkung der Verbreitung der pornographischen Inhalte über das Internet angemessen und insgesamt verhältnismäßig.
1.2.4. Zwischenergebnis
Das Internetfiltergesetz verstößt nicht gegen die Kunstfreiheit.
1.3. Fernmeldegeheimnis, Art. 10 I 3. Alt. GG
Im Hinblick auf die individualkommunikativen Internetdienste, wie z.B. E- mail, ist das geplante Gesetz auch an Art. 10 I 3. Alt GG zu messen. Das Fernmeldegeheimnis ist grundsätzlich als Abwehrrecht gegen Eingriffe staat- licher Stellen konzipiert, so daß die Anwendbarkeit zumindest bei der Ausfil- terung der betreffenden Inhalte durch privatrechtliche organisierte Zugangs- anbieter in Frage stehen könnte.110Der Grundrechtsschutz kann mit Blick auf die Privatisierung des Telekommunikationssektors aber nur wirksam sein, wenn diese Unternehmen benfalls mit einbezogen werden, jedenfalls inso- weit, wie der Eingriff, wie im Fall des Internetfiltergesetzes, auf staatliche Veranlassung hin durchgeführt wird.111
1.3.1. Schutzbereich
Der Schutzbereich des Fermeldegeheimnisses erstreckt sich auf jede durch drahtlose oder drahtgebundene Medien mittels elektromagnetische Wellen ü- bertragenen individualkommunikativen Inhalte und Daten, auch im Bereich neuer Medien, insbesondere im Bereich des Internets.112So sind auch Emails als individualkommunikativer Dienst dem Schutzbereich des Art. 10 I 3. Alt. GG zuzuordnen.113 Durch das geplante Gesetz sind genau diese zumindest auch betroffen. Dem steht nicht entgegen, daß über das Internet auch Massenkommunikation betrieben wird.114Der Schutzbereich ist also berührt.
1.3.2. Eingriff
Weiterhin müßte durch das Gesetz ein Eingriff in den Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses vorliegen.
Ein Eingriff in den Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses ist u.a. in jeder Kenntnisnahme der Information zu sehen.115Hingegen soll kein Eingriff vor- liegen, wenn eine bloße Verhinderung der Kommunikation gegeben ist.116Nach den vorliegenden Überlegungen zum Gesetz soll eine Behörde einge- richtet werden, die das Internet auf strafbare Medieninhalte, also auch Inhalte individueller Kommunikation wie Email, untersucht und die Ergebnisse zur Programmierung des Filters benutzt. Nach der Programmierung des Filters z.B. mit bestimmten „Schlüsselwörtern“, auf die hin die Individualkommuni- kation durchsucht wird, ist nicht notwendigerweise die Kenntnisnahme von den Inhalten durch eine Person erforderlich. Vielmehr liegt in diesem Moment nur eine Verhinderung der Kommunikation vor.
Trotzdem ist eine wenn auch nur stichprobenartige Kontrolle einzelner individueller Kommunikationen weiterhin erforderlich, um den Filter laufend mit neuen Schlüsselbegriffen zu aktua lisieren.
Insofern wird durch diesen Akt freiheitsverkürzend in die Individualkommunikation des Bürgers final und unmittelbar eingegriffen, weshalb ein Eingriff nach dem klassischen Eingriffsbegriff117vorliegt.
1.3.3. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
Der festgestellte Eingriff stellt nur dann keine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses dar, wenn er verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.
1.3.3.1. Schranke des einfachen Gesetzesvorbehalts
Eine Beschränkung des Fernmeldegeheimnisses darf nach Art. 10 II 1 GG nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen.
Hier soll die Beschränkung durch ein formelles Gesetz erfolgen, weshalb der Gesetzesvorbehalt eingehalten wird.
1.3.3.2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung ist aber auch zu prüfen, ob das geplante Gesetz als Schranke dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügt.118Das Gesetz müßte daher zunächst geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erfüllen.
Wenn die Individualkommunikation ebenso, wie die Massenkommunikation über den Internetfilter laufen muß, ist dies Maßnahme geeignet, präventiv die betreffenden Inhalte herauszufiltern.
Weiterhin müßte die Vorschrift erforderlich sein, d.h. es darf kein gleich ge- eignetes, weniger eingreifendes Mittel zur Erreichung des Zwecks vorha nden sein.
Ebenso, wie bereits unter 1.1.5.3.1. dargelegt, ist auch für die Individualkommunikation kein entsprechend weniger einschneidendes Mittel vorhanden. Das Gesetz ist demnach erforderlich.
Abschließend muß das Gesetz angemessen sein. Der Eingriff bzw. die Beeinträchtigung, die der Eingriff für den einzelnen Anbieter bedeutet, und der mit dem Eingriff verfolgte Zweck müssen in einem gewichteten und wohl abgewogenem Verhältnis zueinander stehen.119
Die besondere Gefahr, die von einer Verbreitung der betreffenden Inhalte über das Internet ausgeht liegt darin, daß die Inhalte bei einer Vielzahl der Dienste einem unbegrenzten Personenkreis zugänglich sind und somit die gefährdende Wirkung von Ihnen ausgehen kann. Demgegenüber steht die Verbreitung über die individualkommunikativen Dienste. Ein Unterschied besteht insoweit, als daß gerade hier die allgemeine Verbreitung und die davon ausgehende Ge- fährdung nicht in dieser Form besteht. Es besteht, abgesehen von der schnelle- ren Beförderungsmöglichkeit einer Email gegenüber einem „normalen“ Brief, kein Unterschied, ob z.B. rassistische Hetzschriften oder verbotene pornogra- phische Darstellungen per Email oder herkömmlicher Post an den Empfänger sendet. Im letzteren Fall würde man nicht ernsthaft auf den Gedanken kom- men, präventiv sämtliche Post zu öffnen. Hier würde bei begründeten Ver- dachtsfällen ggf. eine Kontrolle im Rahmen strafprozessualer Vorschriften in Betracht kommen. Vor diesem Hintergrund steht ein Eingriff in die durch Art. 10 I GG geschützte Individualkommunikation in Relation zu den Gefahren, die von dieser Verbreitungsform ausgehen, nicht angemessen.
Das Gesetz ist im Hinblick auf Art 10 I 3. Alt. GG nicht verhältnismäßig.
1.3.4. Zwischenergebnis
Das geplante Gesetz ist verstößt im Bereich einer Überwachung der Individualkommunikation gegen Art. 10 I 3. Alt. GG.
2. Recht der Nutzer als Konsumenten
2.1. Informationsfreiheit, Art. 5 I 1 2. HS GG
Aus Sic ht der Konsumenten von Internetinhalten ist in Bezug auf das geplan- te Gesetz insbesondere fraglich, ob es gegen die Informationsfreiheit aus Art.
5 I 1 2. HS GG verstößt.
2.1.1. Schutzbereich
Der Schutzbereich der Informationsfreiheit nach Art. 5 I 1 2.HS GG müßte berührt sein.
Im Rahmen der Informationsfreiheit ist die Informationsbeschaffung aus allgemein zugänglichen Quellen gewährleistet.
Eine Quelle für Informationen im Sinne dieser Vorschrift ist jeder denkbare Träger von Informationen, wobei unerheblich ist, ob die Information Meinun- gen bzw. Tatsachen oder öffentliche oder private Angelegenheiten betref- fen.120
Allgemein zugänglich ist die Quelle, wenn sie geeignet und bestimmt ist, der Allgemeinheit, also einem individuell nicht bestimmbaren Personenkreis, Informationen zu beschaffen.121
Die massenkommunikativen Dienste im Internet halten Informationen vor, sind also Träger von verschiedenen Informationen. Diese sind auch technisch geeignet und - aus Sicht des Urhebers122- dazu bestimmt, einem unbestimm- ten, nicht näher abgegrenzten Personenkreis Informationen zu bieten. Durch das Internetfiltergesetz ist der Schutzbereich des Art. 5 I 1 2. HS GG berührt.
2.1.2. Eingriff
Ferner müßte ein Eingriff in den Schutzbereich der Informationsfreiheit vor- liegen. Ein Eingriff in den Schutzbereich der Informationsfreiheit liegt bereits in jeder Behinderung des Zugangs zu einer Informationsquelle.123Die in Rede stehenden Inhalte können wegen des vorgeschalteten Filters nicht über in Deutschland vorgehaltene Zugänge zum Internet abgerufen werden. Insoweit wird durch das Internetfiltergesetz der Zugang zum Internet aus Deutschland nahezu unmöglich ge macht. Zieht man die Möglichkeit, sich ü- ber ausländische Zugangsanbieter die Informationen zu verschaffen in Be- tracht, so liegt jedenfalls zumindest eine Behinderung in der im Zugang zur Informationsquelle und damit ein Eingriff in den Schutzbereich der Informati- onsfreiheit nach Art. 5 I 1 2. Alt. GG vor.
2.1.3. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
Der festgestellte Eingriffe stellen nur dann keine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses dar, wenn sie verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind. Hinsichtlich der Schranken kann auf die Ausführungen zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung bei den Grundrechten der Nutzer aus Art. 5 I GG verwiesen werden, wobei jedoch das Zensurverbot des Art. 5 I 3 GG nicht auf die Informationsfreiheit angewendet werden kann, da dies nicht den Konsumenten eines Geisteswerkes schützen soll.124
2.1.4. Zwischenergebnis
Das Internetfiltergesetz verstößt nicht gegen die Informationsfreiheit der Konsumenten aus Art. 5 I 1 2. HS GG.
2.2. Fernmeldegeheimnis, Art. 10 I 3. Alt. GG
Träger dieses Grundrechts sind alle Teilnehmer an einer Post- oder Fernmel- dekommunikation.125Daher gelten die für die Inhaltsanbieter gemachten Aus- führungen für das Fermeldegeheimnis der Konsumenten entsprechend. Auch aus dieser Sicht liegt in dem Gesetz ein Verstoß gegen Art. 10 I 3. Alt. GG vor.
3. Rechte der Provider
Durch das Internetfiltergesetz können möglicherweise auch Grundrechte der Zugangsprovider betroffen sein.
3.1. eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb, Art. 14 I 1 GG
3.1.1. Schutzbereich
Das Internetfiltergesetz müßte den Schutzbereich des eingerichteten und aus- geübten Gewerbebetriebes nach Art. 14 I 1 GG berühren. Nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG ist als eigentumsfähige Rechtsposition auch das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb anerkannt.126Daher könnt en die gewerblichen Zugangsanbieter ggf. unter den Schutzbereich fa l- len.
Der Schutzbereich erstreckt sich aber auch hier, wie insgesamt in Art. 14 I 1 GG, nur auf den Bestand, nicht jedoch auf bloße Umsatz- und Gewinncha n- cen, Erwartungen oder Aussichten.127Die Vorschrift soll nur vor unmittelbar betriebsbezogenen Eingriffen schützen, die zielgerichtet den Betrieb zum Er- liegen bringen.128
Das Internetfiltergesetz zielt auf die Abwehr von Gefahren, die von möglichen schwer strafbaren Inhalten im Internet ausgehen können. Zielrichtung ist hingegen nicht, die Existenz der gewerblichen Access-Provider zu bedrohen. Damit ist durch das Gesetz nicht der Schutzbereich berührt.
3.1.2. Zwischenergebnis
Das geplante Gesetz berührt nicht den Schutzbereich des Art. 14 I 1 GG der gewerblichen Zugangsanbieter.
3.2. Berufsfreiheit, Art. 12 I 1 GG
3.2.1. Schutzbereich
Durch das Internetfiltergesetz müßte zunächst der Schutzbereich des Art. 12 I
1 GG berührt sein.
Vom Schutzbereich umfaßt werden die Berufswahl und die Berufsausübung. Unter Beruf st hier jede Tätigkeit zu verstehen, die auf eine gewisse Dauer angelegt ist und in ideeller wie in materieller Hinsicht der Schaffung und Er- haltung einer Lebensgrundlage dient.129Umstritten ist, ob nur erlaubte Tätig- keiten erfaßt sind130oder ob dies nicht für erforderlich gehalten wird.131Dieser Streit ist jedoch unerheblich, wenn die Tätigkeit der Zugangsanbieter grund- sätzlich erlaubt ist.
Die gewerblichen Zugangsanbieter verlangen für ihre Dienstleistung, einen Zugang zum Internet zu verschaffen, von den Konsumenten Entgelte nach un- terschiedlichen Modellen oder Staffelungen132. Hierbei handelt es sich um ei- ne auf eine gewisse Dauer angelegte, gewinnorientierte Tätigkeit, die auch er- laubt ist. Die Tätigkeit der Access-Provider fällt damit in den Schutzbereich der Berufsfreiheit.
3.2.2. Eingriff
Das Gesetz müßte einen Eingriff in den Schutzbereich darstellen.
Ein Eingriff in die Berufsfreiheit liegt u.a. dann vor, wenn durch verbindliche Regelungen mit Berufsbezug die Art und Weise der Ausführung der konkreten Tätigkeit erfaßt und bewirkt, daß diese nicht in der gewünschten Weise ausge- übt werden kann.133
Durch das Internetfiltergesetz, daß mit der Verpflichtung der Provider einen bestimmten Berufsbezug zu dieser Berufsgruppe aufweist, können die Zugangsanbieter nicht mehr in der von ihnen angestrebten umfassenden Breite den Zugang zu allen im Internet verfügbaren Informationen anbieten. Hier wird mithin in die Art der Berufsausübung eingegriffen.
3.2.3. verfassungsrechtliche Rechtfertigung
Der festgestellte Eingriff stellt keine Verletzung der Berufsfreiheit dar, wenn er verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.
3.2.3.1. Schranke des Gesetzesvorbehalts
Nach Art. 12 I 2 GG kann die Berufsausübung u.a. durch Gesetz geregelt werden. Hier soll die Berufsausübung durch das Internetfiltergesetz in der Weise geregelt werden, daß die Zugangsanbieter verpflichtet werden den Internetfilter gegen strafbare Inhalte vorzuschalten.
Hierbei handelt es sich um ein formelles Gesetz, daß Art. 12 I 2 GG genügt.
3.2.3.2. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Das Internetfiltergesetz als Schranke der Berufsfreiheit müßte weiterhin den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes genügen. Eine Konkretisierung hat dieser Grundsatz im Zusammenhang mit der Berufsfreiheit durch die Stufenlehre des BVerfG erfahren134, die sic h insbesondere auf die Prüfung der Angemessenheit des gesetzlichen Regelung auswirkt.
Der festgestellte Eingriff in die Berufsfreiheit muß zunächst geeignet sein, den Zweck der Regelung zu erreichen. Die Geeignetheit der Regelung wurde bereits festgestellt.
Ferner müßte der Eingriff in die Berufsfreiheit erforderlich sein, d.h. der Zweck er Gefahrenabwehr darf nicht durch ein gleich geeignetes und weniger belastendes Mittel erreicht werden. Dies ist im Bereich der Berufsfreiheit regelmäßig anzunehmen, wenn eine Zweckerreichung auch auf einer niedrigeren Stufe erreicht werden kann.135
Hier erfolgt der Eingriff mit einer Regelung der Berufsausübung, also auf der ersten Stufe der Drei-Stufen-Theorie. Es ist auch kein anderes geeignetes Mittel ersichtlich, mit dem der Zweck erreicht werden könnte und daß die gewerblichen Zugangsanbieter weniger belastet. Insbesondere scheidet aus den bereits dargelegten Gründen einer Verpflichtung der einzelnen Konsumenten, den Filter direkt am Zugangs-PC zu schalten, aus.
Der Eingriff in die Berufsfreiheit ist daher erforderlich.
Abschließend müßte der Eingriff in die Berufsfreiheit auch angemessen sein, er darf also nicht in einem Mißverhältnis zu dem angestrebten Zweck stehen. Aufgrund der Drei-Stufen-Theorie wird in diesem Zusammenhang insbesondere auf die betreffende Stufe und die jeweils dazu gehörenden Anforderungen an die Legitimation eines Eingriffs abgestellt.136
Eine Regelung, die in die Berufsausübung eingreift und nicht auf die Berufs- wahl zurückwirkt, ist zulässig, wenn sie durch vernünftige Gründe des Ge- meinwohls gerechtfertigt ist.137Der Grundrechtsschutz der Berufsfreiheit be- schränkt sich bei Regelungen der Ausübung auf die Abwehr in sich verfas- sungswidriger, weil etwa übermäßig belastender und nicht zumutbarer Aufla- gen.138
Durch die mittels des Internetfiltergesetzes begründete Verpflichtung der Ac- ces-Provider, den Internetfilter zu schalten, sollen im Wege der Prävention die exemplarisch genannten schweren Straftaten, deren Schutzrichtung auf den Schutz des demokratischen Rechtsstaates, der öffentlichen Ordnung und der sexuellen Selbstbestimmung bzw. dem Jugendschutz abzielt, verhindert wer- den. Diese Schutzgüter sind für das Gemeinwesen bzw. für die grundlegenden Verfassungsentscheidungen des Grundgesetzes von z.T. sehr ge wichtiger Be- deutung und somit als vernünftige Gründe des Gemeinwohls anzusehen, die durch die Regelung geschützt werden sollen.
Zieht man zusätzlich in Betracht, daß die betreffenden Inhalte nur einen kle i- nen Teil der gesamten im Internet verfügbaren Dienste und Informationen umfaßt, so führt die Verpflichtung zur Einrichtung des Filters auch nicht zu einer unzumutbaren Einschränkung der wirtschaftlichen Betätigungmöglichkeiten der gewerblichen Zugangsanbieter.
Das Gesetz ist daher angemessen und genügt insgesamt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
3.2.4. Zwischenergebnis
Das Internetfiltergesetz verstößt nicht gegen die in Art. 12 I 1 GG garantierte Berufsfreiheit der gewerblichen Zugangsanbieter.
4. Ergebnis
Das geplante Internetfiltergesetz verstößt bei der Überwachung der Individualkommunikation, wie z.B. im Bereich des Dienstes „Email“ gegen das Fernmeldegeheimnis aus Art. 10 I 3. Alt. GG. Insoweit ist das Internetfiltergesetz materiell verfassungswidrig. Syke, den 12.03.2001
[...]
1Stettner, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. 2, 1998, Art. 73 Rn. 29
2Degenhart, in: Sachs, GG-Kommentar, 1999, Art. 73 Rn. 32
3Lerche, in: Maunz/ Dürig, Art. 87 Rn. 105
4Stettner, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. 2, 1998, Art. 73 Rn. 31
5 Sannwald, in: Schmidt-Bleibtreu/ Klein, Art. 73 Rn. 100
6http://www.wissen.de; Suchbegriff „Internet“
7Heintzen, in: Das Bonner Grundgesetz - Kommentar, Art. 73 Rn. 72
8 Degenhart, in: Sachs, GG-Kommentar, 1999, Art. 73 Rn. 34
9Herzog, S. 141; Bullinger, JZ 1996, 385, 391
10Herzog, S. 141
11Herzog, S. 134 f.
12Herzog, S. 135 f.
13BVerfGE 12, 205, 225 ff.
14Heintzen, in: Das Bonner Grundgesetz - Kommentar, Art. 73 Rn. 75
15 BVerfGE 46, 120
16Bullinger, JZ 1996, 385, 391
17Degenhart, in: BK, Art. 5 Rn. 511
18Herzog, S. 146
19 Bullinger, AfP 1996, 1, 2
20Bullinger, AfP 1996, 1, 2
21Gounalakis/ Rhode, CR 1998, 487, 492
22Herzog, S. 161
23 BVerfGE 12, 205, 228 f.
24BVerfGE 68, 319, 330
25 Stettner, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. 2, 1998, Art. 74 Rn. 55
26Kunig, in: von Münch/ Kunig, GG-Kommentar, Band 3, Art. 75 Rn. 24
27Rozek, in: Das Bonner Grundgesetz - Kommentar, Art. 75 Rn. 41
28Kunig, in: von Münch/ Kunig, GG-Kommentar, Band 3, Art. 75 Rn. 24
29 Pieroth/ Schlinck, Rn. 567
30u.a. Degenhart, in: Sachs, GG-Kommentar, 1999, Art. 75 Rn. 25
31Kunig, Jura, 589, 589
32Gersdorf, S. 143 ff.
33Herzog, S. 163
34Stettner, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. 2, 1998, Art. 75 Rn. 23
35 Bullinger, JZ 1996, 385, 385
36Herzog, S. 164
37Herzog, S. 165
38Müller-Using/ Dammermann, ZUM 1995, 611, 612
39Schröder, S. 112 f.
40Rybak/ Hofmannn, NVwZ 1995, 230, 231
41 Kunig in v. Münch/Kunig, Art. 72 Rn. 20
42Pieroth, in: Jarass/ Pieroth, GG Art. 72 Rn. 9
43Jarass, NVwZ 2000, 1089, 1093
44 Hesse, Rn. 241
45Pieroth, in: Jarass/ Pieroth, GG Art. 75 Rn. 1
46Jarass, NVwZ 2000, 1089, 1095
47 sh. oben unter 1.3.3.
48Degenhart, in: Sachs, GG-Kommentar, 1999, Art. 70 Rn. 30 ff.
49Pieroth, in: Jarass/ Pieroth, GG Art. 70 Rn. 7
50BVerfGE 98, 265, 299
51Stein/ Frank, § 14 II Nr. 5
52Jarass, NVwZ 2000, 1089, 1090
53BVerfGE 98, 265, 299
54 Jarass, NVwZ 2000, 1089, 1090
55BVerfGE 8, 143, 150
56Stettner, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. 2, 1998, Art. 70 Rn. 32
57 Rozek, in: Das Bonner Grundgesetz - Kommentar, Art. 70 Rn. 54
58Stein/ Frank, § 15 II
59Rudolf, in: Erichsen, Allg. Verwaltungsrceht, § 51 Rn. 19
60 Stein/ Frank, § 15 II 3
61Bullinger Mestmäcker, S. 20 f.
62Siekmann/ Duttke, Rn. 424
63BVerfGE 7, 198, 210; 61, 1, 8
64BVerfGE 33, 1, 14 f.
65 BVerfGE 99, 185, 197
66BVerfGE 90, 241, 274
67Hesse, Rn. 329
68Degenhart, in: BK, Art. 5 Rn. 169 ff
69BVerfG NJW 1999, 2880
70BVerfGE 74, 297, 323
71 BVerfGE 60, 53, 63 f.
72Pieroth/ Schlinck, Rn. 581
73Pieroth/ Schlinck, Rn. 587
74 Häntzschel, in: HdBDStR II, 1932, S. 651, 659 f.
75Herzog, in: Maunz/ Dürig I, Art. 5 Rn. 275
76BVerfGE 7, 198, 209
77 BVerfGE 30, 336, 347
78Pieroth/ Schlinck, Rn. 595
79BVerfGE 67, 157, 173
80 Herzog, S. 197
81Stein/ Frank, § 30 V 2
82Pieroth/ Schlinck, Rn. 289
83BVerfGE 7, 198, 208
84 BVerfGE 75, 369, 380
85Herzog, S. 200
86 BVerfGE 7, 198, 208 f.
87so aber Stein/ Frank, § 38 V
88u.a. Hesse, Rn. 397
89Hoffmann-Riem, Hdb. VerfR, S. 221
90BVerfGE 33, 52, 71 ff.; 47, 198, 236; 73, 118, 166; 83, 130, 155
91Breitbach/ Rühl, NJW 1988, 8, 12
92 Breitbach/ Rühl, NJW 1988, 8, 15
93Götz, Rn. 332
94Pieroth/ Schlinck, Rn. 605
95Breitbach/ Rühl, NJW 1988, 8, 11
96 Hoffmann-Riem, Hdb. VerfR., S. 221
97BVerfGE 30, 173, 189
98Pieroth/ Schlinck, Rn. 611
99 BVerfGE 67, 213, 226 f.
100 BVerfGE 83, 130, 138 f.
101Jarass, in: Jarass/ Pieroth, GG, Art. 5 Rn. 86, 88
102Kannengießer, in: Schmidt-Bleibtreu/ Klein, GG, Art. 5 Rn. 17
103Pieroth/ Schlinck, Rn. 630
104 Jarass, in: Jarass/ Pieroth, GG, Art. 5 Rn. 91
105 Tröndle, in: Tröndle/ Fischer, § 184 Rn. 4
106 Jarass, in: Jarass/ Pieroth, GG, Art. 2 Rn. 34
107 BVerfGE 30, 173, 199
108BVerfG NJW, 1991, 1471
109Wendt, in: von Münch/ Kunig, Bd. 1, Art. 5 Rn. 98
110Grote, KritV 1999, 27, 39
111 Grote, KritV 1999, 27, 39
112Pieroth/ Schlinck, Rn. 773
113Sachs, Verfassungsrecht II - Grundrechte, B 10 Rn. 9
114Pieroth/ Schlinck, Rn. 773
115Hermes, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. 1, 1996, Art. 10 Rn. 47
116Jarass, in: Jarass/ Pieroth, GG Art. 10 Rn. 11
117 von Münch, in: von Münch/ Kunig, GG, Vorbem. Art 1 - 19 Rn. 51 a
118Hermes, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. 1, 199?, Art. 10 Rn. 58
119 Pieroth/ Schlinck, Rn. 289
120 Jarass, in: Jarass/ Pieroth, GG Art. 5 Rn. 15
121 BVerfGE 90, 27, 32
122Lerche, Jura 1995, 561, 565
123 Wendt, in: von Münch/ Kunig, Bd. 1, Art. 5 Rn. 27 124 BVerfGE 33, 52, 65 ff.
125Hermes, in: Dreier, GG-Kommentar, Bd. 1, 199?, Art. 10 Rn. 23
126Schmidt-Preuß, NJW 2000, 1524, 1524
127BVerfGE 68, 193, 222
128 BGHZ 111, 349, 355 ff.
129Jarass, in: Jarass/ Pieroth, GG, Art. 12 Rn. 4
130BVerfGE 81, 70, 85
131Jarass, in: Jarass/ Pieroth, GG, Art. 12 Rn. 7
132Mayer, NJW 1996, 1782, 1784
133 BVerfGE 82, 209, 223
134Breuer, in: HbStR, VI, 961 f.
135 Jarass, in: Jarass/ Pieroth, GG, Art. 12 Rn. 30
136Pieroth/ Schlinck, Rn. 855
137 BVerfG NJW 2000, 1326
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument zum Internetfiltergesetz?
Dieses Dokument ist ein Rechtsgutachten zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines fiktiven "Internetfiltergesetzes" (ITFG) in Deutschland. Es untersucht, ob der Bund oder die Länder die Gesetzgebungskompetenz für ein solches Gesetz hätten und ob ein entsprechendes Gesetz materiell verfassungsgemäß wäre. Dabei werden die Rechte der Nutzer und der Provider berücksichtigt.
Welche Kompetenzen des Bundes werden im Hinblick auf das Internetfiltergesetz geprüft?
Das Gutachten prüft, ob der Bund eine Gesetzgebungskompetenz aus folgenden Artikeln des Grundgesetzes (GG) ableiten kann: Art. 73 Nr. 7 GG (ausschließliche Gesetzgebung für Postwesen und Telekommunikation), Art. 74 I Nr. 11 GG (konkurrierende Gesetzgebung für das Recht der Wirtschaft) und Art. 75 I 1 Nr. 2 GG (Rahmengesetzgebung für allgemeine Rechtsverhältnisse der Presse).
Welche Rechte der Inhaltsanbieter werden im Gutachten betrachtet?
Das Gutachten untersucht, ob das Internetfiltergesetz die Grundrechte der Inhaltsanbieter aus Art. 5 I GG (Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit), Art. 5 III 1 GG (Kunstfreiheit) und Art. 10 I 3. Alt. GG (Fernmeldegeheimnis) verletzt.
Welche Rechte der Nutzer als Konsumenten werden untersucht?
Das Gutachten prüft, ob das Internetfiltergesetz die Informationsfreiheit (Art. 5 I 1 2. HS GG) und das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 I 3. Alt. GG) der Nutzer als Konsumenten beeinträchtigt.
Welche Rechte der Provider werden im Gutachten berücksichtigt?
Das Gutachten untersucht, ob das Internetfiltergesetz die Rechte der Provider aus Art. 14 I 1 GG (eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb) und Art. 12 I 1 GG (Berufsfreiheit) verletzt.
Was ist das Ergebnis des Gutachtens bezüglich der Gesetzgebungskompetenz?
Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass der Bund die Kompetenz zum Erlass des Internetfiltergesetzes aus Art. 73 Nr. 7 GG (für rein individualkommunikative Internetdienste und die technische Seite des Internetfilters) und Art. 75 I 1 Nr. 2 GG, 75 II GG i.V.m. Art. 72 GG (Rahmengesetzgebung für Dienste, die unter den Pressebegriff fallen) besitzt.
Was ist das Ergebnis des Gutachtens bezüglich der materiellen Verfassungsmäßigkeit?
Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass das Internetfiltergesetz materiell verfassungswidrig ist, da es im Bereich der Überwachung der Individualkommunikation (z.B. Email) gegen das Fernmeldegeheimnis aus Art. 10 I 3. Alt. GG verstößt.
Was wird über das Zensurverbot im Zusammenhang mit dem Internetfiltergesetz ausgesagt?
Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass das geplante Gesetz nicht gegen das Zensurverbot aus Art. 5 I 3 GG verstößt, da es sich nicht um eine Vorzensur im Sinne eines Verbots mit Erlaubnisvorbehalt handelt und das Zensurverbot nur die Vorzensur erfasst.
Welche Bedeutung hat der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Gutachten?
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird im gesamten Gutachten bei der Prüfung der Rechtfertigung von Eingriffen in Grundrechte berücksichtigt. Es wird geprüft, ob das Gesetz geeignet, erforderlich und angemessen ist, um den angestrebten Zweck zu erreichen.
- Citation du texte
- Ralf Dessel (Auteur), 2001, Medienverfassungsrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104012