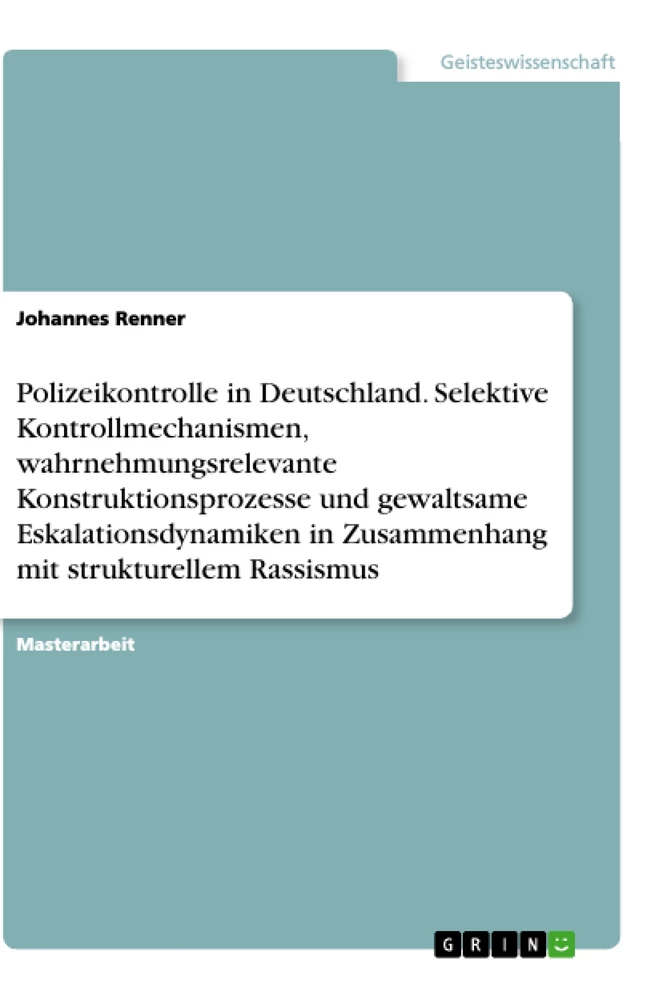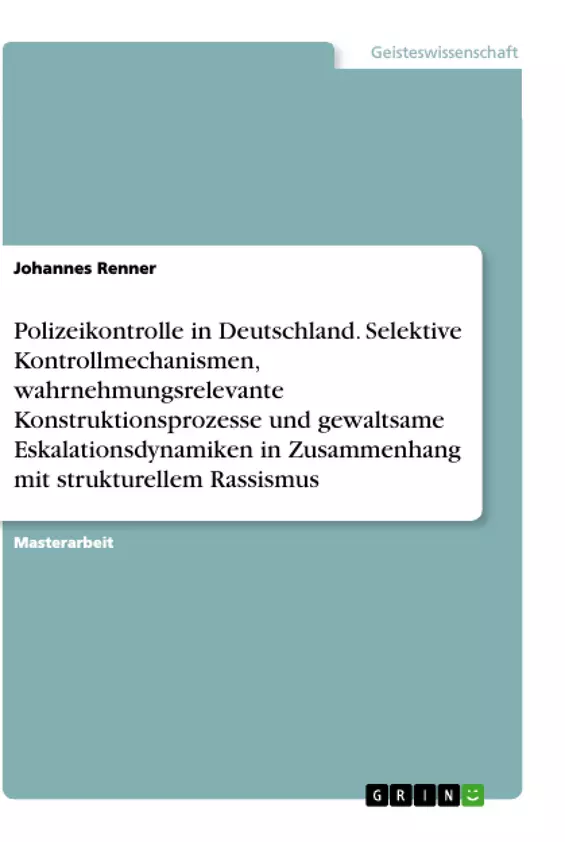Polizeiarbeit ist nur in Wechselwirkung mit der sie umgebenden Gesellschaft zu verstehen. Die Gesellschaft als solches ist in einem stetigen sozialen Wandel begriffen. Politische und kulturelle Rahmenbedingungen müssen bei einer soziologischen Analyse der Polizei berücksichtigt werden, wenn es darum geht die Interaktion zwischen Polizist und Zivilist reflexiv und mehrdimensional einzuordnen. Es ist also eine systemfunktionalistisch vergleichende Rahmung der Polizei in modernen Gesellschaften notwendig. Die Funktion und Wahrnehmung von Polizei ist wichtig, um zu einem einordnenden Verständnis der jeweiligen Akteursperspektiven zu gelangen. Daran anschließend entfalte ich theoretische Perspektiven der Polizeikontrolle, die vor dem Hintergrund kultursoziologischer Wandlungsprozesse zu begreifen sind.
Die theoretische Grundierung der Kontrolle an und für sich bildet den Hintergrund zur folgenden spezifischen soziologischen Analyse selektiver Kontrollmechanismen. In diesem Teil meiner Arbeit werde ich Sequenzen selbstgeführter narrativer Leitfadeninterviews mit Migranten und Polizeibeamten auswerten und als ergänzende Quellen mit bereits vorhandenem empirischem Material verknüpfen. Dadurch verdichte ich empirische Daten interpretativ und generiere (neue) Hypothesen. Die explizite Forschungslücke, die ich mit meiner Arbeit zu füllen hoffe, bezieht sich in erster Linie auf makrosoziologische Einflussfaktoren der Kontrollsituation.
Die Wahrnehmung von Diskriminierung und Rassismus könnte zu einem gewissen Teil durch selbstexkludierende Sozialisationstendenzen, mediale und soziologische Konstruktionsprozesse von Opfer- und Feindrollen-Denken und bewusste Neutralisierungstechniken verzerrt sein. Neben der soziologischen Untersuchung selektiver Kontrollmechanismen und der vorstrukturierenden Konstruktionsprozesse beschreibe ich in dieser Arbeit auch konkrete Abläufe von entsprechenden Situationen. Hierbei tauche ich vor dem makrosoziologischen Hintergrund der Kontrolle tief in situative Eskalationsprozesse ein und erkläre den Ausbruch von Gewalt an ausgewählten Beispielen.
Inhaltsverzeichnis
- /
- (LQOHLWXQJXQG)RUVFKXQJVYRUKDEHQ
- *HJHQZlUWLJHU)RUVFKXQJVVWDQG
- 0HWKRGLVFKHV9RUJHKHQXQG%HVFKUHLEXQJGHV'DWHQPDWHULDOV
- 'lh5roohghuu6wddwvirup">3ROL]HLLQPRGHUQHQ*HVHOOVFKDIWHQ )XQNWLRQXQG:DKUQHKPXQJ
- *HZDOWVDPH(VNDODWLRQVG\QDPLNHQSROL]HLOLFKHU.RQWUROOHQ
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Polizeikontrollen im Kontext von rassistischen und ethnischen Diskriminierungserfahrungen. Sie analysiert die Wahrnehmung von Polizeikontrollen durch verschiedene Akteure, wie Bürger*innen mit Migrationshintergrund, Sozialarbeiter*innen und Polizist*innen. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung in der Praxis von Polizeikontrollen.
- Die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen in der Wahrnehmung von Polizeikontrollen durch Bürger*innen mit Migrationshintergrund.
- Die Bedeutung von sozialer und kultureller Prägung sowie individuellen Erfahrungen in der Konstruktion von Polizeikontrollkriterien.
- Die strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen, die zu rassistischen und ethnischen Diskriminierungserfahrungen im Kontext von Polizeikontrollen führen können.
- Die Auswirkungen von Polizeikontrollen auf das Sicherheitsgefühl und das Vertrauen von Bürger*innen mit Migrationshintergrund in die Polizei.
- Die Notwendigkeit einer kritischen Reflexion der Polizeiarbeit im Kontext von Rassismus und ethnischer Diskriminierung.
Zusammenfassung der Kapitel
/
Das erste Kapitel liefert einen Überblick über die Forschungslandschaft zu Polizeikontrollen und rassischer Diskriminierung. Es werden zentrale Konzepte und Theorien vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit relevant sind.
(LQOHLWXQJXQG)RUVFKXQJVYRUKDEHQ
Das zweite Kapitel analysiert die Wahrnehmung von Polizeikontrollen durch Bürger*innen mit Migrationshintergrund. Es werden Interviews mit Betroffenen ausgewertet, um ihre Erfahrungen und Perspektiven zu beleuchten.
*HJHQZlUWLJHU)RUVFKXQJVVWDQG
Im dritten Kapitel geht es um die subjektiven Kontrollkriterien von Polizeibeamt*innen. Es werden Interviews mit Polizist*innen analysiert, um ihre Sicht auf das Thema Polizeikontrollen und ihre damit verbundenen Entscheidungen zu verstehen.
0HWKRGLVFKHV9RUJHKHQXQG%HVFKUHLEXQJGHV'DWHQPDWHULDOV
Das vierte Kapitel untersucht die Rolle von Sozialarbeiter*innen im Kontext von Polizeikontrollen und rassischer Diskriminierung. Es werden Interviews mit Sozialarbeiter*innen analysiert, um ihre Erfahrungen mit rassistischen und ethnischen Diskriminierungserfahrungen im Kontext von Polizeikontrollen zu verstehen und zu beleuchten, wie sie ihren Klient*innen in solchen Situationen helfen können.
'lh5roohghuu6wddwvirup">:DKUQHKPXQJVUHOHYDQWH3ROL]HLIHLQGELOGNRQVWUXNWLRQHQ
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Frage, wie Polizeikontrollen von Bürger*innen mit Migrationshintergrund wahrgenommen werden und welche Rolle dabei die Interaktion mit Polizist*innen spielt. Es werden Interviews mit Bürger*innen analysiert, um ihre Erfahrungen und Perspektiven auf die Kommunikation und das Verhalten von Polizist*innen im Kontext von Polizeikontrollen zu verstehen.
6R]LRORJLHGHU3ROL]HLNRQWUROOH
Das sechste Kapitel beleuchtet die Auswirkungen von Polizeikontrollen auf das Sicherheitsgefühl von Bürger*innen mit Migrationshintergrund. Es werden Interviews mit Bürger*innen analysiert, um ihre Wahrnehmung von Sicherheit und Unsicherheit in ihrem Alltag zu verstehen und zu beleuchten, wie sich ihre Erfahrungen mit Polizeikontrollen auf dieses Gefühl auswirken.
'lh5roohghuu6wddwvirup">7KHRUHWLVFKH3HUVSHNWLYHQGHU 3ROL]HL .RQWUROOH
Das siebte Kapitel analysiert, wie Polizeikontrollen als Ausdruck von Macht und Kontrolle wahrgenommen werden und welche Rolle dabei der Migrationshintergrund der Bürger*innen spielt. Es werden Interviews mit Bürger*innen mit Migrationshintergrund analysiert, um die Rolle von Macht und Kontrolle im Kontext von Polizeikontrollen aus ihrer Sicht zu verstehen.
'lh5roohghuu6wddwvirup">3ROL]HLLQPRGHUQHQ*HVHOOVFKDIWHQ )XQNWLRQXQG:DKUQHKPXQJ
Das achte Kapitel untersucht, wie sich die Erfahrungen mit Polizeikontrollen auf das Vertrauen in die Polizei auswirken können. Es werden Interviews mit Bürger*innen mit Migrationshintergrund analysiert, um zu verstehen, wie ihre Erfahrungen mit Polizeikontrollen ihr Vertrauen in die Polizei beeinflussen.
*HZDOWVDPH(VNDODWLRQVG\QDPLNHQSROL]HLOLFKHU.RQWUROOHQ
Das neunte Kapitel befasst sich mit der Frage, ob und wie Polizeikontrollen mit dem Migrationshintergrund der Bürger*innen zusammenhängen. Es werden Interviews mit Bürger*innen mit Migrationshintergrund, Sozialarbeiter*innen und Polizeibeamt*innen analysiert, um die Rolle des Migrationshintergrunds bei Polizeikontrollen zu verstehen.
$EVFKOLH‰HQGH=XVDPPHQIDVVXQJXQG+\SRWKHVHQ
Das zehnte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Implikationen der Forschung für die Praxis. Es werden Empfehlungen für eine gerechtere und diskriminierungsfreie Polizeiarbeit gegeben.
'DQNVDJXQJ
Im elften Kapitel wird ein Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe gegeben. Es werden weitere Forschungsfragen geplant, um das Thema der rassistischen und ethnischen Diskriminierung im Kontext von Polizeikontrollen weiter zu untersuchen und zu analysieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf Polizeikontrollen, Rassismus, ethnische Diskriminierung, Migrationshintergrund, Wahrnehmung, Kontrollkriterien, Sicherheitsgefühl, Vertrauen in die Polizei, Stereotypen, Vorurteile, Macht, Kontrolle, Kommunikation, Interaktion, Erfahrungen, Empfehlungen, kritische Reflexion, Praxis, Forschungsbedarfe, Forschungsfragen.
- Arbeit zitieren
- Johannes Renner (Autor:in), 2021, Polizeikontrolle in Deutschland. Selektive Kontrollmechanismen, wahrnehmungsrelevante Konstruktionsprozesse und gewaltsame Eskalationsdynamiken in Zusammenhang mit strukturellem Rassismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040183