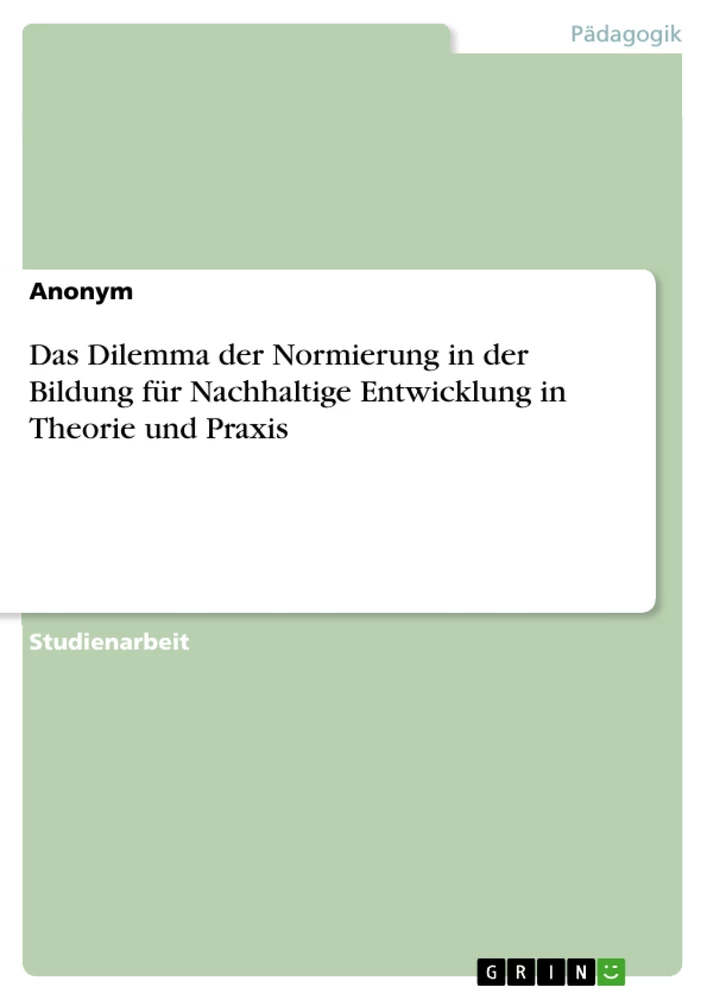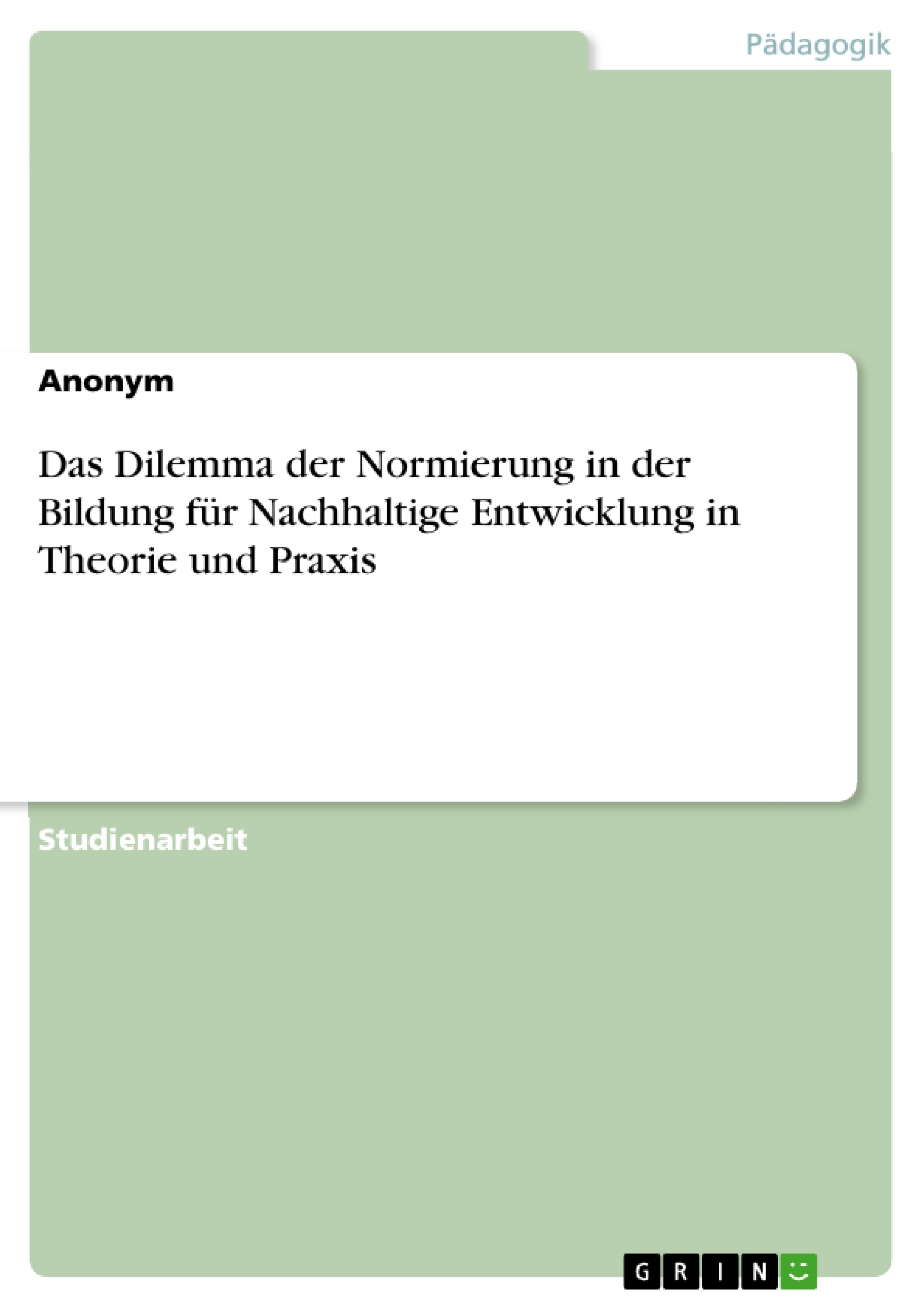Ein grundlegendes Dilemma der BNE ist die Normierung der Zukunft der Heranwachsenden. Diese Hausarbeit will sich näher mit diesem Dilemma befassen und dazu sowohl Theorie, als auch Praxis dieser Bildungsoffensive in den letzten 25 Jahren untersuchen. Was wurde versucht, um der Normierung zu entkommen? Welche Erwartungen wurden erfüllt, welche enttäuscht? Welche Ziele wurden erreicht und wie dynamisch war die Beziehung zwischen theoretischer und praktischer Arbeit im Bereich der BNE?
Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass die Vereinten Nationen die Agenda 21 verabschiedet haben. Sie stellt die Übereinkunft dar, die nachhaltige Entwicklung als gemeinsames Leitbild der Menschheit im 21. Jahrhundert festzulegen. Um dies zu erreichen, sei die "Förderung der Schulbildung, des öffentlichen Bewusstseins und der beruflichen Aus- und Fortbildung" fundamental. Mit dieser Forderung wurde gleichzeitig auch die erste offizielle Verknüpfung von nachhaltiger Entwicklung und Bildung formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu Vorgehen und Themenwahl
- Die Theorie
- Legitimation, Probleme und Zielsetzungen
- Kompetenzen
- Die Praxis
- Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
- Programm 21 und Transfer-21
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Dilemma der Normierung der Zukunft von Heranwachsenden im Kontext der Bildungsoffensive Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Sie untersucht die theoretischen und praktischen Aspekte dieser Bildungsoffensive in den letzten 25 Jahren, insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie versucht wurde, der Normierung zu entkommen. Die Arbeit analysiert, welche Erwartungen erfüllt und welche enttäuscht wurden, welche Ziele erreicht wurden und wie dynamisch die Beziehung zwischen theoretischer und praktischer Arbeit im Bereich der BNE war.
- Die Normierung der Zukunft von Heranwachsenden in der BNE
- Die theoretischen Grundlagen der BNE
- Die praktische Umsetzung der BNE in Deutschland
- Die Herausforderungen der BNE im Kontext der nachhaltigen Entwicklung
- Die Rolle von Dr. Gerhard de Haan im Diskursfeld der BNE
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema und die Forschungsfrage einführt. Sie beleuchtet die Bedeutung der Agenda 21, die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und die Bildungsoffensive BNE in Deutschland. Das zweite Kapitel widmet sich dem Vorgehen und der Themenwahl, wobei die Arbeit von Dr. Gerhard de Haan als einflussreicher Akteur der BNE-Diskussion im Mittelpunkt steht. Im dritten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der BNE vorgestellt, darunter die Schriften von de Haan und anderen Akteuren, sowie der philosophische Diskurs über nachhaltige Entwicklung. Das dritte Kapitel behandelt insbesondere die Legitimation, die Probleme und die Zielsetzungen der BNE. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Praxis der BNE in Deutschland, wobei die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und das Programm 21 und Transfer 21 im Fokus stehen. Der Abschluss der Arbeit wird im Fazit gezogen, in dem die zentralen Ergebnisse und Schlussfolgerungen zusammengefasst werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Agenda 21, UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, Programm 21, Transfer 21, Normierung der Zukunft, nachhaltige Entwicklung, kritische Erziehungswissenschaft, Dr. Gerhard de Haan, philosophische Grundlagen, Praxisbeispiele, Deutschland.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Das Dilemma der Normierung in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040232