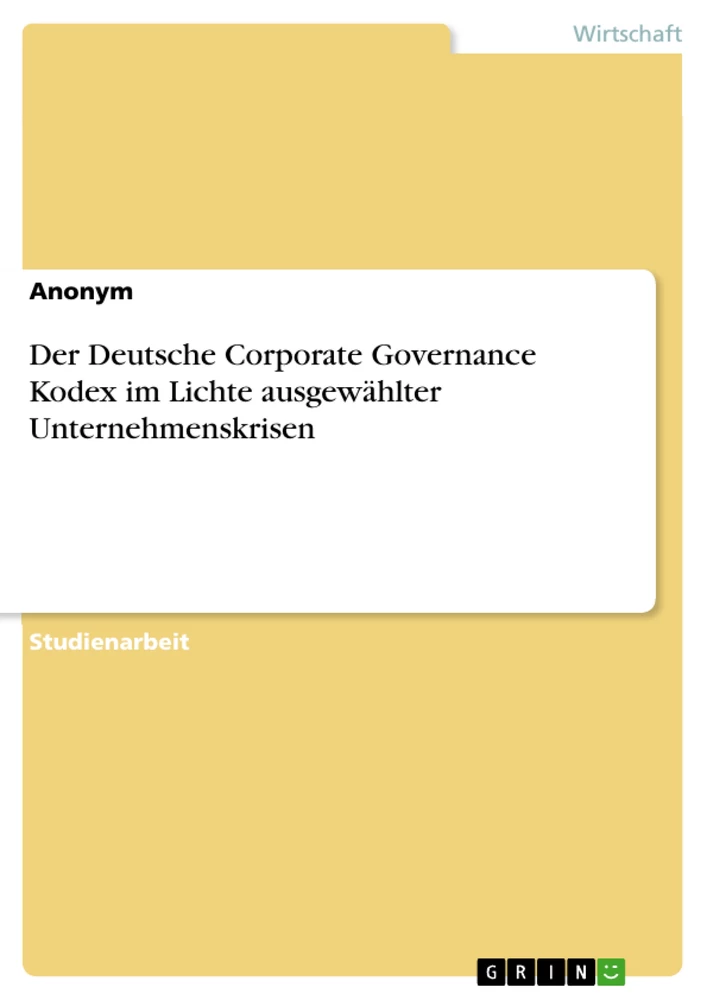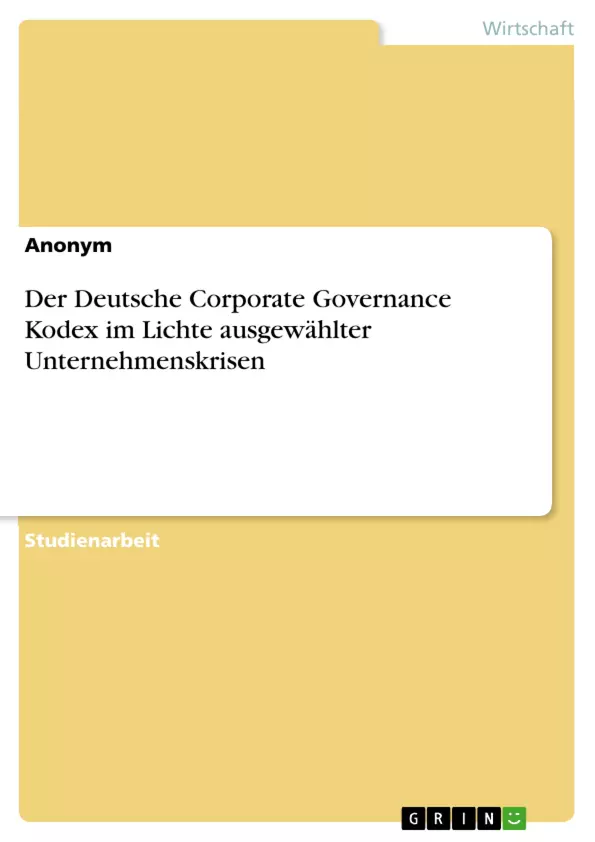Mit der Etablierung des Deutschen Coporate-Governance Kodex (DCGK) war der Anspruch verbunden, die unter dem Begriff der Corporate Governance gefassten Probleme einer wirksamen Regulierung zu unterziehen. Von besonderer Bedeutung ist das dabei zugrundgelegte comply-or-explain-Prinzip und die auf dieser Basis generierten Entsprechenserklärungen nach §161 AktG. Tatsächlich zeigt ein Blick in die betriebliche Praxis, dass diese Erwartungen durch den DCGK nur bedingt erfüllt wurde. In Bezug auf die zahlreichen Unternehmenskrisen, die nach Einführung des Kodex in Deutschland auftraten, stellt sich die Frage, welchen Mehrwert der DCGK und die daraus resultierende Erhöhung der Anforderungen im regulatorischen Bereich für die Unternehmen, Investoren und Anleger geschaffen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Vorgehensweise und Zielsetzung
- Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen
- Grundlagen der Corporate Governance
- Der Deutsche Corporate Governance Kodex
- Hintergründe und historische Entwicklung
- Aufbau, Inhalte und Ziele des Kodex
- Die Entsprechenserklärung nach §161 AktG
- Kritik am Deutschen Corporate Governance Kodex
- Der Dieselskandal der Volkswagen AG im Jahr 2015: Eine kritische Analyse
- Sachverhalt der Unternehmenskrise
- Relevanz für die Corporate Governance
- Defizite am DCGK und Handlungsempfehlungen
- Kritische Reflexion
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) im Lichte ausgewählter Unternehmenskrisen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, inwieweit der Kodex zur Vermeidung von Unternehmenskrisen beitragen kann und welche Defizite er aufweist.
- Entwicklung und Bedeutung des DCGK
- Kritik am DCGK und dessen Wirksamkeit
- Unternehmenskrisen als Indikatoren für CG-Defizite
- Der Dieselskandal der Volkswagen AG als Fallbeispiel
- Handlungsempfehlungen zur Verbesserung des DCGK
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz von Corporate Governance und stellt die Problemstellung dar, die im Zentrum der Arbeit steht. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Corporate Governance und des DCGK erörtert. Die Kapitel drei und vier befassen sich mit dem Dieselskandal der Volkswagen AG als Fallbeispiel für eine Unternehmenskrise, die auf Defizite im Bereich der Corporate Governance zurückzuführen ist. Dabei werden die Relevanz der Krise für die Corporate Governance sowie die Kritikpunkte am DCGK im Zusammenhang mit der Krise untersucht. In der Schlussbetrachtung werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst und Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung des DCGK abgeleitet.
Schlüsselwörter
Der Deutsche Corporate Governance Kodex, Unternehmenskrisen, Volkswagen AG, Dieselskandal, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Compliance, Stakeholder-Management, Unternehmensethik.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Der Deutsche Corporate Governance Kodex im Lichte ausgewählter Unternehmenskrisen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040315