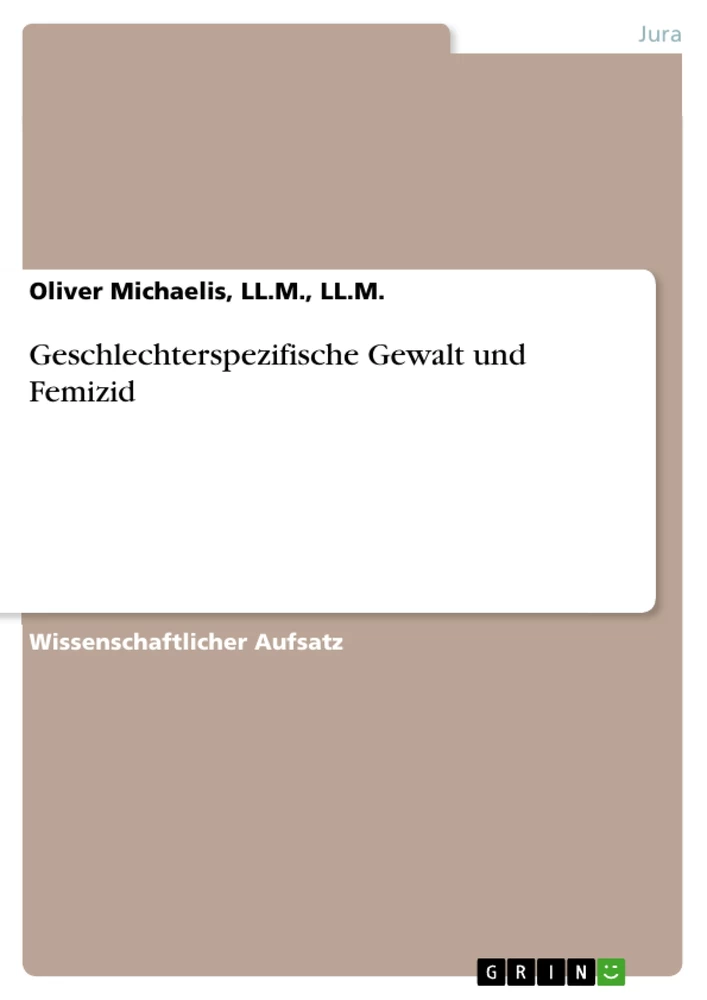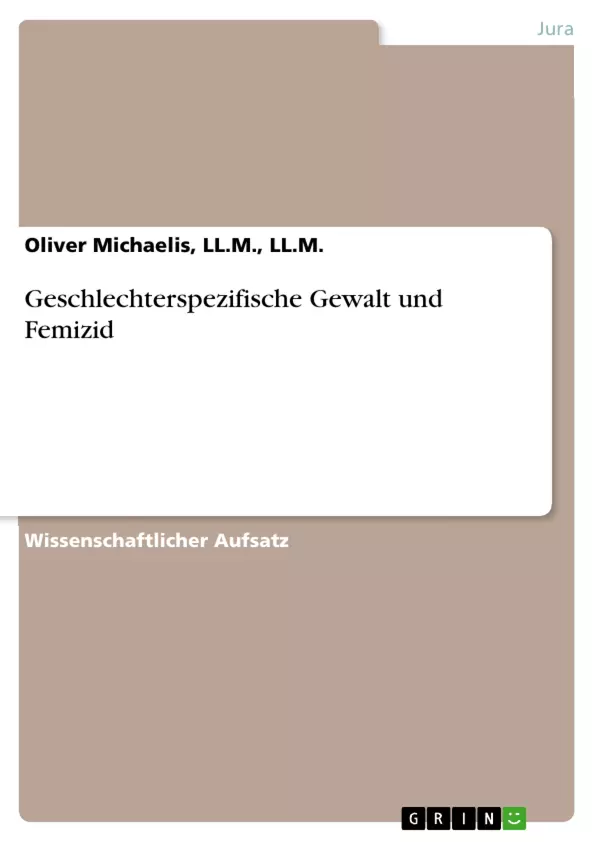In dieser Arbeit sollen zwei Fragestellungen beantwortet werden. Im ersten Teil wird die geschlechtsspezifische Gewalt erläutert und gezeigt, welchen Einfluss sie auf die geschlechtsspezifische Sozialisation hat. Im zweiten Teil wird die Thematik der geschlechtsbezogenen Tötung von Frauen behandelt und dazu Stellung genommen, ob das deutsche Strafrecht bereits ausreichend Schutz bietet, oder ob eine explizite Regelung des „Frauenmordes“ erforderlich ist
Inhaltsverzeichnis
- Thema 1: Geschlechterspezifische Gewalt
- Fragestellung
- Lösung
- Begriffsbestimmungen
- Gewalt
- Geschlechtsspezifische Gewalt
- Sozialisation
- geschlechtsspezifische Sozialisation
- Heteronormativität / binäres Geschlechtsmodell
- Unterscheidung der erfahrenen Gewalt
- Gewalt gegen Jungen / Männer
- in der Familie
- in der Schule / Peergroup / beim Sport
- in der Kirche
- Gewalt gegen Mädchen / Frauen
- in der Familie
- im sozialen Nahbereich
- Gewalt gegen divers
- Einfluss auf die geschlechtsspezifische Sozialisation
- Thema 2: Femizid
- Fragestellung
- Lösung
- Hintergrund
- Allgemein
- Ländervergleich
- United Kingdom
- Italien
- Spanien
- Frankreich
- Deutschland
- weltweit
- Instrumente zur Bekämpfung von Frauenmorden
- Das Urteil des BGH vom 29.10.2008 - 2 StR 349/08
- Rechtsprechung bis zum Urteil
- Nach dem BGH-Urteil
- der Beschluss des BGH vom 07.05.2019 - 1 StR 150/19
- zum Sachverhalt
- Ansicht des LG München I
- Ansicht BGH vom 07.05.2019 – 1 StR 150/19
- Ansicht Grünewald
- vertretene Ansichten
- Ansicht Steinl
- Ansicht Wolff
- Ansicht Winkelmeier-Becker
- Ansicht Fechner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der geschlechtsspezifischen Gewalt und untersucht insbesondere den Femizid. Ziel ist es, die verschiedenen Formen und Ursachen von Gewalt gegen Menschen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu beleuchten und die besonderen Herausforderungen im Kontext des Femizids zu analysieren.
- Begriffliche Abgrenzung von Gewalt und geschlechtsspezifische Gewalt
- Untersuchung der unterschiedlichen Formen und Auswirkungen von Gewalt gegen Jungen / Männer, Mädchen / Frauen und diverse Personen
- Analyse des Einflusses der geschlechtsspezifischen Sozialisation auf die erfahrene Gewalt
- Einführung in die Thematik des Femizids und die rechtliche Einordnung in Deutschland
- Diskussion verschiedener wissenschaftlicher Ansätze zur Erklärung des Femizids
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit dem Begriff der geschlechtsspezifischen Gewalt. Es werden verschiedene Definitionen von Gewalt und die Besonderheiten der geschlechtsspezifischen Gewalt beleuchtet. Zudem wird der Einfluss der Sozialisation und der geschlechtsspezifischen Sozialisation auf die Entstehung von Gewalt analysiert.
Im zweiten Kapitel wird das Phänomen des Femizids fokussiert. Es wird eine Einführung in die Thematik gegeben, sowie ein Ländervergleich und ein Überblick über aktuelle juristische Entwicklungen und rechtliche Instrumente zur Bekämpfung von Frauenmorden gegeben. Das Kapitel beleuchtet auch die unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansichten zum Femizid.
Schlüsselwörter
Geschlechtsspezifische Gewalt, Femizid, Sozialisation, Heteronormativität, binäres Geschlechtsmodell, Rechtsprechung, Frauenmord, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Männer, Gewalt gegen diverse Personen, wissenschaftliche Ansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter geschlechtsspezifischer Gewalt?
Es handelt sich um Gewalt, die gegen Personen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer Zugehörigkeit zu einem Geschlecht ausgeübt wird, oft verwurzelt in ungleichen Machtverhältnissen.
Was ist ein Femizid?
Femizid bezeichnet die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Die Arbeit diskutiert, ob das deutsche Strafrecht hierfür eine explizite Regelung benötigt.
Wie beeinflusst Sozialisation die Gewaltbereitschaft?
Die geschlechtsspezifische Sozialisation prägt Rollenbilder und Verhaltensmuster. Heteronormativität und binäre Geschlechtsmodelle können zur Entstehung und Akzeptanz von Gewalt beitragen.
Gibt es geschlechtsspezifische Gewalt auch gegen Männer?
Ja, die Arbeit untersucht auch Gewalt gegen Jungen und Männer, etwa in der Familie, Schule oder Kirche, und wie diese mit männlichen Rollenbildern verknüpft ist.
Wie ist die Rechtslage zum Femizid in Deutschland?
Die Arbeit analysiert die aktuelle Rechtsprechung des BGH und diskutiert, ob bestehende Mordmerkmale ausreichen oder ob ein spezifischer Tatbestand „Frauenmord“ erforderlich ist.
- Quote paper
- Oliver Michaelis, LL.M., LL.M. (Author), 2021, Geschlechterspezifische Gewalt und Femizid, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1041072