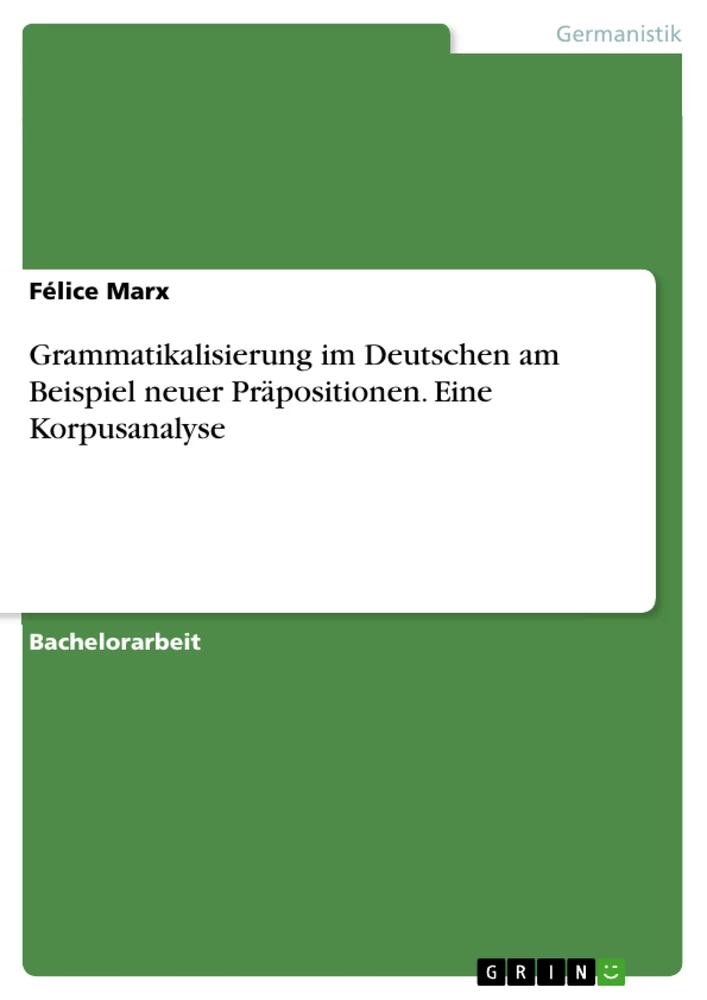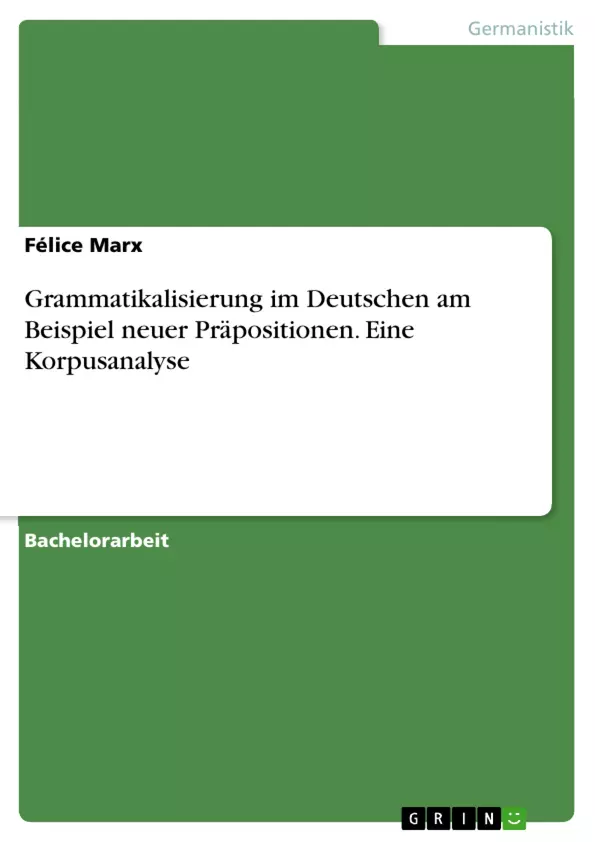Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den neuen Präpositionen des Deutschen, die vor allem mit Schwerpunkt auf ihre Grammatikalisierung untersucht werden sollen. Das Augenmerk soll hierbei auf den komplexen Präpositionen liegen, die aus Präposition-Substantiv-Verbindungen, also Präpositionalphrasen bestehen. Im Allgemeinen gehören Präpositionen zu den Wortarten des Deutschen, die am häufigsten vorkommen und sich in fast jedem Satz wiederfinden. In der Schulgrammatik werden sie in der Regel als Wörter beschrieben, die bestimmte Verhältnisse aufzeigen und Relationen herstellen.
Präpositionen haben Rektionsfähigkeit, das heißt sie fordern einen bestimmten Kasus für die ihnen zugehörigen, deklinierbaren Wörter. Diese Rektionsfähigkeit ist in den letzten Jahren wieder verstärkt in das Zentrum der gesellschaftlichen Debatte über Sprache gerückt. Grund dafür ist unter anderem die populärwissenschaftliche Veröffentlichung "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" von Bastian Sick aus dem Jahr 2004, die das Bewusstsein für Kasusschwankungen des Deutschen geschärft hat. Sick ist der Auffassung, dass es durch diese Kasuswechsel von Genitiv zum Dativ zu einem Verfall der deutschen Sprache kommt. Es gibt allerdings andere Theorien, die belegen, dass Kasusänderungen ein fester Bestandteil deutscher Sprache und ein Prozess der Grammatikalisierung sind. Deutlich wird dies unter anderem daran, dass die primären Präpositionen, zu ihnen zählen zum Beispiel von, auf, an, vor usw., die bereits einen hohen Grad der Grammatikalisierung erreicht haben, nicht den Genitiv, sondern den Akkusativ oder den Dativ regieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grammatikalisierung
- 2.1. Lehmanns Modell
- 3. Präpositionen: Schwierigkeiten der Kategorisierung?
- 3.1. Präpositionen: Definition ex negativum
- 3.2. Idealpräpositionale vs. maximale Differenziertheit
- 3.3. Neue Präpositionen
- 4. Begründung der ausgewählten Korpora
- 4.1. Methodik
- 4.2 Im Verlauf im Korpus des DWDS
- 4.2.1 Im Verlauf in der DGD
- 4.3. Laufe im DWDS
- 4.3.1 Im Laufe in der DGD
- 4.4. Im Vorfeld im DWDS
- 4.4.1. Im Vorfeld in der DGD
- 5. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht neue deutsche Präpositionen und deren Grammatikalisierungsprozess. Der Fokus liegt auf komplexen Präpositionen, die aus Präposition-Substantiv-Verbindungen bestehen. Die Arbeit analysiert, wie diese Präpositionen entstehen, welche Entwicklungsschritte sie durchlaufen und wie sich ihr Grammatikalisierungsgrad anhand verschiedener Parameter (Häufigkeit, Desemantisierung, Kasusschwankung) in schriftlichen und mündlichen Korpora (DWDS und DGD) darstellt.
- Grammatikalisierung komplexer Präpositionen
- Analyse des Sprachwandels anhand von Korpusdaten
- Vergleich schriftlicher und mündlicher Sprachgebrauch
- Definition und Abgrenzung von Präpositionen
- Theorien zur Entwicklung neuer Präpositionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der neuen deutschen Präpositionen und deren Grammatikalisierung ein. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf komplexe Präpositionen, die aus Präposition-Substantiv-Verbindungen bestehen, und hebt die Relevanz der Untersuchung im Kontext der aktuellen sprachwissenschaftlichen Diskussion um Kasusschwankungen hervor. Die Arbeit kündigt die methodischen Ansätze an, die im weiteren Verlauf zur Analyse der Grammatikalisierung verwendet werden, wie die Untersuchung von Korpora und die Berücksichtigung von Parametern wie Desemantisierung und Kasusschwankung. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und stellt die Forschungsfragen vor, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden sollen.
2. Grammatikalisierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Grammatikalisierung und präsentiert verschiedene Modelle zur Bestimmung des Grammatikalisierungsgrades. Lehmanns Modell wird als besonders relevant dargestellt. Der Fokus liegt auf der Erläuterung des Prozesses, wie lexikalische Elemente zu grammatischen Elementen werden und wie dieser Prozess den Kasuswandel erklären kann. Das Kapitel liefert den theoretischen Hintergrund für die spätere Analyse der untersuchten Präpositionen. Die Erläuterungen zu Lehmanns Modell bieten ein tiefgreifendes Verständnis des Grammatikalisierungsprozesses und bilden die Basis für die Analyse der im folgenden Kapitel vorgestellten Korpora. Der Bezug zu aktuellen sprachwissenschaftlichen Diskussionen wird hergestellt und verdeutlicht die Bedeutung der Thematik.
3. Präpositionen: Schwierigkeiten der Kategorisierung?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Präpositionen, insbesondere mit den Schwierigkeiten ihrer Abgrenzung zu anderen Wortarten. Es wird eine Definition ex negativum vorgestellt, die die Unterschiede zu anderen Wortklassen hervorhebt und die fließenden Grenzen zwischen Wortklassen verdeutlicht. Anschließend werden zwei Ansätze vorgestellt, die die Veränderung von Präpositionen erklären: Lindqvists Idealpräpositionalität und Di Meolas Erweiterung dieses Ansatzes, die auch die maximale Differenzierung zur Ursprungswortart berücksichtigt. Das Kapitel liefert wichtige theoretische Grundlagen für die anschließende Korpusanalyse, indem es die Komplexität der Kategorisierung von Präpositionen aufzeigt und verschiedene Erklärungsansätze für ihre Veränderung präsentiert. Die beiden diskutierten Ansätze, die sich auf die Annäherung an ein Ideal und die gleichzeitige Distanzierung von der Ursprungswortart konzentrieren, bieten eine differenzierte Perspektive auf die Entwicklung neuer Präpositionen.
4. Begründung der ausgewählten Korpora: In diesem Kapitel werden die gewählten Korpora (DWDS und DGD) und die Methodik ihrer Analyse begründet. Die Arbeit beschreibt den Ansatz, die Häufigkeit, Desemantisierung und Kasusschwankungen der Präpositionen "im Lauf", "im Verlauf" und "im Vorfeld" zu untersuchen, um ihren Grammatikalisierungsgrad zu bestimmen. Der methodische Ansatz des Vergleichs schriftlicher und mündlicher Sprache wird detailliert erläutert und die Grenzen der Analyse aufgrund der begrenzten Anzahl der untersuchten Beispiele werden offen angesprochen. Die Begründung der Korpuswahl und der Methodik ist essentiell für die Nachvollziehbarkeit und die Bewertung der Ergebnisse. Die offene Auseinandersetzung mit den Limitationen der Studie unterstreicht die wissenschaftliche Seriosität der Arbeit.
Schlüsselwörter
Grammatikalisierung, Präpositionen, Kasus, Korpuslinguistik, DWDS, DGD, Sprachwandel, komplexe Präpositionen, Desemantisierung, synchronische Analyse, Idealpräpositionale, Wortarten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Grammatikalisierung neuer deutscher Präpositionen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Grammatikalisierung neuer deutscher Präpositionen, insbesondere komplexer Präpositionen, die aus Präposition-Substantiv-Verbindungen bestehen (z.B. "im Verlauf", "im Laufe", "im Vorfeld"). Der Fokus liegt auf der Analyse ihrer Entstehung, Entwicklung und des Grammatikalisierungsgrades anhand verschiedener Parameter.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Analyse basiert auf Korpusdaten des DWDS (Deutsches Wörterbuch der Gegenwartssprache) und der DGD (Deutsche Gegenwartssprache). Es werden Parameter wie Häufigkeit, Desemantisierung und Kasusschwankung untersucht, um den Grammatikalisierungsgrad der Präpositionen zu bestimmen. Ein Vergleich zwischen schriftlicher und mündlicher Sprache wird durchgeführt.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Modelle der Grammatikalisierung, insbesondere das Modell von Lehmann. Es werden außerdem unterschiedliche Ansätze zur Definition und Kategorisierung von Präpositionen diskutiert, darunter die Idealpräpositionale von Lindqvist und Di Meolas Erweiterung dieses Ansatzes.
Welche Präpositionen werden konkret untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die komplexen Präpositionen "im Lauf", "im Verlauf" und "im Vorfeld". Die Analyse untersucht deren Häufigkeit, Desemantisierung und Kasusschwankungen in den gewählten Korpora.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grammatikalisierung (inkl. Lehmanns Modell), Schwierigkeiten der Präpositionenkategorisierung, Begründung der Korpora und Methodik, Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welche Forschungsfragen werden beantwortet?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung und Entwicklung der untersuchten komplexen Präpositionen zu beleuchten, ihren Grammatikalisierungsgrad zu bestimmen und die Unterschiede im Sprachgebrauch zwischen schriftlicher und mündlicher Sprache aufzuzeigen. Die Arbeit thematisiert auch die Schwierigkeiten bei der Definition und Abgrenzung von Präpositionen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grammatikalisierung, Präpositionen, Kasus, Korpuslinguistik, DWDS, DGD, Sprachwandel, komplexe Präpositionen, Desemantisierung, synchrone Analyse, Idealpräpositionale, Wortarten.
Welche Korpora wurden verwendet und warum?
Die Arbeit verwendet die Korpora DWDS und DGD, um einen Vergleich zwischen schriftlicher und mündlicher Sprache zu ermöglichen. Die Wahl der Korpora wird im Kapitel 4 detailliert begründet.
Welche Limitationen der Studie werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Limitationen, die sich aus der begrenzten Anzahl der untersuchten Beispiele ergeben.
Wo finde ich die vollständigen Ergebnisse?
Die vollständigen Ergebnisse der Analyse sind im Hauptteil der Bachelorarbeit enthalten (hier nur Auszüge).
- Arbeit zitieren
- Félice Marx (Autor:in), 2021, Grammatikalisierung im Deutschen am Beispiel neuer Präpositionen. Eine Korpusanalyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1041556