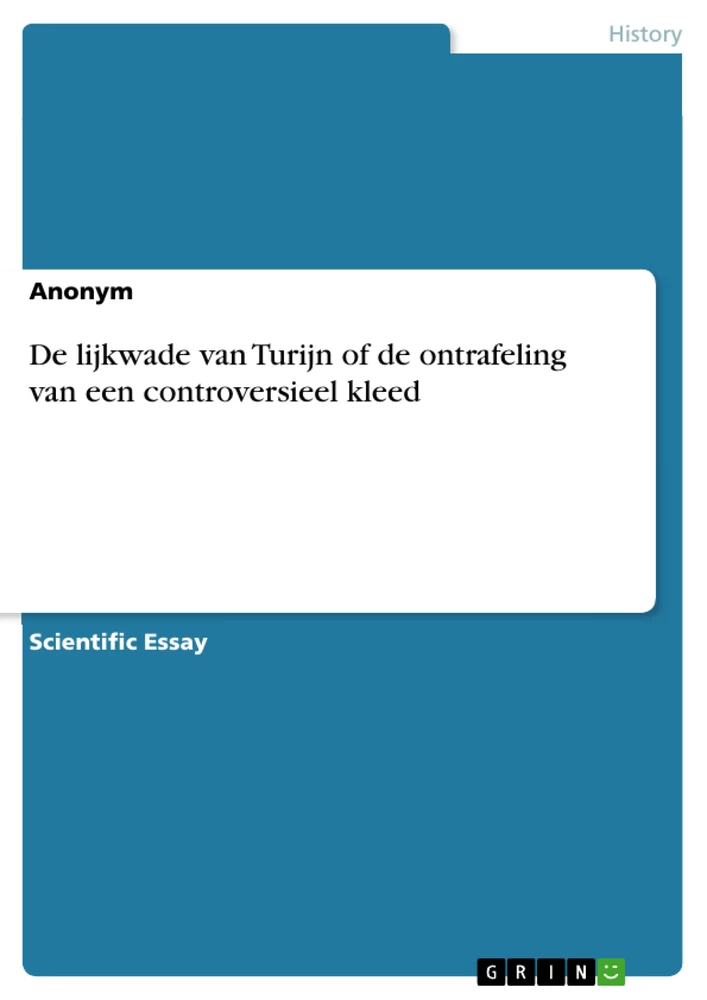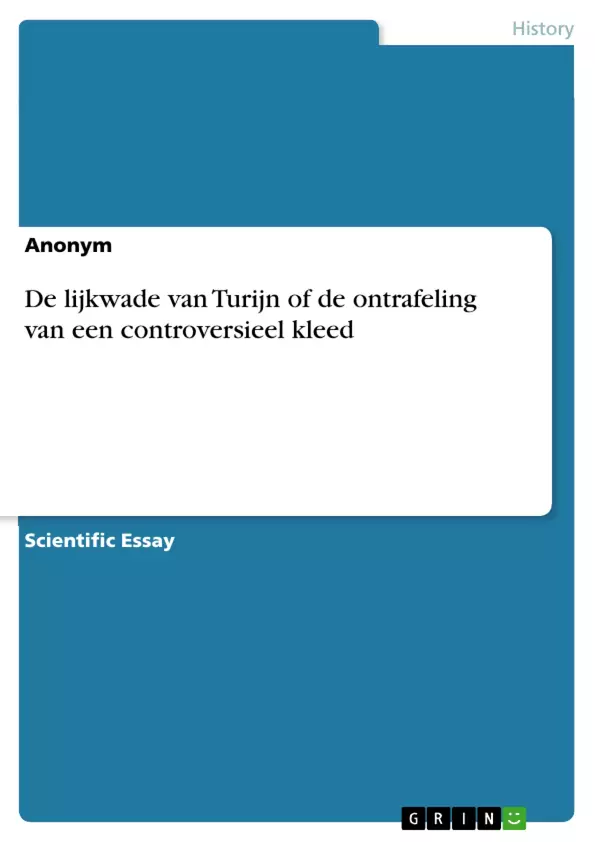Het Vaticaan heeft sinds 1983 een linnen kleed met daarop een vage afdruk van een man (zie afbeelding voorblad) in bezit, waarvan ook de geschiedenis erg vaag is. Dit kleed duikt als ‘lijkwade’ en relikwie van de Bijbelse Jezus voor het eerst op in 1390 in Lirey in Frankrijk, alhoewel er voor die tijd al wel toespelingen op een soortgelijk relikwie gemaakt zijn (Casabianca 3-4). Het werd door de bisschop van Lirey en zijn opvolger al als vervalsing bestempeld en de tentoonstelling ervan werd verboden. Volgens laatstgenoemde gaf de maker ervan toe het te hebben beschilderd (Meacham 286). Misschien dat de (wetenschappelijke) wereld niets meer van dit ‘relikwie’ had gehoord als er niet in 1898 met de toen nog recente fotografie een negatief van de afbeelding op het kleed werd gemaakt en bleek dat deze een dimensionele indruk (zoals dat van een bas-reliëf, Schwortz 5) gaf. Het realisme van de op deze manier ontstane ‘fotografische’ afbeelding was aanleiding om te beginnen met ‘sindonology’, zoals de interdisciplinaire bestudering van het kleed later is genoemd (Hernandez 3-4).
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einführung
- 1. Theoretisches Rahmen
- 2. Warum sorgt die C14-Datierung im Vergleich zur 14.-Jahrhundert-Ikonografie Jesu für ein inkonsistentes Bild der Forschungsdaten?
- 3. Wie widersprechen sich eine 14.-Jahrhundert-Datierung und eine spezifische Replikationsmethode des Tuches?
- 4. Was lehren uns die Probleme um Datierung und Replikation über die Methodik der "Sindonologie" und die Untersuchung komplexer Objekte?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Paper untersucht die Methodik der "Sindonologie" am Beispiel des Turiner Grabtuchs. Es analysiert die Inkonsistenzen zwischen den wissenschaftlichen Daten (insbesondere der C14-Datierung) und anderen Indizien, wie der mittelalterlichen Ikonografie und Replikationsversuchen. Ziel ist es, die Herausforderungen bei der Untersuchung komplexer Artefakte aufzuzeigen und Schlussfolgerungen für die Erforschung der mittelalterlichen Kultur zu ziehen.
- Die Inkonsistenzen zwischen der C14-Datierung und der mittelalterlichen Ikonografie Jesu.
- Der Widerspruch zwischen der mittelalterlichen Datierung und Replikationsversuchen des Grabtuchs.
- Die methodischen Herausforderungen der "Sindonologie" und die Untersuchung komplexer Objekte.
- Die Bedeutung der Ergebnisse für das Verständnis der mittelalterlichen Kultur.
- Die Problematik der Interpretation von wissenschaftlichen Daten im Kontext von religiösen Artefakten.
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einführung: Die Einführung stellt das Turiner Grabtuch vor, ein linnenes Tuch mit einer Abbildung eines Mannes, dessen Echtheit und Datierung seit Jahrhunderten kontrovers diskutiert werden. Die C14-Datierung von 1988 deutete auf eine mittelalterliche Herkunft hin, doch diese Ergebnisse werden aufgrund möglicher Kontamination der Proben in Frage gestellt. Das Paper untersucht die methodischen Herausforderungen der "Sindonologie" und deren Implikationen für das Verständnis mittelalterlicher Artefakte, indem es die Diskrepanzen zwischen der Datierung, der mittelalterlichen Ikonografie und Replikationsversuchen analysiert. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Was lehren uns die Datierung und Replikation des Tuches über die Methodik der Untersuchung komplexer Artefakte und unser Wissen über das Mittelalter?
1. Theoretisches Rahmen: Dieses Kapitel beleuchtet die zentralen Probleme bei der wissenschaftlichen Interpretation des Turiner Grabtuchs. Die größten Herausforderungen sind die Kontroversen um die Datierung aufgrund möglicher Kontamination der 1988 untersuchten Proben und das ungeklärte Entstehungsprozess der Abbildung. Es wird diskutiert, dass eine C14-Datierung allein nicht die Echtheitsfrage klärt und auch das Formatisierungsproblem nicht aufklärt. Die verschiedenen theoretischen Ansätze der Forscher werden vorgestellt, welche zeigen, dass ein einheitlicher theoretischer Rahmen fehlt. Das Kapitel legt den Fokus auf die Annahme einer mittelalterlichen Datierung aus dem Jahr 1988 und die daraus resultierende Notwendigkeit, die Entstehung der Abbildung im Mittelalter zu erklären. Die Annahme, dass die Abbildung auf dem Tuch tatsächlich Jesus Christus darstellt, wird ebenfalls berücksichtigt.
2. Warum sorgt die C14-Datierung im Vergleich zur 14.-Jahrhundert-Ikonografie Jesu für ein inkonsistentes Bild der Forschungsdaten?: Dieses Kapitel analysiert die Diskrepanzen zwischen der C14-Datierung (die auf eine mittelalterliche Entstehung hinweist) und der Ikonografie des 14. Jahrhunderts. Obwohl die mittelalterliche Datierung eine absichtliche Fälschung suggeriert, lassen sich die Details der Abbildung nicht mit der damaligen Ikonografie vereinbaren. Konkret werden die Darstellung der Wundmale an den Handgelenken anstatt an den Handflächen und die Form der Dornenkrone als inkonsistent mit der mittelalterlichen Kunsttradition herausgestellt. Diese Diskrepanzen werfen Zweifel an der Interpretation der C14-Datierung auf und verdeutlichen die Komplexität der Beweisführung bei der Untersuchung des Grabtuchs.
3. Wie widersprechen sich eine 14.-Jahrhundert-Datierung und eine spezifische Replikationsmethode des Tuches?: Dieses Kapitel befasst sich mit der "Proto-Fotografie"-Theorie von Professor Nicholas Allen, der versucht, die Abbildung auf dem Tuch mithilfe mittelalterlicher Techniken zu replizieren. Allens Replikationsversuch, trotz der Verwendung von Materialien, die im Mittelalter verfügbar waren, konnte nicht alle Eigenschaften der Originalabbildung reproduzieren und steht im Widerspruch zu den ursprünglichen Schlussfolgerungen seiner These. Die Unterschiede zwischen der Replika und dem Original bezüglich Lichtfallen und des Reliefs werden im Detail analysiert und die Grenzen dieser Replikationsmethode aufgezeigt. Das Kapitel argumentiert, dass für ein vollständiges Verständnis des Entstehungsprozesses eine vollständige Replikation aller Merkmale notwendig ist und auch ein anachronistisches Herangehen der zugrundeliegenden Theorie kritisiert.
4. Was lehren uns die Probleme um Datierung und Replikation über die Methodik der "Sindonologie" und die Untersuchung komplexer Objekte?: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die Methodik der "Sindonologie" und die Untersuchung komplexer Artefakte im Allgemeinen. Es wird betont, dass ein konsistentes Bild aller Forschungsdaten essentiell ist und die Herausforderungen bei der Interpretation multipler Datenquellen in einem solchen komplexen Fall hervorgehoben. Die Diskrepanzen zwischen verschiedenen Methoden und Interpretationsansätzen zeigen die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit und einer kritischen Bewertung aller vorliegenden Daten auf. Die Schlussfolgerungen für die Interpretation mittelalterlicher Artefakte werden angedeutet.
Schlüsselwörter
Turiner Grabtuch, C14-Datierung, Sindonologie, Mittelalterliche Ikonografie, Replikation, Bildentstehung, Methodologie, wissenschaftliche Kontroverse, Artefaktforschung, mittelalterliche Kultur.
Häufig gestellte Fragen zum Turiner Grabtuch
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Methodik der "Sindonologie" anhand des Turiner Grabtuchs. Sie untersucht die Inkonsistenzen zwischen wissenschaftlichen Daten (insbesondere der C14-Datierung), mittelalterlicher Ikonografie und Replikationsversuchen. Das Ziel ist es, die Herausforderungen bei der Untersuchung komplexer Artefakte aufzuzeigen und Schlussfolgerungen für die Erforschung der mittelalterlichen Kultur zu ziehen.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den Inkonsistenzen zwischen der C14-Datierung und der mittelalterlichen Ikonografie Jesu, dem Widerspruch zwischen der mittelalterlichen Datierung und Replikationsversuchen, den methodischen Herausforderungen der "Sindonologie" und der Untersuchung komplexer Objekte, der Bedeutung der Ergebnisse für das Verständnis der mittelalterlichen Kultur und der Problematik der Interpretation von wissenschaftlichen Daten im Kontext religiöser Artefakte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 0 (Einführung) stellt das Turiner Grabtuch und die Forschungsfrage vor. Kapitel 1 (Theoretischer Rahmen) beleuchtet die Herausforderungen bei der wissenschaftlichen Interpretation des Tuches. Kapitel 2 analysiert die Diskrepanzen zwischen der C14-Datierung und der mittelalterlichen Ikonografie. Kapitel 3 untersucht die Widersprüche zwischen der mittelalterlichen Datierung und spezifischen Replikationsmethoden. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die Methodik der "Sindonologie" und die Untersuchung komplexer Objekte.
Wie wird die C14-Datierung im Kontext der mittelalterlichen Ikonografie bewertet?
Die Arbeit zeigt Diskrepanzen zwischen der C14-Datierung (die auf eine mittelalterliche Herkunft hinweist) und der Ikonografie des 14. Jahrhunderts auf. Obwohl die mittelalterliche Datierung eine Fälschung nahelegt, passen Details der Abbildung nicht zur damaligen Ikonografie (z.B. Wundmale an den Handgelenken statt Handflächen). Diese Diskrepanzen werfen Zweifel an der alleinigen Interpretation der C14-Datierung auf.
Wie werden die Ergebnisse der Replikationsversuche bewertet?
Die Arbeit diskutiert die "Proto-Fotografie"-Theorie von Professor Nicholas Allen. Allens Replikationsversuch, obwohl mit mittelalterlichen Techniken durchgeführt, konnte nicht alle Eigenschaften der Originalabbildung reproduzieren. Die Unterschiede zwischen Replika und Original (Lichtfallen, Relief) werden analysiert, und die Grenzen dieser Replikationsmethode werden aufgezeigt. Ein vollständiges Verständnis des Entstehungsprozesses erfordert eine vollständige Replikation aller Merkmale.
Welche Schlussfolgerungen werden für die Methodik der "Sindonologie" gezogen?
Die Arbeit betont die Notwendigkeit eines konsistenten Bildes aller Forschungsdaten. Die Diskrepanzen zwischen verschiedenen Methoden und Interpretationen unterstreichen die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit und kritischer Datenbewertung. Die Herausforderungen bei der Interpretation multipler Datenquellen in komplexen Fällen werden hervorgehoben. Schlussfolgerungen für die Interpretation mittelalterlicher Artefakte werden angedeutet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die Schlüsselwörter sind: Turiner Grabtuch, C14-Datierung, Sindonologie, Mittelalterliche Ikonografie, Replikation, Bildentstehung, Methodologie, wissenschaftliche Kontroverse, Artefaktforschung, mittelalterliche Kultur.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, De lijkwade van Turijn of de ontrafeling van een controversieel kleed, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1041903