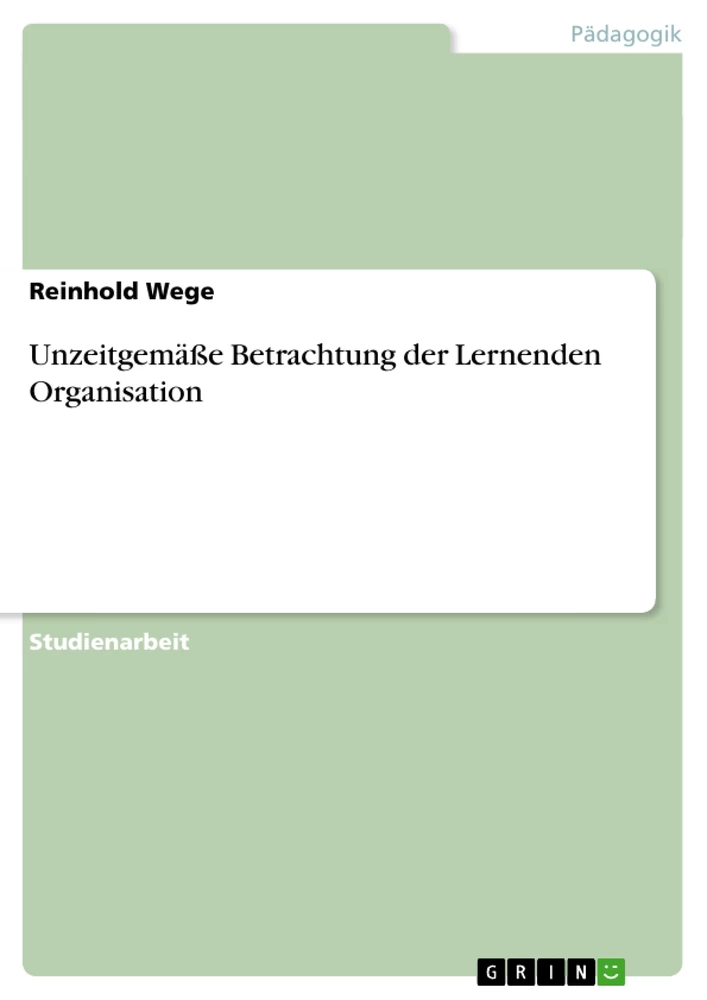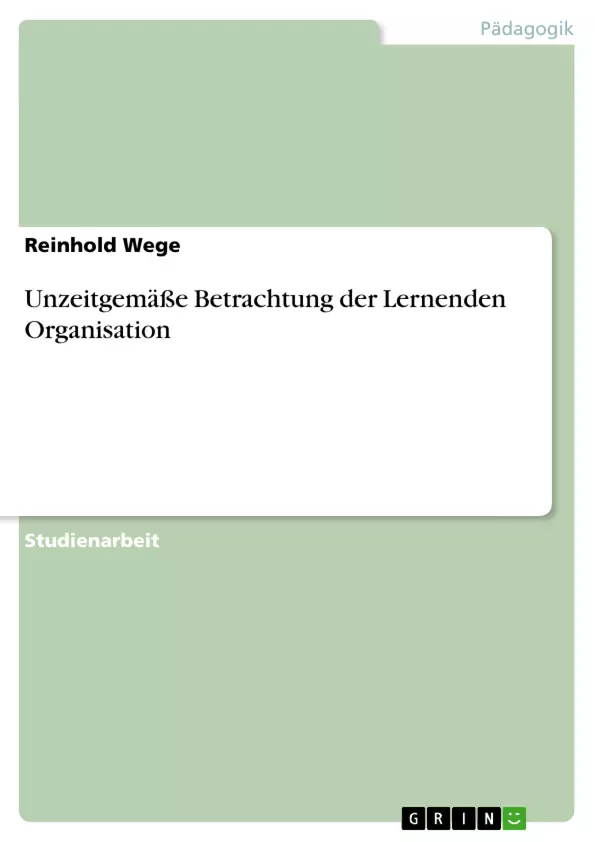Unzeitgemäße Betrachtung der Lernenden Organisation: Industrialisierung und Postmoderne - Zur Aktualität der Philosophie Nietzsches
Die „Lernende Organisation“ ist derzeit das Schlagwort in Wirtschaft und Industrie, von dem sich Theoretiker und Praktiker gleichermaßen ein „perpetuum mobile“ der Organisationsentwicklung erhoffen. Dieser Begriff vereint die doch sonst recht antagonistischen Parteien mit einer ganz besonderen Gemeinsamkeit: niemand weiß genau, was diese „Lernende Organisation“ eigentlich ist.
Und gerade diese Unbestimmtheit macht die Lernende Organisation so attraktiv, da jeder dem Begriff genau die Definition geben kann, die für ihn selbst als nützlich erscheint. Dadurch bläht sich nicht nur die begriffliche Verwendung erstaunlich auf, sondern auch die Menschen, die mit einer solchen „Stopfgans“ in Verbindung kommen, werden zu Erwartungsträgern mit undefinierten Erwartungen. Die Hast und Eile der heutigen Zeit sorgt letztlich dafür, daß die lernende Organisation bereits zum standardisierten Unternehmenskonzept wird, für das man sich auszeichnen lassen kann - man lebt und verwendet Begrifflichkeiten, ohne ihre Bedeutungen und Inhalte zu kennen, geschweige denn verstanden zu haben.
Die Notwendigkeit zum schnelleren Lernen als die Konkurrenz, wird als der Wettbewerbsfaktor schlechthin betrachtet. Die Folge davon ist, daß Lernen nur noch unter einer Verwertungsabsicht stattfindet und somit Qualifikation streng von Bildung trennt - denn Bildung braucht Zeit. Zeit hat man keine, aber Geld braucht man und ökonomisch ist es bekanntlich in wenig Zeit, mit wenig Aufwand viel Geld zu bekommen. Für genaue Definitionen neuer Begriffe braucht es ebenfalls Zeit, für deren Verstehen erst recht. Weil aber diese Zeit nicht aufgebracht wird, verkümmert das Individuum dadurch zum homo ökonomicus mit Halbwissen und Halbbildung. Denn Verstehen und Bildung sind dann nur insofern interessant, wie sie der ökonomischen Verwertung neuer Sachverhalte dienlich sind. Wenn man den Begriff der Lernenden Organisation aus systemischer Perspektive betrachtet (und dies ist notwendig!), muß man zugestehen, daß das Verstehen der Prozesse innerhalb sozialer Systeme durchaus komplex und somit nicht einfach, geschweige denn schnell zu verstehen ist. Und weiter:
Wenn man den Begriff der Lernenden Organisation aus systemischer Perspektive betrachtet und dazu das Paradigma der Autopoiesis zugrunde legt und somit soziale Systeme als selbstreferentiell beschreibt, dann muß man zwangsweise zu dem Schluß kommen, daß lernende soziale Systeme umfassender betrachtet werden können, als nur eine Kleingruppe, ein Qualitätszirkel oder eine Organisation (Betrieb, Unternehmen). Dies müßte in Zusammenhang mit psychologischen Lerntheorien zu einer weitaus differenzierten Verwendung des Begriffs führen, als dies bisher der Fall ist. Dann erst dürften daraus Handlungsoptionen abgeleitet werden. Bei dem hier vorliegendem Problem ist das jedoch anders: da werden Handlungsanweisungen, Handlungsoptionen, Handlungsziele und -inhalte entwickelt, bevor ein eindeutiger Hintergrund dafür entworfen wurde, bevor potentielle Resultate abgewägt wurden und vor allem bevor genaue Strukturen überhaupt bekannt waren, die einem solch umfassenden Konzept, wie es die Lernende Organisation darstellt, gerecht werden.
Das dabei am schwersten wiegende Problem liegt im ganzheitlichen Zugriff auf den Menschen, der, sowohl durch betriebswirtschaftliche, als auch psychologische und pädagogische Methoden vereinnahmt wird. Besonders pädagogische und psychologische Theorien verarmen dabei nicht selten zu einem Technologielieferanten für wirtschaftliche Verwendungszwecke. Fragen, die das Individuum betreffen gehen dabei weitestgehend verloren; etwa: Wie wirken sich systemische Ansätze auf das Subjekt aus? Inwiefern beeinflussen neue Methoden die Identität des Subjekts (und dies nicht nur im positivem Sinne)? Wo liegen wirkliche Freiräume für (Persönlichkeits-) Bildung? Kann sich das Individuum bei einem ganzheitlichen Zugriff noch gegen unerwünschte Erwartungshaltungen wehren? Usw.
Ist dies das Schicksal der Modernisierung?
Bereits Nietzsche spricht von der schwindelnden Hast seines rollenden Zeitalters und von dem götzendienerischen Vergnügen, von deren Rädern zermalmt zu werden. Er spricht von der Bildung zugunsten der finanziellen Verwertung: „Hier haben wir den Nutzen als Ziel und Zweck der Bildung, noch genauer den Erwerb, den möglichst großen Geldgewinn.“ Und weiter: „Jede Bildung ist hier verhaßt, ... die über Geld und Erwerb hinaus Ziele steckt, die viel Zeit verbraucht.“ Nietzsches Kritik an der „zermalmenden Walze dieser Pseudo-Bildung“ ist also durchaus aktuell, denn das Zeitalter der Industrialisierung läßt sich durchaus mit unserer heutigen (Post-) Moderne vergleichen.
Die Tatsache, das Bildung unter dem Zweck der ökonomischen Verwertung und nicht der Bildung halber betrieben wird ist scheinbar ein alter Hut. Und gerade das ist es was uns (Pädagogen) stutzig machen sollte, oder ist die Pädagogik bereits auch auf diesen (schnellen) Zug der Lernenden Organisation aufgesprungen? Kann man etwa heute, wie damals behaupten: „Man mache sich nur einmal mit der pädagogischen Litteratur dieser Gegenwart vertraut; an dem ist nichts zu verderben, der bei diesem Studium nicht über die allerhöchste Geistesarmut und über einen wahrhaft täppischen Cirkeltanz erschrickt“?
Wahrlich vollführt die Pädagogik einen „Cirkeltanz“! Die Vereinbarung der Bildung mit dem ökonomischen Prinzip scheint seit jeher eine ungeklärte Frage der Pädagogik zu sein, die aber in unterschiedlichen Phasen durchaus unterschiedlich betrachtet wird. Vergleiche man nur die Anstrengungen zur Antithetik HUMBOLTDS, die zur Zeit Nietzsches wieder verlorengegangen scheinen und später über KERSCHENSTEINER hinaus von SPRANGER gänzlich aufzuheben versucht, dann aber in der „reflexiven Wende“ der 70er Jahre wiederholt hervorgerufen werden, um heute erneut wieder verloren zu gehen. „Wer wird euch zur Heimat der Bildung führen, wenn eure Führer blind sind und gar noch als sehende sich ausgeben!“
Vor diesem, doch recht kurz umrissenen Hintergrund, müssen folgende Thesen genauer analysiert und diskutiert werden:
These 1: Die Lernende Organisation ist das Kind der Modernisierung und das Enkelkind der Industrialisierung. Von der Industrialisierung bis heute haben sich gesamtgesellschaftlich ökonomische Tendenzen nicht verändert, sondern nur beschleunigt. Was sich aber ständig ändert (bzw. zirkuliert, s.o.) ist die Pädagogik und deren Vorstellung und Anforderung an Bildung. Nietzsches Betrachtung und Kritik seiner Zeit haben folglich gerade heute ihre Gültigkeit1.
These 2: Um eine Lernende Organisation als System zu betrachten ist die Unterscheidung von System und Umwelt unabdingbar. So müssen Systeme samt ihrer Umwelt beobachtet und beschrieben werden, welche ebenfalls aus Systemen besteht, die als selbstreferentiell und autopoietisch beschrieben werden müssen. Der nächste Schritt muß folglich aus der Klärung der jeweiligen Intersystembeziehungen bestehen. Nur so kann gezeigt werden, wie sich Bildungssystem und Wirtschaftssystem aufeinander beziehen, denn zunächst erscheint eine Intersystembeziehung von Bildungssystem und Wirtschaftssystem als Einheit paradox2. Dabei muß die Kritik Nietzsches erweitert werden: bezieht sich Nietzsches Bildungskritik noch vorwiegend auf die Schulbildung (vor allem dem Gymnasium), so ist dies vor dem Hintergrund zu verstehen, daß zu seiner Zeit der Schul- oder auch Studienabschluß noch als Lernabschluß betrachtet wurde. Heutzutage jedoch entläßt Schule und Universität das Individuum nur ins sog. „lebenslange Lernen“. Der Schulabschluß gilt als Teilnahmebedingung und Startschuß zur beruflichen (Weiter-) Bildung. Dort sind letztendlich die modernen Bildungsphilister zu finden.
These 3: Pädagogik und Psychologie werden durch den schnellen Wandel der Moderne mitgerissen, so daß auch diese Wissenschaften immer mehr unter dem Aspekt arbeiten, Theorien zu schaffen, deren wirtschaftlicher Nutzen meßbar ist. Dies führt nicht nur zur einer Abhängigkeit jener Wissenschaften, sondern leitet auch die Zielgruppen pädagogischen und psychologischen Handelns immer mehr zu einem utilitaristischen Verwertungsinteresse an. Nach Nietzsche führt die zu „couranten“ Menschen, „ebenso, wie eine Münze courant ist“, d.h. die Bildung des Menschen entspricht lediglich dem materiellem Verwendungszweck; nicht mehr, vielleicht aber weniger. Evaluation und Erfolgskontrollen bestimmen pädagogisches Handeln. Zwar müssen sich ökonomische und pädagogische Ziele nicht zwangsläufig voneinander unterscheiden, aber die Ziele pädagogischen Handelns dürfen nicht unter einem verdinglichten Interesse stehen. Bildung kann Qualifikation bedeuten, aber nicht umgekehrt.
Gegen pädagogische Arbeit in Betrieben unter dem Prinzip der ökonomischen Verwertung ist grundsätzlich nichts einzuwenden (schon gar nicht aus der Sicht der Betriebe), aber die Pädagogik als Wissenschaft muß unabhängig von fremdgesetzten Zielen existieren. D.h. als System muß die Pädagogik ihre Referenzgrundlage in sich selbst tragen - sonst kann die Pädagogik nicht als eigenes System betrachtet werden!
SCHORR, K.E., Zwischen System und Umwelt. Fragen ab die Pädagogik. Frankfurt am Main 1996.
[...]
1 Keine Gültigkeit hat Nietzsche mit seiner Forderung einmal Student gewesen sein zu müssen, um auch die Ruhe der Zeit und deren Wert schätzen zu lernen. Denn er beschreibt den Zustand eines Studenten als „einen Zustand, der, in der rastlosen und heftigen Bewegung der Gegenwart, geradezu etwas Unglaubwürdiges ist, und den man erlebt haben muß, um ein solches unbekümmertes Sich-Wiegen, ein solches dem Augenblick abgerungenes gleichsam zeitloses Behagen überhaupt für möglich zu halten.“ - Nietzsche kannte noch keine Bundeswehruniversität!
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Unzeitgemäße Betrachtung der Lernenden Organisation: Industrialisierung und Postmoderne - Zur Aktualität der Philosophie Nietzsches"?
Der Text befasst sich kritisch mit dem Konzept der "Lernenden Organisation" im Kontext von Industrialisierung und Postmoderne, wobei die Philosophie Friedrich Nietzsches als relevanter Bezugspunkt herangezogen wird. Er hinterfragt die Verwertungsabsicht des Lernens und die Vernachlässigung von Bildung im Streben nach schnellem ökonomischem Nutzen.
Was kritisiert der Text an der "Lernenden Organisation"?
Der Text kritisiert die Unbestimmtheit des Begriffs, die zu undefinierten Erwartungen führt, die Standardisierung des Konzepts ohne tiefes Verständnis, die Trennung von Qualifikation und Bildung und die Instrumentalisierung pädagogischer und psychologischer Theorien für wirtschaftliche Zwecke. Der ganzheitliche Zugriff auf den Menschen und die möglichen negativen Auswirkungen auf die Identität des Subjekts werden ebenfalls bemängelt.
Welche Rolle spielt Nietzsche in der Argumentation des Textes?
Nietzsches Kritik an der Bildung zugunsten der finanziellen Verwertung und an der "zermalmenden Walze dieser Pseudo-Bildung" wird als hochaktuell dargestellt. Seine Beobachtungen über die schwindelnde Hast der Zeit und die Götzenanbetung des Fortschritts werden auf die heutige (Post-)Moderne übertragen.
Welche Thesen werden im Text aufgestellt?
Es werden drei Hauptthesen formuliert: 1. Die Lernende Organisation als Kind der Modernisierung und Enkelkind der Industrialisierung, wobei sich ökonomische Tendenzen beschleunigt haben, während pädagogische Vorstellungen zirkulieren. 2. Die Notwendigkeit der Unterscheidung von System und Umwelt zur Betrachtung der Lernenden Organisation als System, einschließlich der Intersystembeziehungen zwischen Bildungs- und Wirtschaftssystem. 3. Die Tendenz, dass Pädagogik und Psychologie sich immer mehr an wirtschaftlichem Nutzen orientieren, was zu einer Abhängigkeit dieser Wissenschaften und einer utilitaristischen Verwertungsinteresse der Zielgruppen führt.
Was wird bezüglich Pädagogik und ihrer Rolle in der "Lernenden Organisation" kritisiert?
Der Text kritisiert die Gefahr, dass pädagogische Theorien zu bloßen Werkzeugen für wirtschaftliche Zwecke verkommen und dass pädagogische Arbeit primär unter dem Prinzip der ökonomischen Verwertung stattfindet. Es wird gefordert, dass die Pädagogik als Wissenschaft unabhängig von fremdgesetzten Zielen existieren und ihre Referenzgrundlage in sich selbst tragen muss.
Was wird zur Beziehung zwischen Bildungssystem und Wirtschaftssystem gesagt?
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Intersystembeziehung zwischen Bildungssystem und Wirtschaftssystem zunächst als Einheit paradox erscheint. Die Analyse dieser Beziehung und die Klärung, wie sich beide Systeme aufeinander beziehen, wird als notwendig erachtet.
Welche Forderung wird an die Pädagogik gestellt?
Die Pädagogik müsse unabhängig von wirtschaftlichen Interessen agieren und ihre Autonomie wahren. Nur so könne die Pädagogik ihren eigentlichen Zweck, die Bildung des Menschen, erfüllen.
- Arbeit zitieren
- Reinhold Wege (Autor:in), 2001, Unzeitgemäße Betrachtung der Lernenden Organisation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104226