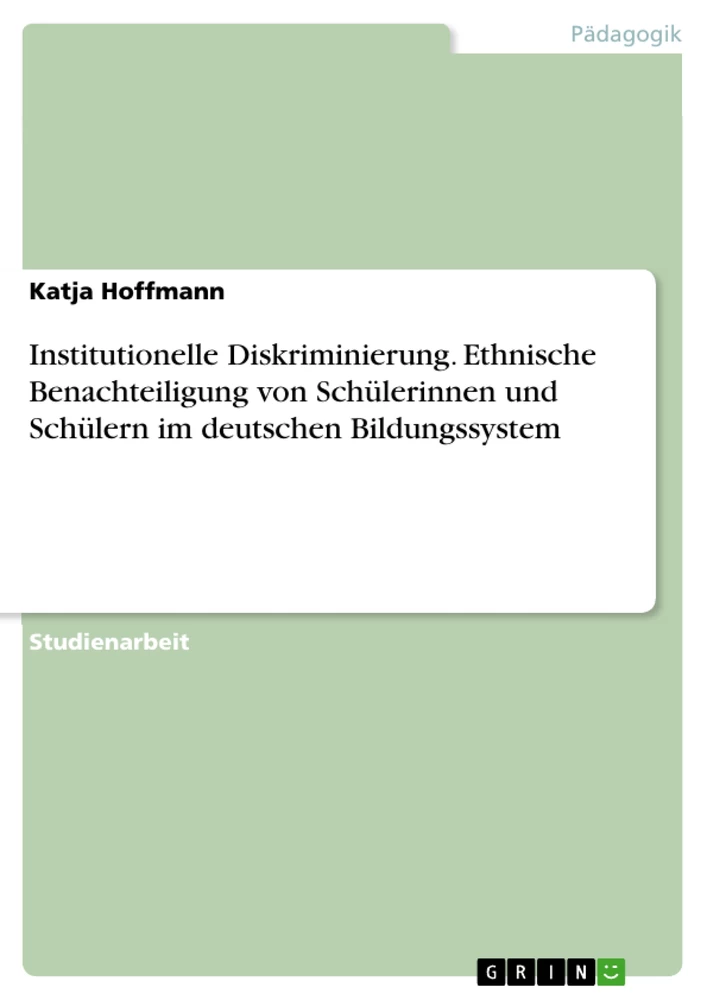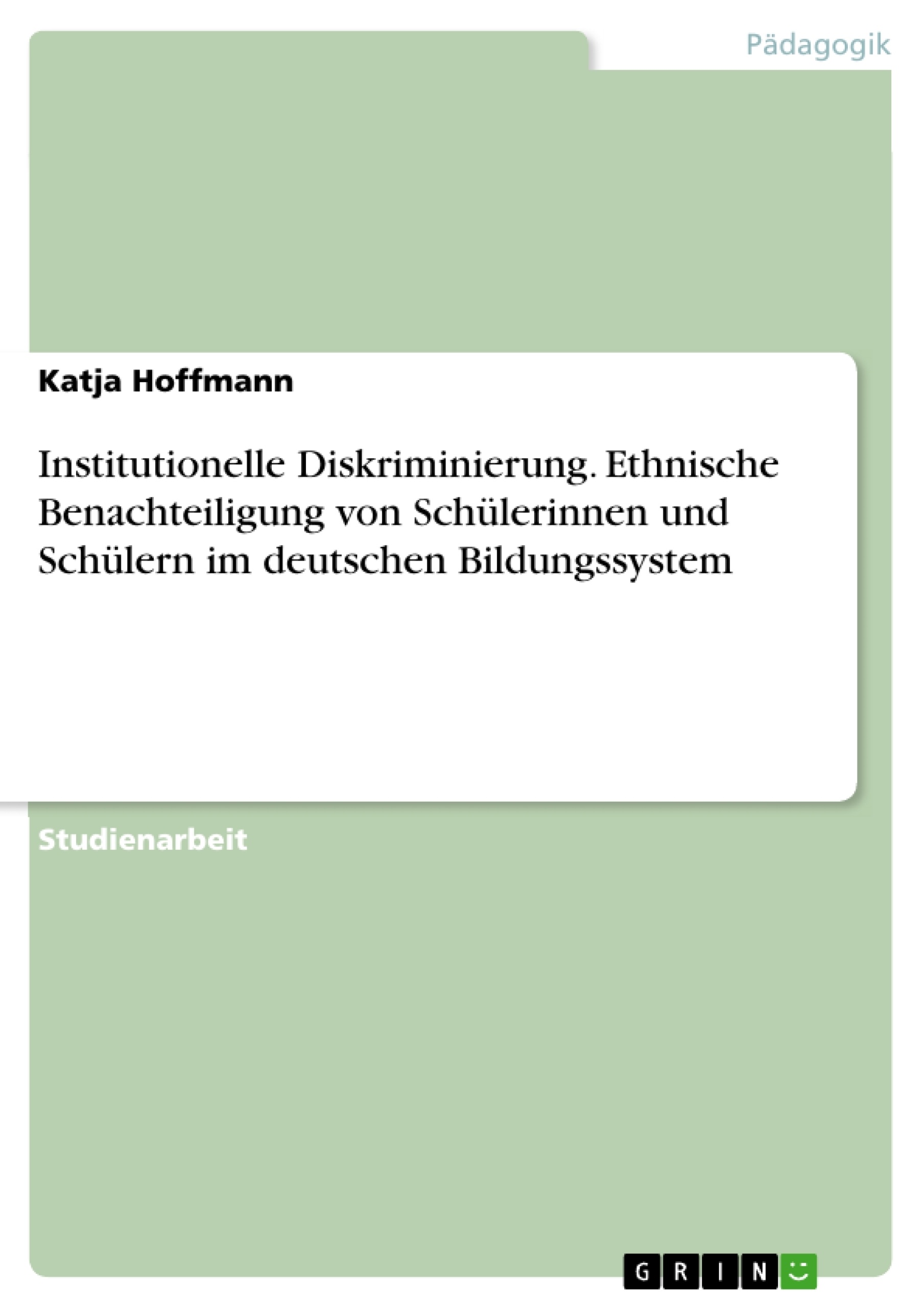Um eine übersichtliche Aufteilung zu gewährleisten, wurde die Arbeit in drei Themenbereiche unterteilt. Zunächst werden Formen von Diskriminierung erläutert. Dazu wird der Begriff der Diskriminierung definiert und anschließend verschiedene Arten von Benachteiligungen dargestellt. Zum Abschluss des Themenbereiches wird der Begriff der institutionellen Diskriminierung als bedeutend für den weiteren Verlauf der Arbeit hervorgehoben und erklärt. An späterer Stelle wird sie im zweiten Bereich in Hinblick auf das deutsche Bildungssystem aufgezeigt. Dazu werden zunächst die Bedeutung von Bildung und die daraus resultierenden Chancen dargestellt, und folgend erläutert, wie diese durch institutionelle Diskriminierung nicht jedem Schüler beziehungsweise jeder Schülerin zugänglich gemacht wird. Daraufhin folgt ein Ausblick, welcher Maßnahmen gegen Ungleichbehandlung darstellen soll. Zum Abschluss wird ein Fazit der Arbeit vorgenommen, welches sich mit den vorhergegangenen Schritten befasst und diese kritisch reflektiert.
Diskriminierung geschieht zwischen vielerlei Gruppen: Frauen und Männern, Heterosexuellen und Homosexuellen, Behinderten und Nicht-Behinderten, Deutschen und Ausländern, ethnischen Gruppen und Religionen. Die große Gemeinsamkeit jedoch ist, dass Unterscheidungen, welche Unterschiede behaupten, sich in Ungleichheiten verwandeln, welche Benachteiligungen ermöglichen und rechtfertigen sollen und so zu Diskriminierung führen. Dadurch wird der Mensch nicht nur kategorisiert und mit negativ bewerteten Eigenschaften behaftet, ihm wird vielmehr sogar sein Status eines vollwertigen und gleichberechtigten Mitmenschen bestritten.
Ausgehend von dem Referat „Gesellschaftliche Strukturen: Privilegien, Diskriminierung und Vorurteile“ mit dem Fokus auf der Thematik der Diskriminierung und Antidiskriminierung, stellte sich die Frage, wie ethnische Diskriminierung im institutionellen Rahmen des deutschen Bildungssystems aussieht, und welche Gegenmaßnahmen unternommen werden können, um dieser Form der Diskriminierung entgegenzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Formen von Diskriminierung
- 2.1 Diskriminierung
- 2.2 Arten von Diskriminierung - Ursachen und Folgen
- 2.3 Institutionelle Diskriminierung
- 3. Diskriminierung im dt. Bildungssystem
- 3.1 Institutionelle Diskriminierung in der Schule
- 3.1.1 Mechanismen indirekter Diskriminierung
- 3.1.2 Bildungsübergänge und schulische Selektion
- 4. Ausblick
- 4.1 Maßnahmen gegen (institutionelle) Diskriminierung
- 4.2 Diskriminierungsverbot
- 5. Fazit/Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der ethnischen Diskriminierung im deutschen Bildungssystem und analysiert die Herausforderungen, die diese Form der Benachteiligung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund darstellt. Ziel ist es, die institutionellen Strukturen aufzuzeigen, die zu einer Ungleichbehandlung führen, und Möglichkeiten zur Bekämpfung der Diskriminierung zu diskutieren.
- Definition und Formen von Diskriminierung
- Institutionelle Diskriminierung im Bildungssystem
- Mechanismen indirekter Diskriminierung in Schulen
- Bildungsübergänge und schulische Selektion
- Maßnahmen gegen Diskriminierung im Bildungsbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Diskriminierung ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext des deutschen Bildungssystems dar. Das zweite Kapitel widmet sich verschiedenen Formen der Diskriminierung, einschließlich der Definition des Begriffs und der Darstellung verschiedener Arten von Ungleichbehandlung. Das dritte Kapitel untersucht die Auswirkungen von Diskriminierung auf das deutsche Bildungssystem und beleuchtet die institutionellen Mechanismen, die zu einer Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund führen.
Schlüsselwörter
Institutionelle Diskriminierung, ethnische Benachteiligung, Bildungssystem, Migrationshintergrund, indirekte Diskriminierung, Bildungsübergänge, schulische Selektion, Antidiskriminierungsmaßnahmen.
- Citation du texte
- Katja Hoffmann (Auteur), 2018, Institutionelle Diskriminierung. Ethnische Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern im deutschen Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043180