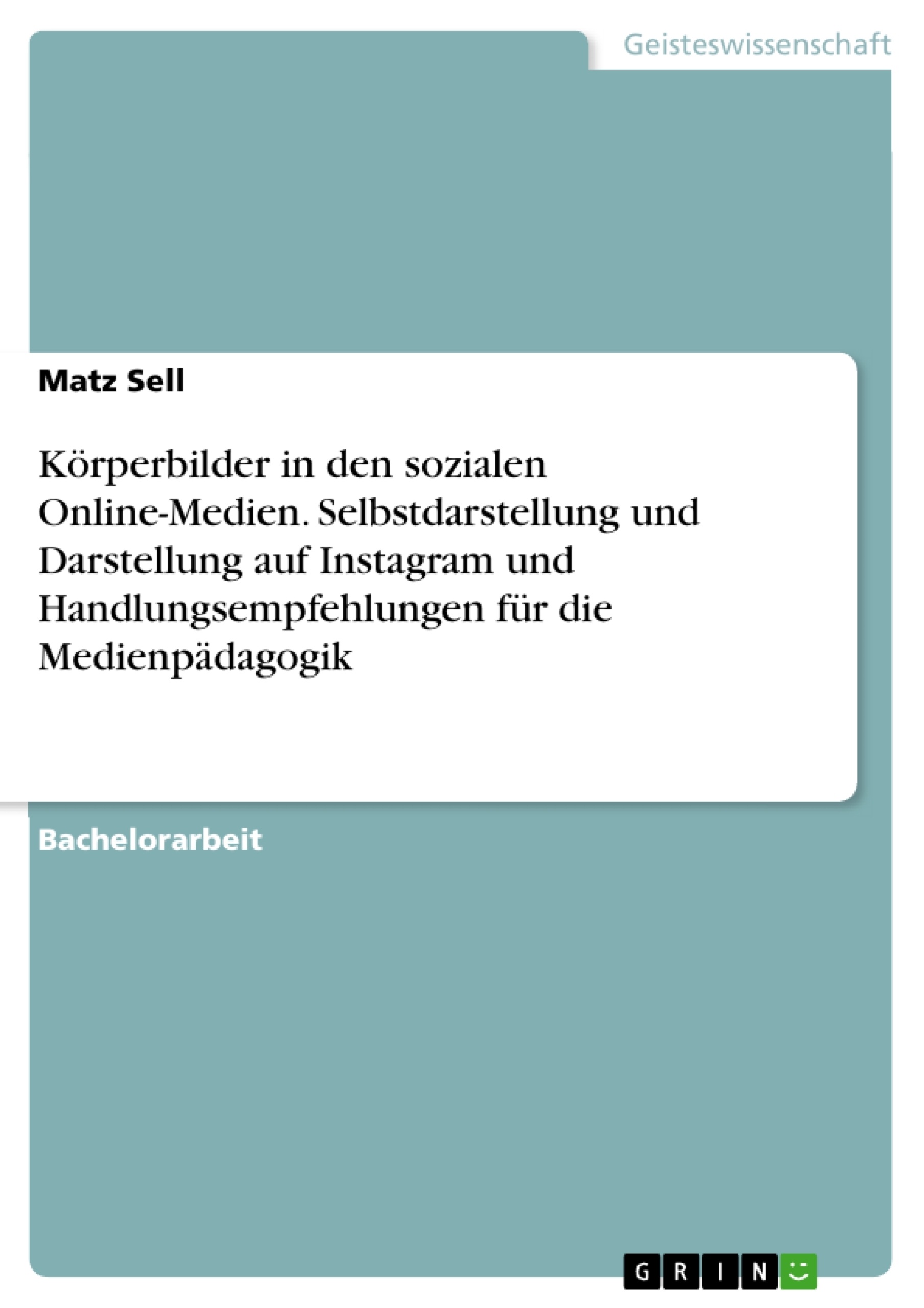Soziale Online-Netzwerke haben eine enorme Relevanz im täglichen Leben der meisten Menschen in Deutschland. Für die jüngeren Altersgruppen ist es zu einem normalen Bestandteil des Alltags geworden. Vor allem in den jüngeren Generationen spielt dabei das Bildhandeln eine große Rolle. So präsentieren sich Jugendliche immer häufiger online auf Fotografien der Öffentlichkeit oder zumindest einem begrenzten Netzwerk an eigenen Online-Kontakten. Dabei zeigt sich, dass vor allem die Auseinandersetzung mit der weiblichen Körperästhetik und Körperinszenierung in der gegenwärtigen Diskussion eine hohe Relevanz hat.
Vor diesem Hintergrund unternimmt die vorliegende Arbeit den Versuch, die Darstellung und Selbstdarstellung von Körperbildern in sozialen Medien zu untersuchen und zu fragen, wie Medienpädagogik auf die Herausforderungen für die Rezipient*innen sowie mögliche Gefahren reagieren kann. Dafür werden aktuelle Befunde zur Mediennutzung und Medienwirkung, speziell also die Darstellung und Selbstdarstellung von Körperbildern in den sozialen Online-Netzwerken, analysiert.
Im Mittelpunkt der Analyse steht dabei die Untersuchung des Online-Handelns von drei beispielhaften Profilen im sozialen Online-Netzwerk Instagram. Besonders zu beachten ist hier der Umstand, dass das Thema Selbstdarstellung im Internet, wie im Laufe der Arbeit deutlich werden wird, eng verknüpft ist mit den Themen Selbstoptimierung sowie einem objektivierenden Blick auf den eigenen Körper, über den sich der Mensch in nonverbaler Kommunikation nach außen präsentiert. Daher werden die beiden letztgenannten Aspekte auch Eingang in die Arbeit finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmung
- 2.1 Social Media
- 2.2 Sozialisation und Mediensozialisation
- 2.3 Identität und Körperbild
- 2.4 Schönheitsideale
- 2.6 (Self-)Objectification
- 3. Selbstdarstellung und Darstellung in den sozialen Medien
- 3.1 Vergleichsprozesse in sozialen Netzwerken
- 3.2 Beispiel 1: Pamela Reif
- 3.3 Beispiel 2: Caroline Einhoff
- 3.4 Beispiel 3: Lisa und Lena
- 3.5 Zwischenfazit
- 4. Medienkompetenz als Aufgabenfeld der Sozialen Arbeit
- 4.1 Medienpädagogische Ansätze nach Süss et al.
- 4.2 Visual Literacy
- 4.3 Selbstzufriedenheit lernen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Darstellung und Selbstdarstellung von Körperbildern in sozialen Medien, insbesondere auf Instagram. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und möglichen Gefahren für die Nutzer*innen und entwickelt Handlungsempfehlungen für die Medienpädagogik. Im Mittelpunkt steht die Analyse von drei exemplarischen Instagram-Profilen mit hoher Reichweite.
- Selbstdarstellung und Identitätsbildung in sozialen Medien
- Einfluss von Schönheitsidealen und (Self-)Objektifizierung
- Vergleichsprozesse und deren Auswirkungen auf das Körperbild
- Rollen der Mediensozialisation und Medienpädagogik
- Handlungsempfehlungen für die Medienpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die hohe Relevanz des Internets im täglichen Leben, insbesondere für jüngere Generationen. Sie hebt die zunehmende Bedeutung von Bildhandeln und der weiblichen Körperästhetik in Online-Medien hervor und führt in die Forschungsfrage ein: Wie kann die Medienpädagogik auf die Herausforderungen und Gefahren der Körperdarstellung in sozialen Medien reagieren? Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Begriffsbestimmungen, Analyse von Instagram-Profilen und Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit.
2. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel liefert grundlegende Begriffsbestimmungen zu Social Media, Sozialisation, Identität, Körperbild und Schönheitsidealen, sowie (Self-)Objektifizierung. Es diskutiert verschiedene sozialisationstheoretische Perspektiven und den Einfluss von Medien auf die Identitätsgenese. Die Kapitel analysieren die Ambivalenzen von Selbstdarstellung im Internet, den "männlichen Blick" und die Selbstoptimierung, wobei die offenen und in der Wissenschaft stark diskutierten Begrifflichkeiten im Mittelpunkt stehen.
3. Selbstdarstellung und Darstellung in den sozialen Medien: Dieses Kapitel analysiert die Selbstdarstellung von Körperbildern in sozialen Medien, insbesondere die Funktionsweisen und die Wirkung medialer Selbstsozialisation und -darstellung. Es untersucht Vergleichsprozesse in sozialen Netzwerken und analysiert exemplarisch drei Instagram-Profile mit hoher Reichweite (Pamela Reif, Caroline Einhoff, Lisa und Lena), um die Inszenierung und Positionierung von Körperbildern zu untersuchen und die Frage zu beantworten, inwiefern Jugendliche, insbesondere Mädchen und junge Frauen, die verfügbaren Fotografien zur Identitätsbildung nutzen.
4. Medienkompetenz als Aufgabenfeld der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Medienkompetenz als zentrales Ziel medienpädagogischer Bemühungen. Es definiert Medienkompetenz anhand verschiedener Dimensionen (Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung) und stellt medienpädagogische Ansätze nach Süss et al. vor (Bewahren, Reparieren, Aufklären, Reflektieren, Handeln). Besondere Aufmerksamkeit wird der Visual Literacy und der Förderung von Selbstzufriedenheit gewidmet.
Schlüsselwörter
Körperbild, Social Media, Instagram, Selbstdarstellung, Identität, Mediensozialisation, Schönheitsideale, (Self-)Objektifizierung, Medienkompetenz, Medienpädagogik, Visual Literacy, Selbstzufriedenheit, Vergleichsprozesse, Influencer, Gender, Selbstoptimierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Körperbilder in sozialen Medien
Was ist der Gegenstand der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Darstellung und Selbstdarstellung von Körperbildern in sozialen Medien, insbesondere auf Instagram. Sie analysiert die Herausforderungen und möglichen Gefahren für die Nutzer*innen und entwickelt Handlungsempfehlungen für die Medienpädagogik. Im Mittelpunkt steht die Analyse von drei exemplarischen Instagram-Profilen mit hoher Reichweite (Pamela Reif, Caroline Einhoff, Lisa und Lena).
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Selbstdarstellung und Identitätsbildung in sozialen Medien, Einfluss von Schönheitsidealen und (Self-)Objektifizierung, Vergleichsprozesse und deren Auswirkungen auf das Körperbild, Rollen der Mediensozialisation und Medienpädagogik sowie Handlungsempfehlungen für die Medienpädagogik.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit liefert grundlegende Begriffsbestimmungen zu Social Media, Sozialisation, Identität, Körperbild, Schönheitsidealen und (Self-)Objektifizierung. Es werden verschiedene sozialisationstheoretische Perspektiven und der Einfluss von Medien auf die Identitätsgenese diskutiert.
Wie wird die Selbstdarstellung in sozialen Medien analysiert?
Die Arbeit analysiert die Selbstdarstellung von Körperbildern in sozialen Medien anhand von drei Instagram-Profilen mit hoher Reichweite. Es wird untersucht, wie die Inszenierung und Positionierung von Körperbildern funktioniert und wie Jugendliche, insbesondere Mädchen und junge Frauen, die verfügbaren Fotografien zur Identitätsbildung nutzen. Vergleichsprozesse in sozialen Netzwerken werden ebenfalls untersucht.
Welche Rolle spielt die Medienpädagogik?
Die Arbeit betrachtet die Medienkompetenz als zentrales Ziel medienpädagogischer Bemühungen. Es werden medienpädagogische Ansätze nach Süss et al. vorgestellt (Bewahren, Reparieren, Aufklären, Reflektieren, Handeln). Besondere Aufmerksamkeit wird der Visual Literacy und der Förderung von Selbstzufriedenheit gewidmet. Die Arbeit entwickelt Handlungsempfehlungen für die Medienpädagogik im Umgang mit den Herausforderungen der Körperdarstellung in sozialen Medien.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Körperbild, Social Media, Instagram, Selbstdarstellung, Identität, Mediensozialisation, Schönheitsideale, (Self-)Objektifizierung, Medienkompetenz, Medienpädagogik, Visual Literacy, Selbstzufriedenheit, Vergleichsprozesse, Influencer, Gender, Selbstoptimierung.
Welche Forschungsfrage wird beantwortet?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie kann die Medienpädagogik auf die Herausforderungen und Gefahren der Körperdarstellung in sozialen Medien reagieren?
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung, Selbstdarstellung und Darstellung in den sozialen Medien, Medienkompetenz als Aufgabenfeld der Sozialen Arbeit und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
- Citar trabajo
- Matz Sell (Autor), 2018, Körperbilder in den sozialen Online-Medien. Selbstdarstellung und Darstellung auf Instagram und Handlungsempfehlungen für die Medienpädagogik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043491