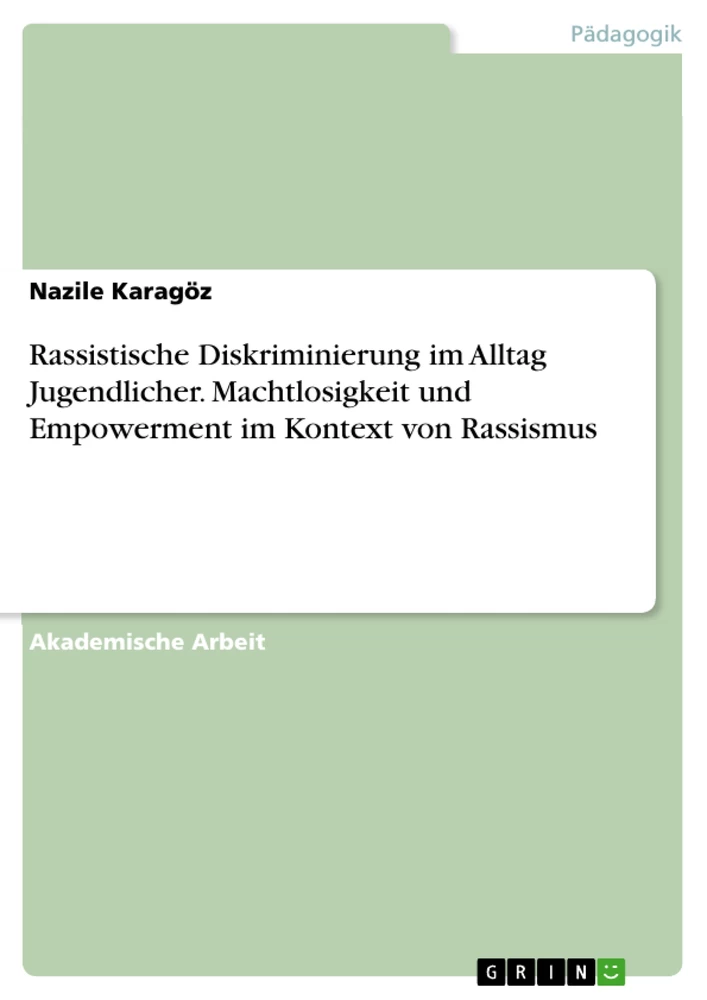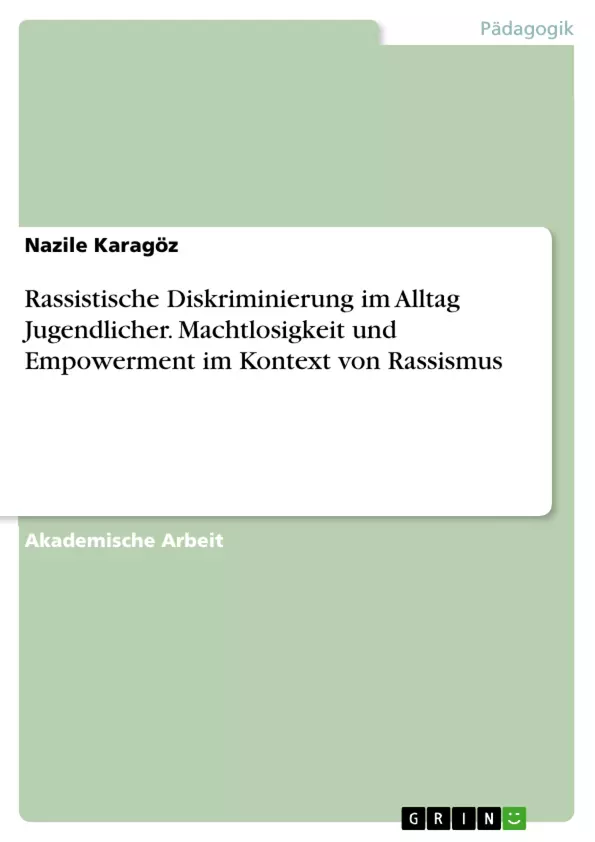Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Jugendliche rassistische Diskriminierungen im Alltag erleben und wie sie mit dieser umgehen.
Zunächst wird der Begriff Diskriminierung definiert. Diskriminierung bedeutet, dass ein Mensch durch unterschiedliche Behandlung benachteiligt wird. Sie stellt Hierarchien zwischen Gruppen her und grenzt beziehungsweise benachteiligt bestimmte Personengruppen. Vielmehr spricht man in Deutschland von den Begriffen Ungleichbehandlung, Ausgrenzung
und Benachteiligung, da die Begriffe Diskriminierung und Rassismus abwertend konnotiert sind.
In dieser Arbeit wird zuerst die Normalität des Rassismus dargestellt. Hierfür wird die Jugendphase mit den Merkmalen der Ethnizität und dem Geschlecht in Verbindung gebracht, das bedrohlich behaftet ist (jung, fremd, männlich). Hiernach werden alltägliche Mikroaggressionen beschrieben. Danach wird auf die Machtlosigkeit und Selbstnormalisierung
der Jugendlichen eingegangen. Zuletzt wird aufgezeigt, dass Empowerment ein wichtiger Bestandteil ist, um Jugendliche in diesem Kontext zu aktivieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Normalität von Rassismus
- Jung, männlich, fremd - eine „,bedrohliche“ Kombination
- Mikroaggressionen im Alltag
- Selbstnormalisierung und Machtlosigkeit der Jugendlichen
- Empowerment
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert, wie Jugendliche rassistische Diskriminierungen im Alltag erleben und mit diesen umgehen. Der Text beleuchtet dabei die Normalität von Rassismus im Kontext der Jugendphase, die spezifischen Herausforderungen, denen junge Männer mit Migrationshintergrund gegenüberstehen, und die Auswirkungen von Mikroaggressionen auf ihre Lebenswelt. Darüber hinaus wird die Machtlosigkeit und Selbstnormalisierung von Jugendlichen im Kontext von Rassismus untersucht und schließlich die Bedeutung von Empowerment als Werkzeug der Aktivierung und Selbstbestimmung beleuchtet.
- Normalität des Rassismus in der Jugendphase
- Jugendliche als ,Andere' und die Konstruktion von Fremdheit
- Die Verbindung von Jugend, Geschlecht und Ethnizität
- Mikroaggressionen im Alltag von Jugendlichen
- Machtlosigkeit und Selbstnormalisierung im Kontext von Rassismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text beginnt mit der Definition von Diskriminierung und erläutert, warum die Begriffe Ungleichbehandlung, Ausgrenzung und Benachteiligung in Deutschland vorherrschen. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Normalität von Rassismus: Dieses Kapitel untersucht, wie Rassismus in Lebenskontexten von Jugendlichen, die als ,Andere bzw., nicht-deutsch eingruppiert werden, manifestiert. Die Studie von Scharathow (2014) wird vorgestellt, die zeigt, dass Rassismus als „,dominante Normalitätsvorstellung und eine als selbstverständlich und legitim erscheinende soziale Ordnung“ (Scharathow 2014, S. 418) angesehen wird.
- Jung, männlich, fremd - eine „,bedrohliche“ Kombination: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Verbindung von jungen Männern mit Migrationshintergrund mit Gewalt und delinquentem Verhalten. Die Bedeutung der Verschränkung von Geschlecht, Jugend und Ethnizität im Verständnis von Jugend als soziale Konstruktion wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Rassismus, Diskriminierung, Jugend, Geschlecht, Ethnizität, Mikroaggressionen, Machtlosigkeit, Selbstnormalisierung, Empowerment, soziale Konstruktion, Lebenswelt, Jugendliche, Migrationshintergrund, „Andere“, „nicht-deutsch“, „bedrohlich“, „wild“, „fremd“
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Mikroaggressionen im Alltag?
Es handelt sich um subtile, oft unbewusste rassistische Herabwürdigungen oder Ausgrenzungen, die Jugendliche aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens täglich erleben.
Warum wird die Kombination 'jung, männlich, fremd' als bedrohlich wahrgenommen?
Gesellschaftliche Konstruktionen verknüpfen diese Merkmale oft mit Gewalt oder Delinquenz, was zu einer verstärkten Stigmatisierung und Überwachung dieser Jugendlichen führt.
Was bedeutet Selbstnormalisierung im Kontext von Rassismus?
Jugendliche neigen dazu, rassistische Erfahrungen als normalen Teil ihres Alltags zu akzeptieren, um handlungsfähig zu bleiben, was jedoch zu Gefühlen der Machtlosigkeit führen kann.
Wie kann Empowerment Jugendlichen helfen?
Empowerment zielt darauf ab, Jugendliche zu aktivieren, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen Werkzeuge zur Selbstbestimmung gegenüber Diskriminierung an die Hand zu geben.
Warum werden Begriffe wie 'Benachteiligung' statt 'Rassismus' oft bevorzugt?
In Deutschland sind Begriffe wie Rassismus stark abwertend konnotiert, weshalb oft neutralere Begriffe wie Ungleichbehandlung oder Ausgrenzung verwendet werden, um die Problematik zu beschreiben.
- Arbeit zitieren
- Nazile Karagöz (Autor:in), 2021, Rassistische Diskriminierung im Alltag Jugendlicher. Machtlosigkeit und Empowerment im Kontext von Rassismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043525