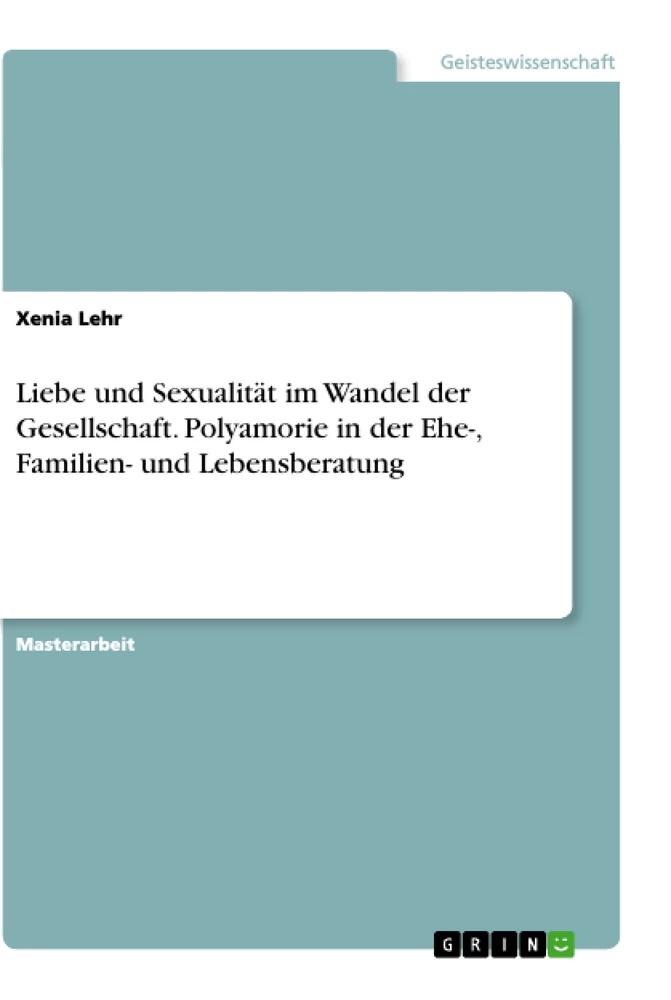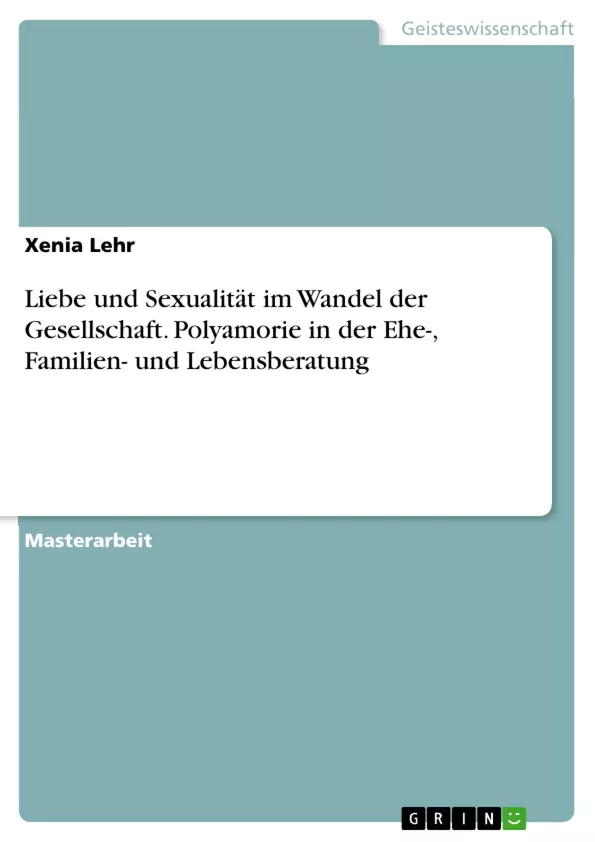Die Arbeit setzt sich mit den veränderten Vorstellungen von Liebe und Sexualität auseinander. Im Speziellen geht es um das Modell der Polyamorie, eine Praxis nach der Liebesbeziehungen zu mehreren Menschen gleichzeitig existieren dürfen- im Kontrast zur gängingen Vorstellung einer monogam geführten Partnerschaft. Beleuchtet wird das Thema empirisch (qualitativ) mittels Interviews, die mit Paarberater*innen geführt worden sind, die in ihrer Praxis polyamor lebende Paare begleitet haben.
Was heißt Liebe und welche Bedeutung hat sie für den Menschen? Der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm hat hierzu eine klare Meinung: „Ohne die Liebe könnte die Menschheit nicht einen Tag leben.“ Es scheint also etwas Existentielles für den Menschen zu sein. Bei näherer Betrachtung lassen sich jedoch verschiedene Formen der Liebe finden. So wird von Nächstenliebe gesprochen, von mütterlicher Liebe, von erotischer Liebe oder auch Selbstliebe. Die erotische Liebe stellt die wohl trügerischste Form der Liebe dar, da sie zwar exklusiv, aber nicht universell ist. Was aber, wenn diese Exklusivität in einer Partnerschaft nicht als oberste Kategorie erhoben wird? Was, wenn Beziehungsgestaltung neue Formen annimmt?
Das bindungsfreie Leben wird nicht nur in vielen medialen Darstellungen angepriesen, es ist eindeutiges Merkmal vieler Großstädte. Langfristige Verbindungen scheinen an Attraktivität zu verlieren, das eigene Ich wird in seinen verschiedensten Formen inszeniert und der eigene Genuss in den breiten Möglichkeiten in den Vordergrund gestellt. Dieser Trend wird durch die Statistiken der Einwohnermeldeämter bestätigt. Seit dem Jahr 1991 steigen Einpersonenhaushalte kontinuierlich an und machen in Großstädten, wie etwa München, Berlin oder Köln etwa 50 Prozent der Haushalte insgesamt aus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- I THEORETISCHER TEIL
- 2. Der Wandel von Partnerschaft und Beziehung
- 2.1 Historisch-soziologischer Rückblick unter Einbeziehung christlicher Glaubensvorstellungen
- 2.2 Die Liebe und die Diversität des Begriffs
- 2.2.1 Liebe im historischen Verständnis
- 2.2.2 Liebe im religiös-soziologischen Verständnis
- 2.2.3 Liebe aus dem Blickwinkel der Psychologie
- 3. Sexualität
- 3.1 Sexualität in Gesellschaft und Beziehungen
- 3.2 Sexualität als Ausdruck von Intimität
- 3.3 Männliche und weibliche Sexualität
- 3.4 Das katholische Sexualideal
- 3.5 Die sexuelle Revolution
- 3.6 Sexualität in Zeiten des Internet
- 4. Polyamorie
- 4.1 Ursprung und Definition von Polyamorie
- 4.2 Aktueller Forschungsstand
- 4.3 Polyamorie in Abgrenzung zu Monogamie und zu Offener Beziehung
- 4.4 Grundsätze von Polyamorie
- 4.5 Formen von Polyamorie
- 4.6 Grenzen und Hürden in der Polyamorie
- 4.7 Paar- und Einzelberatung zu Polyamorie
- II EMPIRISCHER TEIL
- 5. Begründung für die qualitative Vorgehensweise
- 6. Untersuchungsdesign und Forschungsmethode
- 6.1 Stichprobe
- 6.2 Methodik und Instrumente
- 6.3 Durchführung der Interviews
- 6.4 Regeln der Interviewtranskription
- 6.5 Auswertung der Daten
- 6.6 Ergebnisse
- 7. Diskussion, Ausblick und Implikationen für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Wandel von Partnerschaft und Beziehung im Kontext von Polyamorie. Ziel ist es, Polyamorie zu definieren, ihren aktuellen Forschungsstand darzustellen und ihre Bedeutung für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung zu beleuchten. Die Arbeit berücksichtigt dabei sowohl theoretische als auch empirische Aspekte.
- Der Wandel von Partnerschafts- und Beziehungsmodellen in der Gesellschaft
- Die Definition und der Ursprung von Polyamorie
- Der aktuelle Forschungsstand zu Polyamorie
- Polyamorie im Vergleich zu Monogamie und offenen Beziehungen
- Herausforderungen und Chancen der Polyamorie in der Beratungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Liebe und Sexualität im Wandel ein und thematisiert die zunehmende Diversität von Beziehungsformen. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Bedeutung von Polyamorie in der heutigen Gesellschaft und ihren Implikationen für die Beratungspraxis. Das Zitat von Katharine Hepburn unterstreicht den Fokus auf Geben statt Empfangen in der Liebe als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit alternativen Beziehungsmodellen.
2. Der Wandel von Partnerschaft und Beziehung: Dieses Kapitel analysiert den historischen und soziologischen Wandel von Partnerschaft und Beziehung, unter Einbezug christlicher Glaubensvorstellungen und psychologischer Perspektiven auf Liebe. Es beleuchtet den Begriff der Liebe in seinen verschiedenen Facetten und verknüpft ihn mit dem gesellschaftlichen Trend zu individualisierten Lebensentwürfen und der Zunahme von Einpersonenhaushalten. Der Rückblick auf historische und religiöse Verständnisweisen von Liebe bildet den Kontext für die Betrachtung moderner Beziehungsformen.
3. Sexualität: Kapitel 3 befasst sich umfassend mit dem Thema Sexualität, ihren gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Aspekten, und ihrer Bedeutung als Ausdruck von Intimität. Es werden geschlechtsspezifische Unterschiede, das katholische Sexualideal und die Auswirkungen der sexuellen Revolution und des Internets auf das Verständnis und die Praxis von Sexualität analysiert. Diese Betrachtung bildet die Grundlage für die spätere Auseinandersetzung mit Polyamorie und ihren sexuellen Aspekten.
4. Polyamorie: Das Kapitel definiert Polyamorie, präsentiert den aktuellen Forschungsstand und grenzt sie von Monogamie und offenen Beziehungen ab. Es werden die Grundsätze, Formen, Grenzen und Herausforderungen polyamoröser Beziehungen beleuchtet. Die Diskussion um Paar- und Einzelberatung in Bezug auf Polyamorie wird eingeleitet.
5. Begründung für die qualitative Vorgehensweise: Kapitel 5 begründet die Wahl einer qualitativen Forschungsmethode für die empirische Untersuchung. Es erläutert, warum qualitative Ansätze besonders geeignet sind, um die Komplexität von polyamorösen Beziehungen und die subjektiven Erfahrungen der Beteiligten zu erfassen.
6. Untersuchungsdesign und Forschungsmethode: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Untersuchungsdesign und die angewandte Methode der empirischen Untersuchung. Es wird auf die Stichprobenziehung, die Methodik, die Durchführung und Auswertung der Interviews eingegangen. Die Beschreibung der angewandten Instrumente und der Transkriptionsregeln sichert die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Forschung.
Schlüsselwörter
Polyamorie, Partnerschaft, Beziehung, Wandel, Sexualität, Liebe, qualitative Forschung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Monogamie, offene Beziehung, gesellschaftlicher Wandel, Individualisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Wandel von Partnerschaft und Beziehung im Kontext von Polyamorie
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Wandel von Partnerschaft und Beziehung im Kontext von Polyamorie. Sie beleuchtet sowohl theoretische als auch empirische Aspekte und zielt darauf ab, Polyamorie zu definieren, ihren aktuellen Forschungsstand darzustellen und ihre Bedeutung für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung zu erörtern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel von Partnerschafts- und Beziehungsmodellen, die Definition und den Ursprung von Polyamorie, den aktuellen Forschungsstand zu Polyamorie, einen Vergleich von Polyamorie mit Monogamie und offenen Beziehungen sowie die Herausforderungen und Chancen der Polyamorie in der Beratungspraxis. Sie beinhaltet einen historischen und soziologischen Rückblick auf Partnerschaft und Beziehung, unter Einbezug christlicher Glaubensvorstellungen und psychologischer Perspektiven auf Liebe. Des Weiteren wird das Thema Sexualität in seinen verschiedenen Facetten behandelt, inklusive des katholischen Sexualideals und der Auswirkungen der sexuellen Revolution und des Internets.
Welche Methode wurde für die empirische Untersuchung verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode. Die Wahl dieser Methode wird im Kapitel 5 begründet und die Details zum Untersuchungsdesign, der Stichprobenziehung, der Methodik, der Durchführung und Auswertung der Interviews werden in Kapitel 6 beschrieben. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Forschung wird durch die Beschreibung der angewandten Instrumente und der Transkriptionsregeln sichergestellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil umfasst Kapitel 2 ("Der Wandel von Partnerschaft und Beziehung"), 3 ("Sexualität") und 4 ("Polyamorie"). Der empirische Teil beinhaltet Kapitel 5 ("Begründung für die qualitative Vorgehensweise"), 6 ("Untersuchungsdesign und Forschungsmethode") und 7 ("Diskussion, Ausblick und Implikationen für die Praxis"). Zusätzlich beinhaltet die Arbeit eine Einleitung (Kapitel 1) und eine Zusammenfassung der Kapitel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Polyamorie, Partnerschaft, Beziehung, Wandel, Sexualität, Liebe, qualitative Forschung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Monogamie, offene Beziehung, gesellschaftlicher Wandel, Individualisierung.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht die Bedeutung von Polyamorie in der heutigen Gesellschaft und ihre Implikationen für die Beratungspraxis.
Wie wird Polyamorie in der Arbeit definiert und eingeordnet?
Die Arbeit definiert Polyamorie, stellt den aktuellen Forschungsstand dar und grenzt sie von Monogamie und offenen Beziehungen ab. Sie beleuchtet die Grundsätze, Formen, Grenzen und Herausforderungen polyamoröser Beziehungen und diskutiert die Paar- und Einzelberatung in Bezug auf Polyamorie.
- Quote paper
- Xenia Lehr (Author), 2020, Liebe und Sexualität im Wandel der Gesellschaft. Polyamorie in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1043552