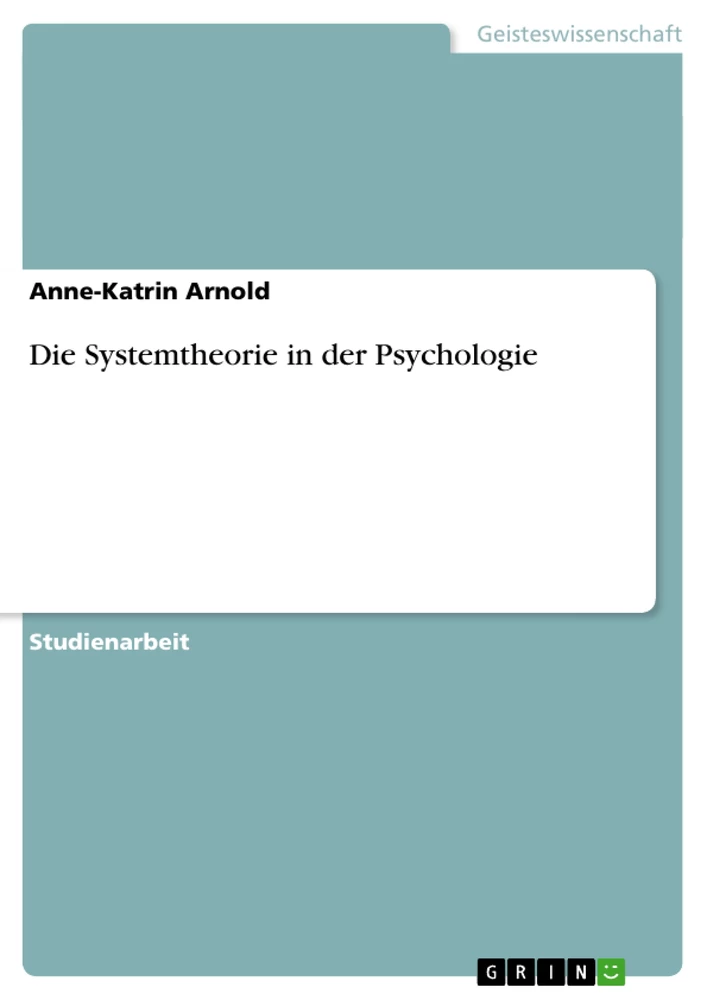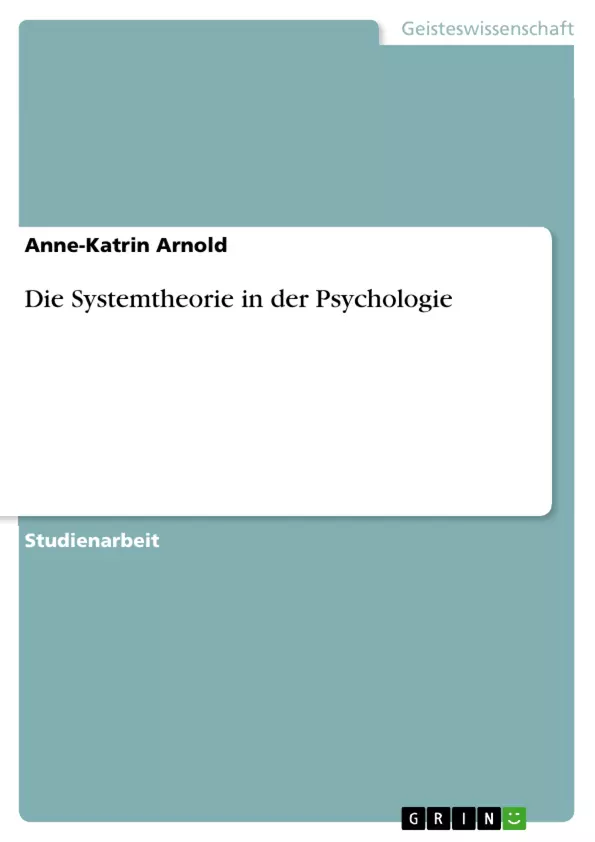Stellen Sie sich vor, die Psychotherapie, wie wir sie kennen, steht Kopf! Dieses Buch ist eine provokante Reise in die Welt der Systemtheorie, die unser Verständnis von Psyche, Krankheit und Heilung radikal verändert. Anstatt den Menschen als isoliertes Individuum zu betrachten, enthüllt der Autor die faszinierenden Wechselwirkungen zwischen psychischen Systemen und ihrer Umwelt. Erfahren Sie, wie Denken, Fühlen und Handeln untrennbar miteinander verwoben sind und wie unsere Identität durch ständige Selbstreflexion und Abgrenzung entsteht. Niklas Luhmanns bahnbrechende Ideen werden lebendig, wenn Vertrauen und Religion aus systemischer Perspektive neu interpretiert werden. Doch was bedeutet das für die klinische Psychologie? Kann ein Therapeut überhaupt in ein psychisches System eingreifen, oder schafft er lediglich neue Realitäten? Entdecken Sie die systemische Diagnostik als Metatheorie, die den Therapeuten selbst als Beobachter und Konstrukteur in den Blick nimmt. Lassen Sie sich von der Komplexität und Dynamik psychischer Systeme fesseln und erkennen Sie, warum lineare Therapieansätze oft scheitern. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen in der Psychologie interessieren und bereit sind, traditionelle Denkmuster zu hinterfragen. Es bietet neue Perspektiven für Psychotherapeuten, Psychologen und alle, die die menschliche Seele in ihrer ganzen Tiefe verstehen wollen. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Krankheit nicht als Defekt, sondern als gestörte Beziehung betrachtet wird und in der die Anpassungsfähigkeit des Systems im Mittelpunkt steht. Wagen Sie den Blick über den Tellerrand und entdecken Sie die revolutionären Erkenntnisse der Systemtheorie für die Psychologie! Das Buch ist ein Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Komplexität und bietet revolutionäre Ansätze in der Psychotherapie, indem es die traditionelle Sichtweise auf Psyche und Krankheit in Frage stellt. Der Leser wird in eine Welt eingeführt, in der das Individuum nicht als isoliert betrachtet wird, sondern als Teil eines größeren Systems, das ständigen Wechselwirkungen unterliegt. Die Systemtheorie bietet einen Rahmen, um die menschliche Seele in ihrer Gesamtheit zu erfassen, und ermöglicht so innovative Therapieansätze, die auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten sind. Es ist ein Muss für jeden, der die Grenzen der traditionellen Psychologie erweitern und neue Wege zur Heilung und zum Verständnis der menschlichen Natur beschreiten möchte. Entdecken Sie die verborgenen Dynamiken und Zusammenhänge, die unser Denken, Fühlen und Handeln prägen, und revolutionieren Sie Ihre Sichtweise auf die menschliche Psyche!
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. System und Umwelt
3. Psychische Systeme
4. Identität
4.1 Identität und Selbstreflexion
5. Exkurs: Zwei psychologische Phänomene bei Luhmann
5.1 Luhmann und das Vertrauen
5.2 Luhmann und die Religion
6. Die Systemtheorie in der klinischen Psychologie
6.1 Systemische Diagnostik
6.1.1 Krankheit
6.1.2 Diagnostik
6.2 Der Psychologe / Therapeut als Beobachter
7. Fazit
8. Literatur
“Die Systemtheorie kann wenigstens erklären, warum wir so wenig erklären und voraussagen können.” (Martens, 1984, S.183)
1. Einleitung
Systemisches Denken hat in den unterschiedlichsten Bereichen Einzug genommen. In der Organisationsberatung, Psychotherapie sowie in Managementseminaren ist von systemischem Denken als einer Basiskompetenz die Rede. Die Musikwissenschaft, Naturwissenschaften, sogar die Mechanik (zum Beispiel an der Universität Karlsruhe) haben die Systemtheorie in ihre Wissenschaftstheorie aufgenommen. Die Systemtheorie bildet dabei den theoretischen Hintergrund, der sich aus verschiedenen Theorien der Biologie, Mathematik, Psychologie, Soziologie und anderen Wissenschaftsdisziplinen entwickelt hat. Eine Zeichnung der geschichtlichen Entwicklung der Systemtheorie oder eine Beschreibung ihrer vielfältigen Ausprägungen sind nicht die Aufgabe dieser Ausarbeitung.
Ob die Systemtheorie nun einen Paradigmenwechsel in der Psychologie - oder auch in anderen Disziplinen - herbeigeführt hat, wird von Wissenschaftlern nicht klar entschieden. Luhmann selbst ist eher zurückhaltend, auch wenn “das Ausmaß und die Radikalität der theoretischen Umstellungen” einen Paradigmenwechsel vermuten lassen. “Aber es handelt sich nicht um eine wissenschaftliche ‘Revolution’, wenn das heißen soll, dass sich eine neuartige Grundeinsicht plötzlich, also schnell, durchsetzt.” (Luhmann, 1987, S. 308). Besonders für die systemische Methodik im Hinblick auf die Theorie selbstreferentieller Systeme besteht noch großer Bedarf an Empirisierungskonzepten (Schiepek, 1991, S.35).
Gegenstand der Arbeit soll der Einzug der Systemtheorie in die Psychologie sein. Wie an späterer Stelle erklärt wird, ist die systemtheoretische Sicht gerade in der Psychologie äußerst interessant und hat besonders auf die Psychotherapie entscheidende Auswirkungen. Das liegt zum einen daran, dass das psychische System - wenn man es eben als geschlossenes System betrachtet - Charakteristika aufweist, die einer klassischen Auffassung von Psychologie und vor allem Psychotherapie diametral widersprechen (siehe 6.). Zum anderen ist die spezielle Position des Beobachters (siehe 6.2) von besonderem Interesse für Psychotherapeuten, die, selbst psychische Systeme, andere psychische Systeme, die also in ihrer Umwelt liegen, beobachten.
In der vorliegenden Ausarbeitung wird zunächst ein Überblick über den Begriff “System” in der Systemtheorie gegeben (2.), wobei darauf verzichtet wird, alle theoretischen Grundlagen aufzuführen und zu diskutieren, das soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Im Folgenden wird das psychische System als besondere Form charakterisiert (3.), wobei auch auf die Identitätsfindung und -bildung psychischer Systeme eingegangen wird (4.). Niklas Luhmann hat sich intensiv mit mehreren Phänomenen beschäftigt, die aus systemtheoretischer Sicht von besonderem Interesse sind, aber auch das Gebiet der Psychologie betreffen. Zwei dieser Fälle sollen in einem Exkurs (5.) vorgestellt werden: Vertrauen und Religion aus der Sicht Luhmanns. Um die klinische Psychologie selbst und die Implikationen einer systemischen Sichtweise geht es im Abschnitt 6.
Zur Einstimmung auf das Thema sei dieses Zitat mit auf den Weg gegeben: “Der menschliche Verstand (ist) aufgrund seiner genetischen Ausstattung und Funktionsweise nicht geeignet, die Dynamik komplexer Systeme zu verstehen.” (Willke, 1983, S.27).
2. System und Umwelt
Grundsätzlich beherbergt der Begriff “Systemtheorie” mehr als eine Sichtweise unter einem Namen. Luhmanns “Theorie selbstreferentieller Systeme” (Luhmann, 1984) ist nur ein Aspekt unter vielen, aber natürlich gibt es Gemeinsamkeiten.
Gemeinsam ist allen systemtheoretischen Standpunkten die Trennung von “System” und “Umwelt” - wobei ein erkenntnistheoretischer Schritt ausgelassen wird und erklärt wird, Systeme gebe es eben. Systeme definieren sich dabei nach Luhmann (1984, S. 15) über Merkmale, “deren Entfallen den Charakter eines Gegenstandes als System in Frage stellen würde”. Diese Tautologie ist beim Verständnis der oft recht komplizierten Beschreibung von System nicht sehr hilfreich - Jürgen Kriz erklärt etwas einleuchtender: “ein System besteht aus einer Menge von Elementen und einer Menge von Relationen, die über diese ElementenMenge definiert sind” (Kriz, 1999, S. 102).
Jedes System hat dabei eine von anderen unterschiedene innere Bestimmtheit, ein von anderen unterschiedenes und unterscheidbares Wesen (Schlemm 1996, S. 47). Ein System ist eine “relativ stabile, geordnete Gesamtheit von Elementen und Beziehungen, die durch die Existenz bestimmter Gesetze, d.h. allgemein-notwendiger und wesentlicher Zusammenhänge, charakterisiert ist.” (Hörz & Wessel 1983, S. 45). Systeme sind selbstreferentiell und erzeugen sich selbst, wie an folgendem Beispiel anschaulich erklärt wird: “Vom tropischen
Regenwald weiß man, dass er seine Umgebung auf die Erzeugung von Regen hin ausrichtet” (Lovelock, 1993, S. 234).
Systeme grenzen sich von ihrer “Umwelt” ab. Ohne diese Unterscheidung kann ein System sich nicht erkennen. Jedes System ist für das andere Umwelt, jedes System kann darum auch die Umwelt nur auf systemeigene Weise aufnehmen (Porr, 1997). Die Umwelt stellt immer das dar, was nicht im System ist, sie ist also die andere Seite der Einheit der Differenz von System und Umwelt. Die Umwelt ist damit maximal komplex, da unendlich viele Relationen vorstellbar sind, die nicht existieren und damit das System nicht definieren. Systeme haben mit einer beschränkten Anzahl an Elementen und einer differenzierten Relationsstruktur immer eine geringere Komplexität als die Umwelt (Porr, 1997).
3. Psychische Systeme
Nach Luhmann sind psychische Systeme “konstituiert auf der Basis eines einheitlichen (selbstreferentiellen) Bewusstseinzusammenhanges”. Psychische Systeme sind nicht Bestandteile der von Luhmann ausführlich dargestellten sozialen Systeme, sondern sie sind “im Wege der Co-evolution entstanden. Die jeweils eine Systemart ist notwendige Umwelt der jeweils anderen. [...] Personen können nicht ohne soziale Systeme entstehen und bestehen, und das gleiche gilt umgekehrt” (Luhmann, 1984, S. 92). Luhmann lehnt den an dieser Stelle möglichen Schluss ab, dass also der Mensch Teil der Gesellschaft sei, die Gesellschaft demnach aus Menschen bestehe. Diese Prämisse widerspricht der Systemtheorie, die psychische Systeme als Umwelt sozialer Systeme und umgekehrt begreift (Luhmann, 1984, S. 92). Das psychische System hat auch keinen ontologischen Vorrang vor dem sozialen. Soziale System konstituieren sich über Kommunikation, psychische über Bewusstsein. Psychische Systeme sind nicht mit Individuen bzw. einzelnen Menschen gleichzusetzen.
Günter Schiepek (1986) führt das Argument ins Feld, dass psychische Systeme keinesfalls mit der statischen Definition anderer, möglicherweise materieller Systeme gleichgesetzt werden kann. Elemente und Merkmale können bei psychischen Systemen nicht als gegeben vorausgesetzt werden, vielmehr konstituieren sie sich gegenseitig. “Was in einem System Element sein kann, welche Merkmale und welche Dynamik es entwickelt, hängt von den anderen Elementen, vor allem aber von der Struktur und Dynamik des Gesamtsystems ab.” (Schiepek, 1986, S.30).
Eine sehr interessante Sichtweise ist die von Harald Wasser (1995), der, nach Freuds Lehre vom Ich, Über-Ich und Es, das psychische System noch einmal unterteilt in die Teilsysteme “immer bewusst”, “jederzeit bewusstseinsfähig” und “unbewusst”. Mit der Berücksichtigung des Unterbewussten wird ein Aspekt zur Erklärung psychischer Systeme beigetragen, der an sich ausschließt, psychische Systeme nur über den Operationsmodus “Bewusstsein” zu konstituieren, das Unbewusste, also der Modus “Unbewusstsein”, spielt nach recht gründlich gesicherter Erkenntnis der Psychoanalyse wohl ebenfalls eine große Rolle.
Schiepek (1991) erklärt in Anlehnung an Ciompi (1986) und Piaget (1976) eine Einheit von Kognition und Emotion als Komponente des psychischen Systems. Eine Trennung dieser beiden Elemente lehnt er davon ausgehend ab, dass eine völlig emotionsfreie Kognition unsinnig sei, genauso wie eine Emotion, die nicht zumindest prinzipiell und in vager Form wahrnehmbar oder erlebbar wäre. Die basale Operation von psychischen Systemen besteht nach Schiepek in der Produktion bzw. Reproduktion von Kognitions-Emotions-Einheiten, wobei diese Produktion selbst wiederum nicht anders erlebbar ist als wieder als eine Kognitions-Emotions-Einheit. “Das Denken des Denkens oder das Erleben des Erlebens tritt selbst wieder als Denken oder Erleben ins Bewusstsein.” (Schiepek, 1991, S. 148).
Die Selbstreferenz der Operation psychischer Systeme erfolgt als permanente Selbstbeobachtung. Dabei sind nach Luhmann (1985) drei verschiedene Arten der Selbstreferenz zu unterscheiden: “1. Die Selbstreferenz auf der Ebene der Gedankenereignisse, die darin bestehen, dass jeder Gedanke sich selbst nur als anderer der anderen vollziehen kann; 2. Die Selbstreferenz der Beobachtung, die darin besteht, dass die Beobachtung die Einheit des Bewusstseins anhand anderer Gedanken als Einheit der Differenz von Fremdreferenz (Bezugnahme auf den Gegenstand einer Kognitions-Emitions- Einheit, Anm.) und Selbstreferenz (Bezugnahme auf den Vollzug des psychischen Prozessierens, Anm.) Rekonstruiert; und 3. Die in dieser Differenz zur Bezeichnung freigegebene Selbstreferenz im Unterschied zur Fremdreferenz, mit deren Hilfe das Bewusstsein sich selbst zur Reflexion seiner Identität bringen kann.” (Luhmann, 1985, S. 411). Das Bewusstsein befasst sich also mit laufender Kombination und Rekombination von
Selbst- und Fremdreferenz, hindert sich aber gleichzeitig durch die Reproduktion von Gedanken daran, sich an die Welt oder an sich selbst zu verlieren.
Wie alle Systeme ist auch das psychische operational in sich selbst geschlossen. Es kann zwar Kognitions-Emotions-Einheiten wahrnehmen, sie mit anderen in Beziehung setzen und mit neuen, in dieser bestimmten Konstellation nun verfügbaren Kognitions-Emotions-Einheiten reagieren. Damit reagiert das System auf die neuronalen Prozesse der Wahrnehmung und die physiologischen Prozesse der Handlungsausführung, es ist sogar darauf angewiesen, tritt aber operational nicht aus sich heraus.
Selbstbewusstsein des psychischen Systems entsteht dadurch, dass innerhalb des selbstreferentiellen Prozessierens Kognitions-Emotions-Einheiten sich selbst thematisieren, das Prozessieren des psychischen Systems kann sich also in sich selbst hineinnehmen (Schiepek, 1991, S.150). Die Unterscheidung von Selbst- und Fremdbewusstsein hängt von der Zurechnung ab. Erlebt man etwas, wird einer Kognitions-Emotions-Einheit eine Zuschreibung auf die Umwelt des psychischen Systems, zum Beispiel der biologische Körper, verliehen. Selbstbewusstsein dagegen setzt eine Zuschreibung auf die (Mit-)Verursachung von Kognitions-Emotions-Einheiten bei der Produktion weiterer solcher Einheiten, also eine Zuschreibung auf das psychische System, voraus. “In diesem Falle ist das Selbst das System, dem die selbstreferentielle Operation sich zurechnet, wobei sie die Unterscheidung von System und Umwelt beansprucht” (Schiepek, 1991, S. 151).
Sprache spielt eine bedeutende Rolle bei der Selbsterhaltung von psychischen Systemen. Sie steigert die Zahl der verfügbaren Unterscheidungen, so dass komplexere kognitive Operationen möglich werden. Sie stellt auch die Reflexivität psychischer Prozesse sicher, das System kann sich durch Sprache selbst thematisieren und beschreiben. Sprache ist eine wichtige Grundlage für strukturelle Kopplungen zwischen Individuen (Schiepek, 1991, S. 148-153).
Eine weitere wichtige Grundlage für das Verständnis von psychischen Systeme sieht Schiepek im Begriff “Schema”. “Ein Schema ist ein Ordnungsmuster des Prozessierens psychischer Komponenten, das unter bestimmten Ausgangsbedingungen (über in ähnlicher Weise vorgenommene Selektionen von Kognitions-Emotions-Einheiten) reproduziert wird.”
(Schiepek, 1991, S. 152). Es sind also sich selbst reproduzierende Ordnungsmuster, die sich unter bestimmten Ausgangsbedingungen einstellen. Treten genau diese bestimmten Ausgangsbedingungen wieder auf, werden die entsprechenden Schemata reproduziert, dadurch kommt es zum Beispiel zu vergleichbaren menschlichen Reaktionen in vergleichbaren Situationen.
4. Identität
Grundsätzlich muss man sich vom herkömmlichen Verständnis von Identität trennen, will man diesen Begriff aus systemtheoretischer Sicht verstehen. Identität hat nicht der Mensch, sondern ein System.
“Identität bezeichnet die Annahme unterscheidbarer Bezeichnungsmöglichkeiten als unterscheidbar.” (Schiepek, 1991, S. 87). Diese Tautologie in Luhmanscher Tradition bedeutet, dass Identität als ein Selbst-Schema zu betrachten ist, ein umfassendes Ordnungsmuster, dass identitätsstiftende Unterscheidungen beinhaltet, in die das psychische System diejenigen Schemata einordnet, die Aspekte der eigenen Identität und seiner Bezüge zur Umwelt thematisieren.
Jürgen Kriz hat ein ähnliches Konzept vom Selbst: “Das Selbst ist die relativ stabile Struktur eines dynamisch-prozessualen Systems, dessen Elemente kurzlebige Kommunikationen sind (analytisch trennbar in afferente ‘Wahrnehmungen’, efferentes ‘Verhalten/Handlungen’ und selbstreferentielles ‘Erleben/Bewusstsein/Denken). Veränderung ist als Selbstorganisationsprozess zu sehen, der unter bestimmten Bedingungen angeregt wird, eine neue, aber kohärente Struktur zu verwirklichen, die - von außen betrachtet - als bessere Adaption des Systems an die Umgebungsbedingungen (relativ zu seinen autonomen Strukturen) gesehen werden kann.” (Kriz, 1987).
Aus der Tatsache, dass Systeme sich selbst reflektieren, ergibt sich bereits eine Identität (Bender, 1989, S. 37), das System differenziert sich gerade dadurch, dass es für sich als Einheit gegenständlich wird, Selbstreflexion impliziert also Selbstdifferenzierung, das heißt die Herausbildung einer Identität, auch hinsichtlich einer Außendarstellung und -begrenzung. Die Identität eines psychischen Systems konstituiert sich aus den Differenzierungen, die ein System von anderen unterscheiden, in denen ein System seine Identität prozessiert. Luhmanns Systemtheorie erlaubt allerdings keinen Schluss darauf, welcher Art die Prozesse der Selbstreflexion sind, die ein System zur Selbstherstellung und -beschreibung heranzieht.
Möglich wäre, dass Theorien zur Sprache und zur Kommunikation hier Aufschluss bieten könnten - worauf allerdings in dieser Ausarbeitung nicht eingegangen werden kann. Christiane Bender (1989) möchte zusätzlich zu den von Luhmann in “Soziale Systeme” (1984) systemimmanenten Differenzierungen, die die Identität eines Systems ausmachen, auch soziale Prozesse einbeziehen, die voraussetzen, dass “die selbstreflexiv erworbenen Selbstidentifizierungen und Differenzsetzungen ebenso von anderen Systemen geteilt und unterstellt werden. Erst über die Fundierung der Identität in der Perspektive anderer Systeme als Außenperspektive kann das System überhaupt praktisch seine Identitätssetzungen verwirklichen.” (Bender, 1989, S. 38). Sie bestreitet nicht, dass selbstreferentielle Systeme Differenzierungen selbst definieren, möchte aber die soziale Relevanz dieser Systemgrenzen berücksichtigen. Selbstbeschreibungen eines Systems werden erst zur Identität, wenn sie auch außerhalb des Systems übernommen und manifestiert werden, wenn also die Umwelt die Identität des Systems ebenso beschreibt, wie das System selbst. Diese Forderung ist aus Sicht der Psychologie interessant, da Umweltprozesse in die Identitätsbildung und -abbildung einbezogen werden. Das entspräche der klassischen Psychoanalyse und -therapie, die zur Diagnose und zur Beschreibung eines Individuums immer Einflüsse der Sozialisation (z.B. Elternhaus) etc. heranzieht. Nichtsdestotrotz widerspricht sie der Luhmannschen Systemtheorie, die von selbstreferentiellen, operational völlig geschlossenen Systemen ausgeht, deren Identität eben nicht durch Mitwirkung der Umwelt gebildet wird, sonder durch Selbstreflexion.
Im Licht Benders weitergehender Überlegungen, dass nur dort Systemgrenzen stabilisiert werden können, wo die Identitätskonstruktion auf einem normativen Fundament beruht, das sozial anerkannt und reflektiert wird, wird der Widerspruch zu Luhmanns Theorie selbstreferentieller Systeme deutlich. Auch legt diese Betrachtungsweise nahe anzunehmen, dass ein System sowohl eine psychische Identität (durch Selbtsreflexion) und eine soziale Identität (durch soziale Anerkennung und ein normatives Fundament) hat. Das allerdings schließt Luhmann aus: “Erst recht hilft es nicht weiter, die Lehre von den zwei Identitäten, einer personalen und einer sozialen, zu Grunde zu legen - ganz abgesehen davon, dass kein Individuum sich selbst in dieser Weise zweifach identifiziert und auch kein Beobachter in der Lage wäre, diese Identitäten auseinanderzuhalten.” (Luhmann, 1984, S. 373).
Betrachtet man die sozialen Prozesse und die soziale Anerkennung und Reflexion allerdings als strukturelle Kopplung psychischer Systeme mit der Umwelt und den sich in ihr befindenden Systemen, wird dieser Einfluss zur Identitätsbildung einsehbarer.
Zusammenfassend ließe sich sagen, dass die Identität von Bewusstsein konstituiert ist aus der systemimmanenten Differenzierung und den strukturellen Kopplungen des psychischen Systems. Identitäten werden also grundsätzlich erst einmal vom System selbst produziert (und reproduziert), strukturelle Kopplungen mit der Umwelt tragen aber auch zur Herausbildung einer Identität bei. Die Übertragung auf die Psyche, wie sie in der empirischen Psychologie verstanden wird, liegt nahe: die Umwelt eines Menschen hat zwar Einfluss auf sein Bewusstsein, das ist aber nicht primär für die Entwicklung einer Identität, sondern die systemimmanenten Produktionen und Reproduktionen psychischer Prozesse spielen die Hauptrolle. Hier finden sich Ähnlichkeiten zum neuronalen Konstruktivismus, der davon ausgeht, dass das menschliche Gehirn als Konstrukteur das jeweilige Bild eines Individuums von der Welt prägt (vgl. dazu Roth, 1995).
4.1 Identität und Selbstreflexion
Selbstreflexion meint grundsätzlich erst einmal, dass eine Identität, hier also die Identität eines psychischen Systems, für sich selbst zum Gegenstand wird. Um Reflexion anzuregen, muss die Identität eines Systems problematisiert werden, also als negierbar erscheinen (Luhmann, 1977, S. 59).
“Die Theorie selbstreferentieller Systeme behauptet, dass eine Ausdifferenzierung von Systemen nur durch Selbstreferenz zustandekommen kann, dass heißt dadurch, dass die Systeme in der Konstitution ihrer Elemente und ihrer elementaren Operationen auf sich selbst (sei es auf Elemente desselben Systems, sei es auf die Einheit desselben Systems) Bezug nehmen müssen.” (Luhmann, 1984, S.25). Systeme müssen sich also erst selbst erkennen, um dann auf sich selbst Bezug nehmen zu können und sich so selbst zu reproduzieren. Die System müssen also eine Beschreibung von sich selbst erzeugen. Im Fall psychischer Systeme ist das Bewusstsein eine Voraussetzung zur Beobachtung, die wiederum Voraussetzung zur Erstellung einer Selbstbeschreibung ist.
Luhmann bezeichnet die Reflexivität eines Systems als prozessuale Selbstreferenz (Luhmann, 1984, S. 601). Es handelt sich um einen Prozess, dem die Unterscheidung von Vorher und Nachher zugrunde liegt. Der Prozess, in dem sich das Selbst referiert bzw. reflektiert ist konstituierend für das System. Übertragen auf das Selbst des Bewusstseins hieße das, dass das ständige “Nachdenken” über Vergangenes und das, was danach kam, ein Bewusstsein des
Selbst herausbildet und dieses Selbst über eben dieses Reflektieren immer wieder neu produziert.
Zusätzlich zur Reflexivität führt Luhmann (ebd.) die Reflexion ein. Diese beruht auf der Unterscheidung von System und Umwelt. Das Selbst, das in diesem Fall System ist, grenzt sich also von der Umwelt ab und konstituiert darum wiederum seine Identität, sein Selbst, im Unterschied zur Umwelt.
Es kann also gefolgert werden: Durch einen Prozess des Reflektierens über Vorher- und Nachherzustände und durch die Abgrenzung und Unterscheidung des Systems zur Umwelt wird das Selbst definiert. Im Alltag ließe sich das so beschreiben: Der Mensch bildet seine Identität, sein Selbst einmal darüber, was er oder sie aus dem Nachdenken über vergangene Zustände und deren (zeitlichen) Folgen lernt, zum anderen dadurch, wie er sich im Unterschied zum Beispiel zu anderen Menschen definiert.
5. Exkurs: Zwei psychologische Phänomene bei Luhmann
5.1 Luhmann und das Vertrauen
Niklas Luhmann hat dem Phänomen “Vertrauen” ein ganzes, wenn auch schmales, Buch gewidmet (Luhmann, 1989). An dieser Stelle kann sicher kein vollständiger Überblick über die Thematik gegeben werden, aufgrund der Nähe des Themas zur Psychologie bzw. Psyche des Menschen soll aber ein Einblick versucht werden.
“Vertrauen im weitesten Sinne eines Zutrauens zu eigenen Erwartungen ist ein elementarer Tatbestand des sozialen Lebens.” (Luhmann, 1989, S. 1). Vertrauen ist ein Wesenszug, ist in der Natur des Menschen.
Grundsätzlich bedeutet Vertrauen, die Zukunft vorwegzunehmen. Ein Mensch, der vertraut, handelt so, als ob er die Zukunft kenne; er oder sie erwartet, dass sich ein bestimmtes Verhalten als richtig erweist, ohne dass die betreffende Person dafür faktische Sicherheiten hat. Aus diesem Grund setzt eine Theorie des Vertrauens eigentlich eine Theorie der Zeit voraus. Aber: “Diese Voraussetzung führt in ein so schwieriges, dunkles Gelände, dass wir sie hier nicht einlösen können.” (Luhmann, 1989, S. 8). Wenn schon Luhmann selbst sich diese Auslassung zugesteht, darf auch in dieser Ausarbeitung auf einen Abriss theoretischer Erklärungen von “Zeit” verzichtet werden.
Das Zeitproblem der Systeme, das Luhmann erklärt, besteht darin, dass, sobald Systeme durch Ausdifferenzierung Grenzen gegenüber ihrer Umwelt bilden, die Prozesse, die diese Ausdifferenzierung erhalten, sich in eine zeitliche Reihenfolge, in ein Nacheinander verschieben. Das liegt daran, dass Beziehungen zwischen System und Umwelt meist nicht momenthaft Punkt zu Punkt erfolgen, sondern über Umwege, die Zeit brauchen. Die objektive Welt hat eine bedeutend größere Komplexität als ein System, sie enthält mehr Möglichkeiten, als im System vorgesehen sind oder auch nur verwirklicht werden können. In diesem Sinne weist das System einen höheren Grad an Ordnung gegenüber der Welt auf (Luhmann, 1989, S. 33). Das Bewusstsein ist überhaupt nicht in der Lage, Sinn und Welt vollständig zu begreifen. Dieses Ordnungsgefälle wird ausgeglichen, indem das System die Welt selektiv interpretiert, es reduziert die Komplexität auf ein Maß, an dem es sich orientieren kann.
Luhmann bezeichnet Vertrauen als “riskante Vorleistung” (Luhmann, 1989, S. 23ff). Die Welt ist unkontrollierbar komplex, es gibt unendlich viele Handlungsalternativen, der Mensch muss sich aber hier und jetzt für eine entscheiden. Wenn er oder sie nun auf ein bestimmtes Handeln anderer Menschen vertrauen kann, erleichtert das die Entscheidung. Zum Beispiel ermöglicht das Vertrauen, dass sich Verkehrsteilnehmer rational und rücksichtsvoll verhalten, ein zügiges Fahren ohne jede Eventualität berechnen zu müssen - was ohnehin unmöglich ist.
Das reduzierte Maß an verarbeitbaren Möglichkeiten und Relationen stellt die vertraute Welt dar, die vom Rest, dem unbegreiflich bleibenden, durch die Grenze vom Vertrauten zum Unvertrauten getrennt ist. Diese Reduktion auf das Vertraute ermöglicht relativ sicheres Erwarten und ein Absorbieren von Risiken. Die Vergangenheit dominiert Gegenwart und Zukunft, denn die Komplexität der Vergangenheit ist maximal reduziert, es gibt in ihr keine anderen Möglichkeiten mehr. Das Vertrauen ist also aus der Vergangenheit in die Zukunft gerichtet. “Im Akt des Vertrauens wird die Komplexität der zukünftigen Welt reduziert. Der vertrauensvoll Handelnde engagiert sich so, als ob es in der Zukunft nur bestimmte Möglichkeiten gäbe.” (Luhmann, 1989, S. 20).
Die Voraussetzung, Vertrauen bilden zu können, liegt in einer hinreichenden Eigenkomplexität des Systems, damit gewisse Umweltverhältnisse durch interne Prozesse wiedergegeben werden können. Ein einzelnes System kann nicht vertrauen (Luhmann, 1989, S. 40ff), denn - worin sollte es dieses Vertrauen entwickeln? Voraussetzung ist eine Umwelt, die schon eine Struktur hat, in der sich also andere Systeme befinden.
Beschließen lässt sich der Exkurs mit Luhmanns Worten: “Vertrauen beruht auf Täuschung.”;
Vertrauen ist letztlich immer unbegrünbar” und - eine “riskante Vorleistung” (Luhmann, 1989).
5.2 Luhmann und die Religion
Um ein Ausufern der vorliegenden Arbeit zu verhindern, wird im Folgenden nur die Funktionalität der Religion bei Luhmann behandelt. Dabei werden vor allem Aspekte berücksichtigt, die die menschliche Psyche berühren.
Ganz allgemein betrachtet, kann auch die Funktion von Religion für den Menschen als Reduktion vom Komplexität betrachtet werden. Hier besteht dieses Reduktion darin, dass durch einen Vorgang des Chiffrierens Unbestimmbares in Bestimmbares transformiert wird. Die Chiffren konstruieren dabei Wissen, indem sie das Bestimmte an den Platz des Unbestimmten setzen und es dadurch verdecken. Was durch sie verdeckt wird, hat keine Realität mehr, es wird allerdings noch als das miterlebt, das eine Formgebung, nämlich die Überdeckung von Bestimmten durch Unbestimmtes, nötig macht. Dieses Miterleben wird nach Luhmann (1977, S. 33) “dann als Bindung (religio) erfahrbar; es präsentiert die Unvermeidlichkeit reduktiver Bestimmung”.
Religiöse Erfahrungen können durch verschiedene Probleme und Situationen entstehen. So können mehrdeutige Ereignisse oder empfundenes Unglück zu religiösen Empfindungen führen; hier liegt also ein momentanes, vorübergehendes Bedürfnis nach Erklärung durch oder Flucht in die Religion vor.
Der Anstoß für das Einsetzen religiöser Orientierung kann dann erfolgen, wenn Unbestimmbares auf einmal bestimmt werden muss. Auf der anderen Seite kann auch bereits Bestimmtes durch den Einsatz religiöser Ideen wieder aufgelöst, unbestimmbar gemacht werden (Luhmann, 1977, S. 36ff). Im ersten Fall wird schlichtweg Komplexität reduziert, gefährliche Vieldeutigkeit wird auf feste, berechenbare Typen heruntergebrochen. Religiöse Mythen erklären Phänomene und leiten daraus Rituale und Vorschriften ab. Furcht ist dominierendes Mittel, deshalb werden die von der Religion gesetzten Regeln alternativlos akzeptiert. Luhmann bezieht diese Funktion besonders auf frühe Gesellschaftsformen, man kann aber erkennen, dass diese Funktion latent auch heute noch von der Kirche eingesetzt wird, wenn sie mit drastischen Strafen (Fegefeuer etc.) für die Übertretung der von der Kirche geschaffenen Regelsysteme droht oder evolutionäre Vorgänge, die andere physikalisch und chemisch nur schwer erklären können, mit dem Wirken einer übergeordneten Existenz begründet. “Die Religion interpretiert Umwelt für die Gesellschaft.” (Luhmann, 1977, S. 38). Im zweiten Fall, Luhmann spricht hier von der Hochreligion, werden tradierte Muster der Erlebnisverarbeitung aufgelöst und auf höherem Niveau der Generalisierung neu formiert (ebd.). Dadurch wird Bestimmbares wieder in Unbestimmbares zurückgeführt, für das wiederum die Religion - und nur sie - Verhaltensregeln bereithält. In der Religionsentwicklung der abendländischen Gesellschaft sieht Luhmann einen Trend hin zur Annahme einer transzendenten Person, um “Generalisierung, Systematisierung und Spezifikation zu verbinden.” (ebd.). Auf diese Weise kann das menschliche Unvermögen, die Welt vollständig zu entschlüsseln, der Endlichkeit des Menschen und seinem begrenzten Erkenntnisvermögen angelastet werden. Was der Mensch nicht begreifen kann, ist eben so. Auch hier zum Abschluss ein Zitat aus Luhmanns “Funktion der Religion”: “Natürlich gibt es die Möglichkeit, sich mit Hilfe von Idolatrie oder Ideologie ganz diesseits der Linie (der Religion, Anm.) zu bewegen oder mit Hilfe von Drogen ganz jenseits der Linie.” (Luhmann, 1977, S.46).
6. Die Systemtheorie in der klinischen Psychologie
Um einen Einblick in die Anwendung systemischen Denkens in der klinischen Psychologie zu geben zu geben, soll erst einmal geklärt werden, was diese Sichtweise für die klinische Praxis überhaupt leistet. Günter Schiepek (1991, S. 12) stellt fest: “Systemisches Denken zwingt nicht zu einer vorschnellen Einschränkung oder Ausgrenzung möglicher Problemdefinitionen. [...] Systemisches Denken tritt vielmehr dann auf den Plan, wenn es darum geht, Problemdefinitionen offen zu halten, mehrere Problemdefinitionen nebeneinander (z.B. zu Zwecken des Vergleichs) oder hintereinander (um der Eigendynamik eines Szenarios gerecht zu werden) oder auf ihre jeweiligen Folge- und Nebenwirkungen zu prüfen. Die Offenheit systemischen Denkens resultiert unter anderem aus dem Versuch, sich auf die Komplexität und Dynamizität von Szenarien einzulassen.” Das ist dann von Vorteil, wenn man bedenkt, dass die Praxis der Psychotherapie sich nicht darauf beschränkt, Therapieprogramme abzuarbeiten, sondern dass die meisten Psychologen in ambulanten oder institutionellen Kontexten arbeiten, in denen ihre Tätigkeit als Handeln in komplexen, eigendynamischen Systemen charakterisiert werden kann. Die Aufgaben von Psychologen werden nicht erledigt, indem bestimmte Vorgaben, zum Beispiel die Überwindung einer Phobie eines Patienten, durch strategischen Input zielsicher erreicht werden. Schiepek (1986, 1991) sieht im Falle systemsicher Theorien die Chance, neue Möglichkeiten gerade dort zu entdecken, wo die Theorie Grenzen aufzeigt. Wenn lineare Vorgehensweisen in der therapeutischen Praxis zu keinem Erfolg führen, kann der Therapeut vielleicht für einen Moment die Kontrolle aufgeben - und einsehen, dass der Versuch der Fremdautonomisierung anderer Systeme in der Umwelt des Therapeuten nirgendwohin führen. Instruktive Eingriffe in das andere System sind unmöglich.
Stellt sich die Frage: Wozu dann überhaupt noch Psychotherapie? Funktioniert sie unter systemischer Denkweise? Schiepek (1991) meint: Ja, sie funktioniert: “Die systemische Theorie hilft der Praxis gewissermaßen von unten: sie sagt, was alles nicht geht und schafft damit Handlungsspielräume.”
In der systemischen klinischen Psychologie bezieht sich die systemische Sichtweise nicht nur auf den Gegenstand der Diagnostik, die rekursiv auch den Diagnostiker einschließt, sondern auch der diagnostisch-therapeutische Prozess wird als dynamisches und selbstorganisierendes System betrachtet (Schiepek, 1986). Dazu im Folgenden nähere Ausführungen.
6.1 Systemische Diagnostik
“Diagnose” bedeutet aus dem Griechischen übersetzt “Auseinandererkennen”. “In Diagnosen zeigt sich, welche Unterschiede Ärzte und andere Therapeuten für die Ausübung ihrer heilenden Profession als wichtig und relevant erachten” (Simon, 1988, S.113). Es geht darum,
(Be)Handlungsanleitungen zu gewinnen, die einen präskriptiven Charakter für das Kurieren von Kranken haben.
Das erste Problem tut sich auf, wenn man berücksichtigt, dass die Charakterisierung von Krankheit oder psychischer Störung als Zustand nicht unproblematisch ist, da im Bereich lebender Systeme Zustände nichts statisches sind, sondern Prozesse, die aber möglicherweise dem Beobachter über einen Zeitraum hinweg als unverändert erscheinen (ebd.). Schiepek (1986, S.45ff) schließt sich dem an führt weiter aus: Psychologen handeln in Humanökosystemen bzw. in sozialen Systemen, die folgende Charakteristik haben:
1. Vernetztheit (Einzelzusammenhänge und Variablen sind in ein Netz von Zusammenhängen eingebunden, so dass Handlungen, die in Bezug auf einen Bereich intendiert waren, in anderen Bereichen Folgen haben).
2. Komplexität (Anzahl und Art der zwischen den Elementen eines Systems bestehenden strukturbildenden Relationen).
3. Unbestimmtheit (dem Akteur ist die Struktur eines Systems zunächst nicht bekannt).
4. Eigendynamik (Systeme, an denen Lebewesen beteiligt sind, verändern sich).
5. Mangelnde Prognostizierbarkeit (Prognosen sind aufgrund der systemimmanenten Dynamiken kaum möglich). Alle diese Eigenschaften machen einem Psychotherapeuten die Arbeit erst mal schwer.
6.1.1 Krankheit
Wie oben (6.1) bereits ausgeführt, ist Krankheit kein statischer Zustand sondern ein Prozess. Auf systemischer Ebene lässt sich Krankheit als eine Form der Störung eines lebenden Systems verstehen: die System-Umwelt-Anpassung ist in einer Weise gestört, die eine Bedrohung der Kohärenz des Systems und damit das Überleben in seinem aktuellen Interaktionsbereich darstellt (Simon, 1988, S. 113ff). Es handelt sich dabei lediglich um gestörte Beziehungen, die Verhaltensweisen und Prozesse, sie in einer spezifischen Welt “gesund” sind, können in einer anderen “krank” sein.
Die Krankheit kann nur daran gemessen werden, dass die Fähigkeit des Systems, sich in unterschiedlichen möglichen Umwelten anzupassen verloren geht. “Bezieht man “Anpassungsfähigkeit” allein auf das System, so ist die Wahrscheinlichkeit des (Über)lebens um so größer, je höher die Anpassungsfähigkeit eines Systems ist.” (ebd.). Krankheit ist also eine Einschränkung der Anpassungsfähigkeit. Würde der interaktionelle Kontext des erkrankten Systems unverändert bleiben, würde es sich in diesem nicht mehr zurechtfinden und ein Überleben wäre nicht mehr garantiert. Es gibt nun zwei Methoden der erfolgreichen Überwindung solcher Krisen: die Assimilation, also die Anpassung der Umwelt an die systemeigenen Strukturen, oder die Akkommodation, die Anpassung der systeminternen Strukturen an die Umwelt.
6.1.2 Diagnostik
Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Probleme (6.1) und des Krankheitsbegriffs (6.1.1) soll nun die Diagnostik als Versuch beschrieben werden, sich unter diesen Bedingungen in den sozialen und konfrontiert mit den psychischen Systemen zurechtzufinden. Diagnostik muss sich dabei natürlich den komplexen Strukturen und Bedingungen der Systeme anschließen, sonst wird jede Psychotherapie erfolglos bleiben.
Die systemische Diagnostik erhält den Stellenwert einer Metatheorie (Nissen, 1991), denn sie
lässt sich zur Beschreibung verschiedenster klinisch-psychologisch relevanter Systeme heranziehen. Systemische Diagnostik richtet sich auf drei Aspekte: 1. Das beschreibende System, nämlich der Diagnostiker oder Therapeut. 2. Das beschriebene System, also ein Humanökosystem oder ein soziales System (nur im Grenzfall ein Einzelindividuum). 3. Der Prozess des diagnostischen und therapeutischen Vorgehens (Schiepek, 1986, S. 45ff). Günter Schiepek benutzt folgende Grafik, um dies zu veranschaulichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es gilt in der systemischen Diagnostik nun, die so beschriebenen Prozesse mit den Zielvariablen in Einklang zu bringen und daraus eine erfolgreiche Therapie zu basteln, die das Überleben des erkrankten Systems sichert und seine Anpassungsfähigkeit verbessert. An dieser Stelle kann allerdings nicht auf das gesamte Verständnis von Therapie, das therapeutische Vorgehen oder therapeutische Strategien eingegangen werden.
Die Diagnostik wird für Schiepek (1986) erschwert, weil sich Systeme aus der Perspektive des Beobachters, als des Diagnostizierenden oft “kontraintuitiv und chaotisch” (ebd., S. 50) verhalten. Der Input kovariiert nicht mit dem Output (geringfügige Änderungen des Inputs können zu großen Veränderungen des Outputs führen, z.B. erhält der Therapeut auf eine ähnliche Frage eine ganz andere Antwort), es existieren auch keine Kausalbeziehungen (Luhmann, 1984): Funktionale Netze ändern sich als ganze und gleichzeitig, nicht in einander (zeitlich) nachgeordneten Schritten (Dell, 1982).
Die systemische Diagnostik hat nach Perrez & Waldow (1984) drei Funktionen:
1. Beschreibung: Die Beschreibung eines Systems nimmt eine zentrale Rolle ein. Sie besteht in der Konstruktion eines idiographischen Systemmodells., also eines Bildes, das sich ein Beobachter vom Funktionieren und von den Zusammenhängen eines beobachteten Systems macht. Hierbei kommt es eher auf das Erkennen von Mustern und Strukturen als auf eine exakte Quantifizierung an.
2. Erklärung: Das vom Therapeuten erstellte Modell erklärt insoweit, als dass es beobachtete Phänomene und Vorgänge nachzeichnet.
3. Statusdiagnostik zu Selektionszwecken: Der Therapeut verschafft sich einen genauen Überblick über die Probleme, die Persönlichkeit, das interpersonale Verhalten, die Lebenssituation und Biografie seines Patienten (Becker, 1995, S. 398). In der systemischen Diagnostik ist diese Funktion allerdings deutlich nachgeordnet (Schiepek, 1986). Die Diagnose, also das idiographische Systemmodell, dient dem Therapeut als Orientierungshilfe, es reduziert Komplexität (ebd.). Die Komplexität der Umwelt des Therapeuten soll so in Komplexität des Systems selbst umgewandelt werden, dass sie der Kapazität des Therapeuten entspricht und so bearbeitet werden kann. “Von Reduktion der Komplexität sollte man [...] immer dann sprechen, wenn das Relationsgefüge eines komplexen Zusammenhangs durch einen zweiten Zusammenhang mit weniger Relationen rekonstruiert wird.” (Luhmann, 1984, S. 50).
Der Diagnostiker befindet sich, wie bereits festgestellt, in der Person des Beobachters. Im folgenden soll diese Position noch einmal genauer betrachtet werden.
6.2 Der Psychologe / Therapeut als Beobachter
Beobachten ist eine Operation der Unterscheidung (Luhmann, 1984). Das System unterscheidet sich selbst von der Umwelt. Es kann die Umwelt beobachten und beschreiben, auch andere System in dieser Umwelt (die ja eben Umwelt sind).
Grundsätzlich ist klar, dass jeder Psychotherapeut, der einen Menschen beraten oder ihm anderweitig helfen soll, zu allererst die Position eines Beobachters einnimmt. Luhmann (1984, S. 359f) macht dazu klar, dass eine Beobachtung psychischer Systeme nicht notwendig die Beobachtung ihres Bewusstseins impliziert.
Psychotherapie beruht oft auf Modellen. Modelle werden von Beobachtern produziert (Schiepek, 1991, S. 42ff) und sind völlig von ihm und seiner Konstruktionsleistung abhängig. Es ist stets der Beobachter, der Grenzen zieht und dadurch Systeme definiert (Simon, 1988). Bischof (1998, S. 13f) stellt die Frage, wie beliebig die Weise ist, in der der Betrachter Systemgrenzen zieht und damit entscheidet, welche Elemente und Relationen zum System gehören und welche nicht. Er stellt dafür folgende, in der Praxis allerdings nicht leicht nachzuvollziehende Bedingungen auf: um ein “ultimatives Modell” vom System zu zeichnen, sind zwei gedankliche Operationen nötig: Die Abstraktion und die Interpretation. Abstrahiert wird zum einen dadurch, dass die Qualität der Systemvariablen nicht beachtet wird und dass die Determination der Systemprozesse zumindest teilweise offen bleibt. Letzteres soll offensichtlich verhindern, dass gezogene Grenzen zu einem statischen und damit falschen Bild führen. Die Interpretation des Beobachters besteht darin, dass den Variablen fremde, also vom Beobachter zugewiesene, Qualitäten als Bedeutung zugeteilt werden. Alle Prozesse werden als durch das System intendiert aufgefasst. Diese etwas komplizierte Erklärung (Bischof ist Kybernetiker) kann kurz gefasst so verstanden werden, als das der Beobachter für das System fremde, eben dem Beobachter vertraute, Kriterien zur Beschreibung des Systems anwenden muss ohne dabei Eventualitäten zu verbauen, sondern sie offen zu lassen.
Schiepek (1991) führt aus, dass Modelle nicht nur artifizielle Produkte sind, sondern die Interaktion mit dem Beobachter bereits das Original verändert, also das System, von dem der Beobachter das Modell angefertigt hat. Das ist besonders bei psychischen (und sozialen) Systemen der Fall, weil deren Verhalten erst aufgrund spezifischer Interaktion mit dem
System erkennbar ist. Selbst wenn sich der Beobachter jeder Intervention zu erhalten versucht, entscheidet die Selektivität des Beobachters über die Basis der Modellbildung. Allerdings sollte hier nicht Veränderung im eigentlichen Sinne des Wortes gemeint sein, denn nicht das beobachtete psychische System verändert sich, es interagiert lediglich mit der Umwelt und ändern kann sich nur das Bild des Beobachters vom System - ansonsten gäbe es hier ein Wiederspruch zum Grundsatz der Autopoiese der Systeme.
“Die in der psychosozialen Praxis angefertigten Beschreibungen beruhen so gut wie immer auf der Funktionseinheit von Beobachtung und Intervention, so dass sich der Beobachter konsequenterweise in seine Beschreibung des Systems, dessen Teil er geworden ist, einbeziehen müsste.” (ebd.). Diese Sichtweise legt jedenfalls nahe, in der Praxis der Psychotherapie den Therapeuten als konstruierende und intervenierende Kraft miteinzubeziehen. Das macht objektive Diagnostik und Therapie unmöglich. Eine Konsequenz ist, dass aus der Erkenntnis heraus, dass die von einem Diagnostiker gestellte Diagnose immer nur seine Diagnose sein kann, die Konstruktion von Problemen klein und überschaubar gehalten wird (Schiepek, 1991, S. 42ff). Ein Auftrag (eines Patienten an einen Therapeuten) führt zur Entdeckung eines Problems (z.B. dass der Patient in der Kindheit Schwierigkeiten mit dem strengen Vater hatte). Mit diesem Sachverhalt muss nun etwas angefangen werden, damit hat man das nächste, immer noch überschaubare Problem, und so geht es Schritt für Schritt weiter.
Grundsätzlich ist es für jeden Therapeuten unumgänglich, sich in Fremdbeobachtung und - beschreibung zu schulen, was voraussetzt, sich in Selbstbeobachtung und -beschreibung zu schulen, da sich die Unterschiede vom Beobachter zum beobachteten psychischen System nur durch die Feststellung von Unterschieden manifestieren lassen (Luhmann, 1984; Schiepek, 1991). Und der Therapeut muss verstehen, dass dem Denken und Handeln des anderen Systems andere Präferenzen und Präferenzordnungen zugrunde liegen. Das grundlegende Problem beschreibt Schiepek als “dass die kommunikative Selbstreferenz der Therapie ihr Interesse auf die Beobachtung und Veränderung eines psychischen Systems abgerichtet hat, [...] gleichzeitig aber auf nichts anderes rekurrieren kann als auf sich selbst, also auf Kommunikation, somit beinhart auf das angewiesen ist, was mitgeteilt wurde, ohne die geringste Chance eines direkten Zugriffs auf psychische Systeme in seiner Umwelt.”
7. Fazit
Die systemtheoretische Psychologie ist ein sehr weites Feld, dass noch viel detaillierte beleuchtet werden müsste, um ein klares Bild der Implikationen zu erhalten. Im Rahmen dieser Ausarbeitung sollte nur ein grundsätzlicher Einblick geleistet werden. Ziel war es, die Besonderheiten psychischer Systeme zu beleuchten. Zudem sollte gezeigt werden, welche Auswirkungen eine systemische Sichtweise auf die psychologische Praxis und die klinische Psychologie hat.
Grundsätzlich können diese Implikationen als enorm betrachtet werden. Wird das Individuum nicht mehr, wie in der klassischen Psychotherapie üblich, als keineswegs in sich geschlossener sondern den Umwelteinflüssen mehr oder weniger hilflos ausgelieferter Mensch verstanden, sondern als System, ergibt sich die Notwendigkeit einer neuen Herangehensweise an die psychologische Praxis. Besonders interessant erscheint die Frage, ob es überhaupt möglich ist, einen Menschen zu therapieren, denn ein System aus der Umwelt (hier: der Therapeut) kann nur bedingt in das psychische System eingreifen oder es verändern.
Besonders aufschlussreich ist auch die Feststellung Simon (1988), dass eine Krankheit eine Störung ist, die in einer anderen Umwelt durchaus keine Störung sein muss, sondern dort funktional ist. Das weist auf die Ansichten von Carl Gustav Jung hin (nachzulesen in Jacobi, 1977, aber auch in Jungs zahlreichen Werken), der, gegensätzlich zu Freud, der Meinung war, psychisch gestörte Menschen dürfe man nicht als anormal betrachten, sondern ihnen ermöglichen, in der Welt zu leben, in der das psychische System keine funktionalen Störungen aufweist.
Die grundsätzliche Implikation für die Psychotherapie ist, dass statische Therapieprogramme aus dem Lehrbuch keinen Erfolg haben können, weil in ihnen weder die Funktionsweisen der beiden sich gegenüberstehenden psychischen Systeme noch deren Zusammenspiel berücksichtigt wird. Ein Aufbrechen der herkömmlichen starren Therapieformen ist unumgänglich.
Für die Psychologie im Allgemeinen bedeutet die systemische Sichtweise erst einmal eine nicht erfassbare Komplexität, die sich aus der Dynamik aller Systeme und ihrer Kopplungen ergibt. Aber gerade die so gewonnene Menge an Möglichkeiten - der psychischen Phänomene und ihrer Auswirkungen - ist es, die die Systemtheorie auf diesem Gebiet einfach ungeheuer faszinierend macht.
8. Literatur
Becker, P. (1995). Seelische Gesundheit und Verhaltenskontrolle. Eine integrative Persönlichkeitstheorie und ihre klinische Anwendung. Göttingen: Hogrefe.
Bender, C. (1989). Identität und Selbstreflexion. Zur reflexiven Konstruktion der sozialen Wirklichkeit in der Systemtheorie von N. Luhmann und im Symbolischen Interaktionismus von G.H. Mead. Frankfurt/ Main: Peter Lang.
Bischof, N. (1998). Struktur und Bedeutung. Eine Einführung in die Systemtheorie für Psychologen. Göttingen: Hans Huber.
Ciompi, L. (1986). Zur Integration von Fühlen und Denken im Licht der “Affektlogik”. Die Psyche als Teil eines autopoietischen Systems. In: Kisker, K.P., Lauter, H., Meyer, J.E., Miller, C. & Strömgren, E. (Hrsg.). Psychiatrie der Gegenwart, Bd. 1. Berlin: Springer, S. 373-410).
Dell, P. F. (1982). Beyond Homeostasis: Toward a Concept of Coherence. Family Process, 21, 21-41.
Hörz, H. & Wessel, K.-F. (1983). Philosophische Entwicklungstheorie. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.
Jacobi, J. (1977). Die Psychologie von C. G. Jung. Eine Einführung in das Gesamtwerk. Frankfurt/Main: Fischer.
Kriz, J. (1987). Entwurf einer systemischen Theorie klientenzentrierter Psychotherapie. Forschungsberichte aus dem Fachbereich Psychologie. Osnabrück: Universität.
Kriz, J. (1999). Systemtheorie für Psychotherapeuten, Psychologen und Mediziner. Eine Einführung. Wien: Facultas.
Lovelock, J. (1993). Das Gaia-Prinzip. Die Biosphäre unseres Planeten. Zürich: Artemis &
Winkler.
Luhmann, N. (1977). Funktion der Religion. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Luhmann, N. (1985). Die Autopoiese des Bewusstseins. Soziale Welt 36(4), S. 402-446.
Luhmann, N. (1987). Autopoiesis als soziologischer Begriff. In: Haferkamp, H. & Schmid,
M. ( Hrsg.). Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Frankfurt/ Main: Suhrkamp, S. 307-324.
Luhmann, N. (1989). Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart: Ferdinand Enke.
Martens, B. (1984). Differentialgleichungen und dynamische Systeme in den Sozialwissenschaften. München: Profil.
Nissen, B. (1991). Entwicklungsdynamik psychosozialer Systeme. Aktions- und systemtheoretische Analysen und Überlegungen. Göttingen: Hogrefe.
Perrez, M. & Waldow, M. (1984). Theoriegeleitete Verlaufsdiagnostik im Bereich der Psychotherapie. In: Jüttemann, G. (Hrsg.). Neue Aspekte klinisch-psychologischer Diagnostik. Göttingen: Hogrefe.
Piaget, J. (1976). Die Äquilibration der kognitiven Strukturen. Stuttgart: Klett-Cotta.
Porr, B. (1997). Systemtheorie. http://www.neurop.ruhr-uni-
bochum.de/~porr/luhmann3/node3.html.
Roth, G. (1995). Das Gehirn und seine Erkenntnis. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Schiepek, G. (1986). Systemische Diagnostik in der Klinischen Psychologie. Weinheim/Basel:Beltz.
Schiepek, G. (1991). Systemtheorie der Klinischen Psychologie. Beiträge zu ausgewählten Problemstellungen. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg & Sohn.
Wasser, H. (1995). Psychoanalyse als Theorie autopietischer Systeme. Soziale Systeme. Zeitschrift für Soziologische Theorie, 1(2), 329-350.
Häufig gestellte Fragen zur Systemtheorie in der klinischen Psychologie
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Anwendung der Systemtheorie in der Psychologie, insbesondere in der klinischen Psychologie. Es wird untersucht, wie systemisches Denken die Sichtweise auf psychische Systeme, Diagnostik und Therapie beeinflusst.
Was sind die Kernkonzepte der Systemtheorie, die in der Arbeit behandelt werden?
Die Arbeit behandelt Schlüsselkonzepte wie System und Umwelt, selbstreferenzielle Systeme, psychische Systeme als spezielle Formen von Systemen, Identität von Systemen und die Rolle des Beobachters.
Wie definieren Systemtheoretiker ein "System"?
Ein System wird definiert durch Elemente und deren Beziehungen zueinander, wobei sich das System von seiner Umwelt abgrenzt. Systeme sind selbstreferentiell und erzeugen sich selbst.
Wie unterscheidet sich ein psychisches System von anderen Systemen?
Psychische Systeme basieren auf einem einheitlichen Bewusstseinszusammenhang und sind von sozialen Systemen zu unterscheiden. Sie sind operational geschlossen und selbstreferentiell.
Was bedeutet "Identität" im Kontext der Systemtheorie?
Identität bezieht sich nicht auf Individuen, sondern auf Systeme. Sie ist ein Selbst-Schema, ein umfassendes Ordnungsmuster, das identitätsstiftende Unterscheidungen beinhaltet.
Was ist die Bedeutung von Selbstreflexion für die Identität eines Systems?
Selbstreflexion ermöglicht es einem System, sich selbst zum Gegenstand zu machen und sich dadurch von seiner Umwelt abzugrenzen, was zur Konstitution seiner Identität beiträgt.
Welche Rolle spielt Vertrauen in der Systemtheorie nach Luhmann?
Vertrauen wird als riskante Vorleistung betrachtet, die es ermöglicht, die Komplexität der Welt zu reduzieren und Entscheidungen zu erleichtern. Es setzt eine hinreichende Eigenkomplexität des Systems voraus.
Wie betrachtet Luhmann die Funktion der Religion?
Religion dient der Reduktion von Komplexität, indem sie Unbestimmbares in Bestimmbares transformiert und so eine Orientierungshilfe bietet.
Wie beeinflusst systemisches Denken die klinische Psychologie?
Systemisches Denken ermöglicht es, Problemdefinitionen offen zu halten und die Komplexität und Dynamizität von Szenarien zu berücksichtigen. Es betont die Bedeutung des Kontextes und der Beziehungen zwischen Elementen.
Was ist systemische Diagnostik?
Systemische Diagnostik betrachtet den Diagnostiker, das beschriebene System und den diagnostisch-therapeutischen Prozess als ein dynamisches und selbstorganisierendes System.
Wie wird "Krankheit" aus systemischer Sicht definiert?
Krankheit ist kein statischer Zustand, sondern ein Prozess, eine Störung der System-Umwelt-Anpassung, die die Kohärenz des Systems bedroht.
Welche Rolle spielt der Psychologe/Therapeut als Beobachter?
Der Therapeut nimmt die Position eines Beobachters ein, der Modelle konstruiert und das System durch seine Interaktion beeinflusst. Objektive Diagnostik und Therapie sind somit nicht möglich.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit bezüglich der klinischen Psychologie?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass statische Therapieprogramme nicht erfolgreich sein können, da sie die Funktionsweisen der beteiligten Systeme und deren Interaktionen nicht berücksichtigen. Eine neue Herangehensweise an die psychologische Praxis ist erforderlich.
- Quote paper
- Anne-Katrin Arnold (Author), 2001, Die Systemtheorie in der Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104459