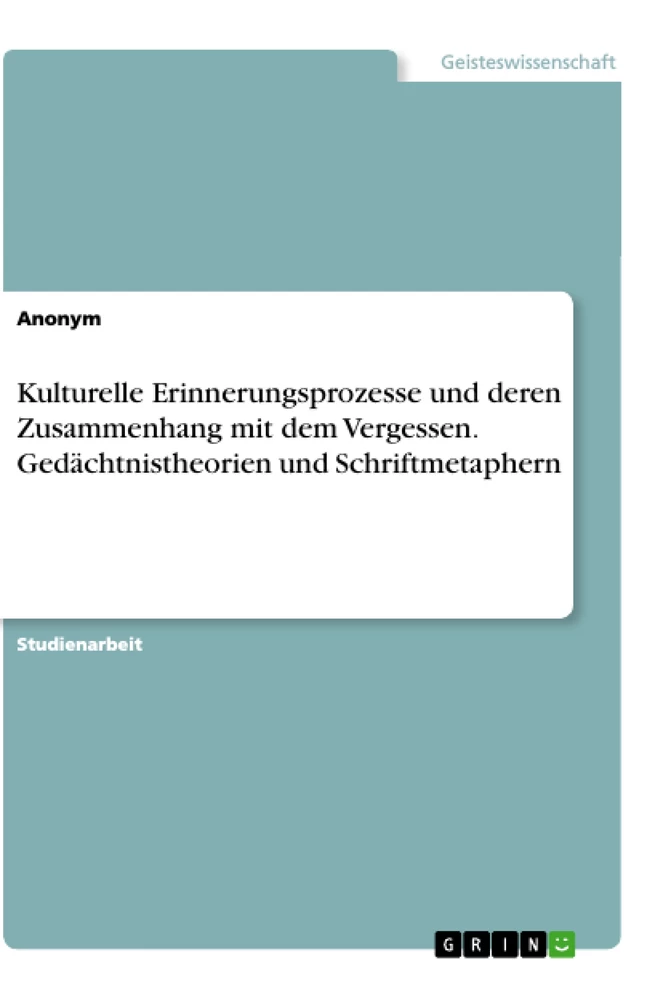Die Geschichte ist geprägt von verschiedenen Vorstellungen über die Funktionsweise des Gedächtnisses. Dabei wird das Gedächtnis in Speicher- und Funktionsgedächtnis unterteilt, welche zusammen das kulturelle Gedächtnis bilden. Beide stehen im Gegensatz zueinander und werden im zweiten Kapitel genauer erläutert.
Jede Epoche hat eigene Gedächtnismetaphern und so wird im dritten Kapitel auf die Schriftmetaphern eingegangen. Diese sind mit der Erfindung der Schrift entstanden und bilden die ersten Gedächtnismetaphern. Dabei geht es vor allem um die historischen Versuche, sich das Gedächtnis verständlich zu machen.
Harald Weinrich unterscheidet dabei zwei Formen der Gedächtnismetaphern: Magazin- und Wachstafelmetaphern. Magazinmetaphern verstehen das Gedächtnis als einen Komplex, wie beispielsweise Bibliotheken oder Enzyklopädien. Die Wachstafelmetaphern finden ihren Ursprung in Platons Überlegungen zur Schrift, welche Freud als „Wunderblock“ weiterentwickelt. Bei dieser Schreibmetapher kann einmal gelöschtes wieder sichtbar gemacht werden. Er enthält also „in seiner Wachsschicht zugleich ein vergängliches und ein dauerhaftes Gedächtnis“. Freud beschreibt mit dieser Metapher, dass man sich auch an bereits vergessenes wieder zurückerinnern kann, was unter anderem über Psychoanalyse durch Psychoanalytiker geschehen kann. Markus Krajewski beschreibt das Vergessen als ein „tabula rasa“. Es ist nicht möglich, etwas aus seinem Gedächtnis zu löschen, es sei nur verborgen und müsse in den Vordergrund gebracht werden.
Mit der Zeit findet ein stetiger Wechsel der Gedächtnistheorien und -metaphern statt, da sich die Technik immer weiter verändert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das kulturelle Gedächtnis
- Schriftmetaphern
- Wachstafel
- Palimpsest
- Wunderblock
- Wachstafel
- Vergessen und Erinnern
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Funktionsweise des Gedächtnisses und dessen Zusammenhang mit dem Vergessen. Sie analysiert unterschiedliche Ansätze zur Definition des kulturellen Gedächtnisses und untersucht, wie sich die Vorstellung vom Gedächtnis im Laufe der Geschichte entwickelt hat.
- Das kulturelle Gedächtnis als Konstrukt aus Erinnern und Vergessen
- Die Bedeutung von Schriftmetaphern für die Entwicklung von Gedächtnismodellen
- Die Rolle von Speicher- und Funktionsgedächtnis im kulturellen Gedächtnis
- Die Wechselwirkung zwischen Zeit, Raum und Erinnerung
- Die Bedeutung von Vermittlungsprozessen für die Prägung des kulturellen Gedächtnisses
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet unterschiedliche Vorstellungen von der Funktionsweise des Gedächtnisses. Sie unterteilt das Gedächtnis in Speicher- und Funktionsgedächtnis und erläutert, wie diese zum kulturellen Gedächtnis zusammenwirken.
2. Das kulturelle Gedächtnis
In diesem Kapitel wird der Begriff des „kulturellen Gedächtnisses“ von Aleida und Jan Assmann eingeführt und definiert. Es werden verschiedene Aspekte des kulturellen Gedächtnisses beleuchtet, wie die erzieherische Funktion der Vergangenheit, die Verbindung von Zeit und Raum sowie die Unterscheidung zwischen Erinnern und Vergessen.
3. Schriftmetaphern
Das dritte Kapitel befasst sich mit Schriftmetaphern als frühen Gedächtnismodellen. Es wird zwischen Magazin- und Wachstafelmetaphern unterschieden und die Entstehung der Schriftmetaphern im Kontext der historischen Versuche, das Gedächtnis zu begreifen, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kulturelles Gedächtnis, Erinnern, Vergessen, Gedächtnismetaphern, Schriftmetaphern, Wachstafel, Wunderblock, Speichergedächtnis, Funktionsgedächtnis, Zeit, Raum, Vermittlung, Archive, Museen, Denkmäler.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Speicher- und Funktionsgedächtnis?
Das Speichergedächtnis bewahrt ungenutztes Wissen (Archive), während das Funktionsgedächtnis die aktuell relevante Identität einer Kultur durch aktive Erinnerung formt.
Was versteht man unter "Schriftmetaphern" für das Gedächtnis?
Es sind historische Versuche, das Gedächtnis durch Vergleiche mit Schreibtechniken (Wachstafel, Bibliothek, Palimpsest) begreifbar zu machen.
Was symbolisiert Freuds "Wunderblock"?
Der Wunderblock zeigt, wie das Gedächtnis gleichzeitig flüchtig (auf der Oberfläche) und dauerhaft (in der darunterliegenden Wachsschicht) Informationen speichert, die später wieder abgerufen werden können.
Ist Vergessen ein endgültiges Löschen von Informationen?
Nach Theorien wie der von Krajewski ist Vergessen eher ein Verbergen ("tabula rasa"). Informationen sind im Gedächtnis vorhanden, aber nicht unmittelbar zugänglich.
Wie beeinflusst Technik unsere Gedächtnistheorien?
Jede Epoche nutzt ihre führende Technologie (von der Wachstafel bis zum Computer), um die Funktionsweise des menschlichen Gehirns und der kulturellen Erinnerung zu erklären.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2020, Kulturelle Erinnerungsprozesse und deren Zusammenhang mit dem Vergessen. Gedächtnistheorien und Schriftmetaphern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1044696