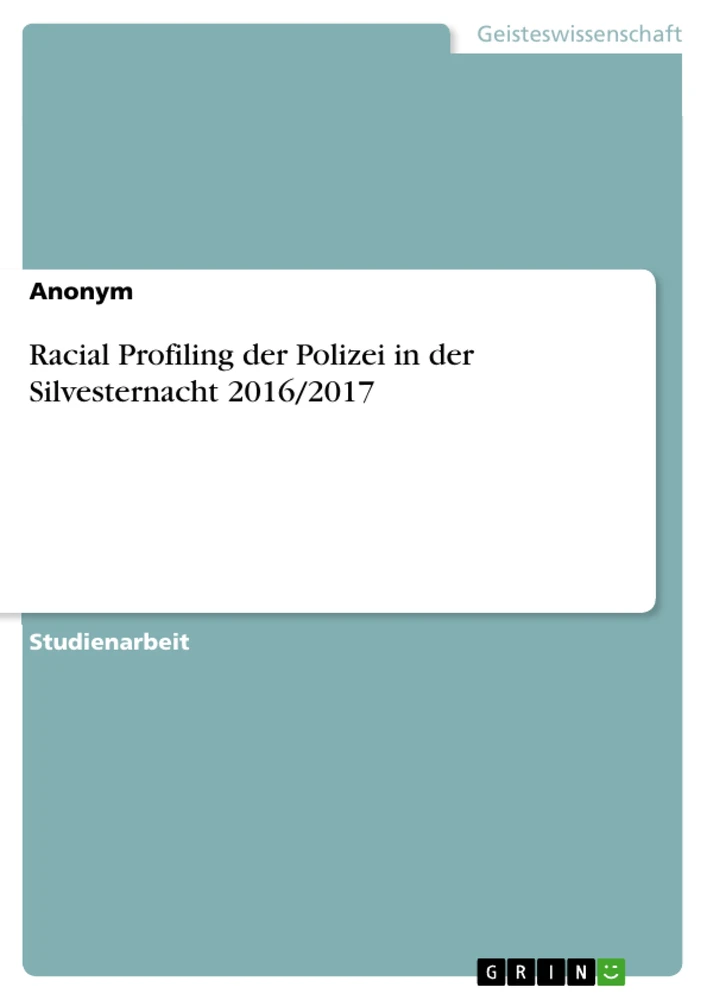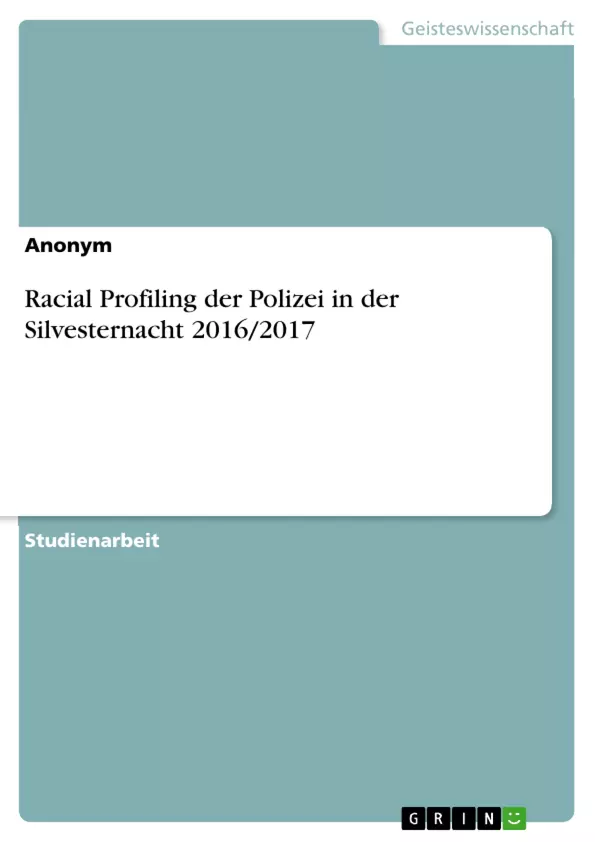Die Arbeit beginnt mit einer begrifflichen Grundlage von Racial Profiling, auf der im späteren Verlauf die Beurteilung, in welchen Fällen es sich um Racial Profiling handelt, basieren soll. Anschließend wird ein beispielhaftes Gerichtsurteil zu einem Racial Profiling-Fall des Oberlandesgerichts Koblenz angeführt, um die rechtliche Situation beispielhaft darzustellen.
Auf diesen Ausführungen baut schließlich die konkrete Fallanalyse der Polizeikontrollen in der Silvesternacht 2016/2017 auf, die zum Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit erklärt werden. Es handelt sich bei diesen um eine Folgereaktion auf die Geschehnisse des Vorjahres, die dadurch begründet ebenfalls einer kurzen Darstellung bedürfen. Es gilt zu überprüfen, ob die von Amnesty International geäußerte Kritik, es habe sich 2016/2017 um Racial Profiling gehandelt, zu unterstützen ist.
Des Weiteren werden etwaige Handlungsalternativen der Polizei aufgezeigt, die die Berechtigung der Aktionen entweder unterstützen oder zurückweisen. Um ein differenziertes Meinungsbild zu schaffen, wird auch die Legitimation der Handlungen durch die Polizei angeführt.
Abschließend wird, ausgehend von der vorherigen Auseinandersetzung, ein Fazit gezogen, in dem beurteilt wird, ob es sich bei den Polizeikontrollen in der Silvesternacht 2016/2017 um Racial Profiling handelte
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche Grundlage: Racial Profiling
- 2.1 Definition
- 2.2 Urteil
- 3. Silvesternacht 2016/2017
- 3.1 Einordnung der Geschehnisse
- 3.2 Überprüfung der Kritik
- 3.3 Alternative Handlungsmöglichkeiten
- 3.4 Legitimation seitens der Polizei
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik des Racial Profilings durch die Polizei in der Silvesternacht 2016/2017. Die Untersuchung zielt darauf ab, die Kritik von Amnesty International an den Polizeikontrollen in dieser Nacht zu überprüfen und zu beurteilen, ob es sich tatsächlich um Racial Profiling handelte.
- Begriffliche Klärung des Racial Profilings und seine rechtliche Einordnung.
- Analyse der Polizeikontrollen in der Silvesternacht 2016/2017 im Hinblick auf Racial Profiling.
- Bewertung der Kritik von Amnesty International an den Polizeikontrollen.
- Prüfung von alternativen Handlungsmöglichkeiten der Polizei.
- Einbezug der Legitimationsargumente der Polizei.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dient als Einleitung und führt in die Thematik des Racial Profilings ein. Es beleuchtet das Problem anhand eines Beispiels aus einem Interview und stellt die Relevanz des Themas in einer immer diverser werdenden Gesellschaft heraus. Die Diskussion um die Notwendigkeit einer Evaluation von Racial Profiling durch die Polizei wird beleuchtet, sowie die Position des Innenministers Seehofer dazu dargestellt.
Kapitel 2 behandelt die begriffliche Grundlage von Racial Profiling. Es definiert den Begriff, beleuchtet seine motivatonalen Hintergründe und zeigt die enge Verbindung zum Begriff der Diskriminierung auf. Ein exemplarischer Gerichtsentscheid wird vorgestellt, um die rechtliche Situation zu verdeutlichen.
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Polizeikontrollen in der Silvesternacht 2016/2017. Es beleuchtet den Kontext der Geschehnisse und die Kritik von Amnesty International, die von Racial Profiling spricht. Alternative Handlungsmöglichkeiten der Polizei werden analysiert, und die Legitimationsargumente der Polizei werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Racial Profiling, Polizeikontrolle, Silvesternacht, Amnesty International, Diskriminierung, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Legitimation, Handlungsalternativen, Kritik, Evaluation, Polizeiarbeit, Diversität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Racial Profiling?
Racial Profiling bezeichnet polizeiliche Kontrollen oder Maßnahmen, die primär auf äußeren Merkmalen wie der Hautfarbe oder der ethnischen Herkunft basieren, anstatt auf konkreten verdächtigen Verhaltensweisen.
Warum wurde die Polizeiarbeit in der Silvesternacht 2016/2017 kritisiert?
Amnesty International und andere Kritiker warfen der Polizei vor, in dieser Nacht gezielte Kontrollen aufgrund der ethnischen Herkunft durchgeführt zu haben, was als diskriminierendes Racial Profiling gewertet wurde.
Wie rechtfertigte die Polizei ihr Vorgehen?
Die Polizei legitimierte die Kontrollen als notwendige Sicherheitsreaktion auf die massiven Übergriffe des Vorjahres (Silvester 2015/2016), um ähnliche Vorfälle zu verhindern.
Gibt es rechtliche Urteile zum Thema Racial Profiling in Deutschland?
Ja, die Arbeit führt beispielhaft ein Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz an, um die rechtliche Einordnung und die Unzulässigkeit von diskriminierenden Personenkontrollen zu verdeutlichen.
Welche Rolle spielt die Diversität für die Polizeiarbeit?
In einer immer diverser werdenden Gesellschaft ist die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit bei Polizeikontrollen essenziell, um das Vertrauen aller Bevölkerungsgruppen in die staatlichen Institutionen zu sichern.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Racial Profiling der Polizei in der Silvesternacht 2016/2017, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1045217