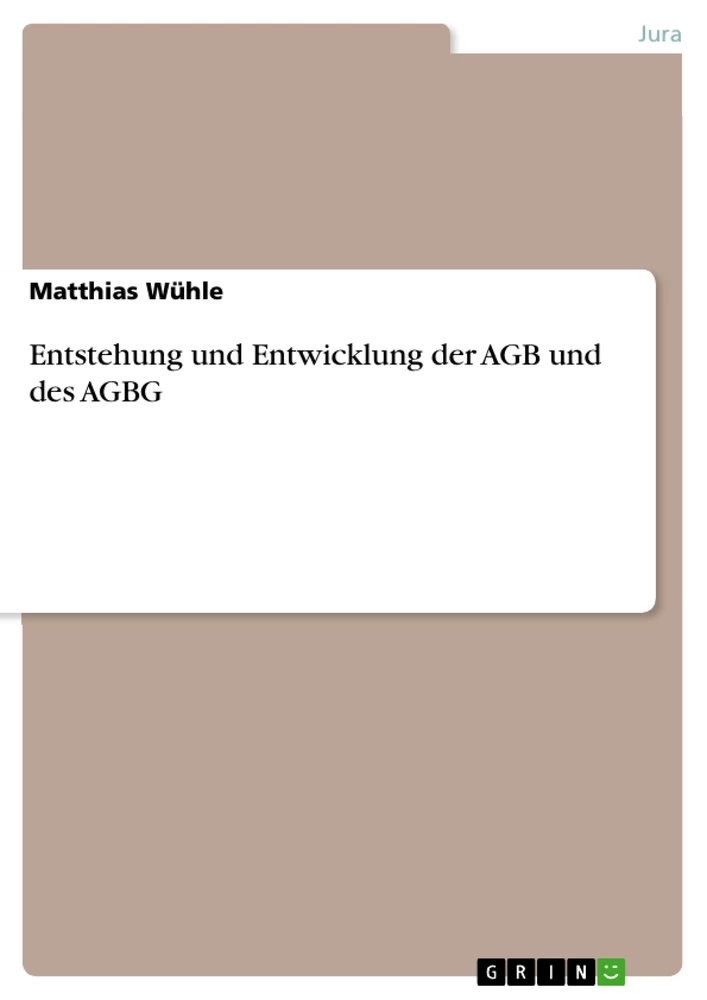1. Die Entstehung der AGB und Entwicklung des AGBG
1.1. Gründe, die zur Entstehung der AGB geführt haben
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzte ausgehend von Großbritannien auch in Deutschland die industrielle Revolution ein, die für Wissenschaft und Technik einen bis dahin nie gekannten Auftrieb bedeutet hat. In dieser Zeit wurden die Fundamente der heutigen Industriegesellschaft gelegt. Wesentliche Ausprägungsmerkmale waren unter anderem der Übergang von der Serien- zur Massenproduktion, sowie das Generieren zusätzlicher Konsumnachfrage, woraus sich eine massenhafte Nachfrage nach Konsumgütern entwickelte. Durch diese schnelle Entwicklung waren sehr bald die Grenzen des dispositiven Rechts erreicht. Vielfach produzierte, gleichartige Güter standen dem Wunsch einer gleichartigen und einheitlichen Vertragsabwicklung gegenüber. Ableitend daraus ergibt sich hiermit der erste Anspruch an die AGB: Der Rationalisierungseffekt.
Nicht nur die Massenproduktion war ein Ergebnis des wissenschaftlich- technischen Fortschritts, es bildeten sich auch in hohem Masse eine grosse Bandbreite von unterschiedlichsten Gütern und Dienstleistungen heraus, die noch Jahrzehnte zuvor unbekannt waren, zum Beispiel das Bank- oder Kreditwesen, das Versicherungswesen, oder gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch die Automobilindustrie. Diese neuartigen Güter und Dienstleistungen stellten auch rechtlich unterschiedliche Ansprüche an Verbraucher und Produzenten, die aus der besonderen Art und Eigenschaft des Gutes und der Leistung resultierten. Dazu kamen neue Vertriebs- und Finanzierungsformen, wie Ratenkauf, Versandhandel oder Leasing. Besonders die Branche des Versicherungswesens, deren wesentliche Dienstleistung in der Absicherung von Risiken besteht, brachte eine weitere Anforderung an die AGB hervor: Die Kalkulierbarkeit des Geschäftsrisikos. Dies ist auch der Grund, weshalb die Versicherungsindustrie als erstes AGB verwendete.
Aus dem Grund der Herausbildung unterschiedlicher Branchen erwuchs auch die Notwendigkeit, allgemein gehaltenes dispositives Recht durch speziell auf die Branche zugeschnittenes Recht zu ersetzen. Wenn zum Beispiel in den AGB eines Möbelkaufhauses Abweichungen in Struktur und Farbe des Möbelstückes oder die Verpflichtung zur Gewährleistung einer geeigneten LKW-Zufahrt verankert sind, so sind dies speziell auf das Gut Möbel und die Vertriebsart Versand zugeschnittene Bedingungen, die für dieses Unternehmen elementar sind, aber zu speziell, um im dispositiven Recht Erwähnug zu finden. Somit ergibt sich hier eine dritte Anforderung an die AGB, die der Verankerung von detaillierten Spezialregelungen.
Schließlich mußte eine sich rasch entwickelnde Industriegesellschaft zwangsläufig mit dem schwerfälligen Gesetz nonkonform gehen, weshalb das allgemeingültige Recht immer häufiger überfordert war, und der richterlichen Auslegung bedurfte. Viel einfacher würde es hingegen sein, wenn man die Bedingungen eines Kaufvertrages in kurzen Abständen ändern könnte, ohne auf eine Gesetzesnovelle warten zu müssen. Hier offenbart sich die vierte Anforderung an die BGB: Die der Möglichkeit einer raschen Anpassung.
Ich fasse aus der Entwicklungsgeschichte die 4 Anforderungen zusammen, die zur Anwendung der AGB geführt haben:
1. Rationalisierung von Vertragsregelungen
2. Kalkulierbarkeit des Geschäftsrisikos
3. Berücksichtigung detaillierter Spezialregelungen
4. Berücksichtigung einer raschen Anpassung
Ausgehend von dem Grundsatz der Privatautonomie, aus dem auch die Vertragsabschlussfreiheit hervorgeht, wäre es problematisch, Kaufverträge mit einem zusätzlichen Normengeflecht zu überziehen und an die Bestimmungen von Gesetzen zu knüpfen. Aus diesem Grund stellen die AGB keine Rechtsnorm dar, sondern werden erst entsprechend § 2 AGBG erst durch die Einbeziehung bei konkreten Vertragsschluß wirksam.
1.2. Gründe, die zur Entstehung des AGBG geführt haben
Diese Vielzahl von Forderungen, die die Wirtschaft an Vertragsabwicklungen geknüpft hat, hat sich die Wirtschaft schliesslich selbst konsequenterweise erfüllt: Ab ca. 1850 begannen vor allem Banken, Kreditinstitute, Versicherungen und später auch Verkehrsunternehmen AGB in ihre Verträge mit einzubeziehen. Ab 1880 folgte dann die Automobilindustrie.
Der Wirtschaftswissenschaftler Grossmann-Doerth bezeichnet deshalb die AGB als “Selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft” in seiner gleichnamigen, 1933 erschienenen Publikation Diese Entwicklung schien unter dem Aspekt der Vertragsabschlußfreiheit zunächst unbedenklich. Schließlich hatte der Vertragspartner des Verwenders die Möglichkeit, bei Nichtakzeptanz auf Vertragsschluß zu verzichten.
Ab 1896 bot das neu geschaffene BGB eine weitere, wichtige Möglichkeit der Einflußnahme. Die Rechtssprechung hatte somit eine neue Grundlage, die der rasanten Entwicklung gewachsen schien.
Die Richter hatten nun z.B. mit § 138 BGB eine Anspruchsgrundlage gegen AGB zur Hand, denen des Wuchers oder Sittenwidrigkeit verdächtigte.
Auch § 242 BGB verpflichtete AGB-Inhalte zur Leistung nach Treu und Glauben.
Eine Übervorteilung der Verbraucher sollte also stets ausgeschlossen werden und das BGB war ein modernes Instrument zur Regelung der AGB.
Mit einem weiteren Schub der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann das BGB jedoch immer mehr Lücken in der Rechtssprechung aufzuweisen. Die wichtigsten Kritikpunkte waren zum einen eine sich herausbildende Uneinheitlichkeit der Rechtssprechung durch unterschiedliche Gesetzesauslegung der Amtsrichter, sowie ein Fehlen von gesetzlichen und inhaltsbezogenen Massstäben. Besonders eine wachsende Ausbreitung von immer komplexeren Vertragsinhalten, die aus immer neuen Produk- und Dienstleistungsformen, Vertragsformen und Vertriebswegen resultierten, warfen immer neue Fragen auf, die allein durch das BGB nicht ausreichend geklärt werden konnten.
Schließlich wurden zum ersten Mal auch Rufe nach den Rechten der Verbraucher laut, die hauptsächlich die Vertragspartner der AGB-Verwender sind, und der Verbraucherschutz wurde zu einem neuen und wichtigen wirtschaftspolitischen Argumentationsinstrument.
Unter dem Aspekt des Verbraucherschutzes ist schliesslich kritisch zu betrachten, daß die AGB als vom Verwender vorformulierte Vertragsbedingungen letztendlich auch den Verwender selbst zur überlegenen Verhandlungsmacht werden lässt.
Während der Verwender die AGB unter langjähriger juristischer Erfahrung von einer Kommission ausarbeiten lassen kann, fehlen dem Vertragspartner des Verwenders bei Vertragsabschluß zum Einen ebendiese juristische Erfahrung und zum Zweiten die Zeit, um sich über eventuelle Risiken aufklären zu können. Drittens kommt hinzu, daß dem Verbraucher oft die Möglichkeit fehlt, bei Nichtakzeptanz der AGB den Vertragspartner zu wechseln.
Aus diesem einseitigen Interessensbezug, dem aus den Möglichkeiten des BGB nur ein unzureichender Ausgleich gegenüberstand, erwuchs die Herausforderung an die Rechtsordnung, im Sinne des allgemein geltenden Grundsatzes von Gerechtigkeit und Ausgleich, ein Instrument zur Regulierung der AGB zu schaffen, mit dem der Verbraucher ausreichend vor Übervorteilung geschützt werden sollte.
1972 wurde deshalb eine Arbeitsgruppe vom Bundesminister für Justiz mit der Aufgabe betraut, ein eigenes Gesetz zur Regulierung der AGB zu entwerfen. 4 Jahre später wurde als Ergebnis das AGBG mit der Zustimmung aller Bundestagsfraktionen verabschiedet und trat letztendlich am 01.04.1977 in Kraft.
Der Umstand, daß Vertragsabschlüsse an AGB gebunden sind, und diese wiederum durch das AGBG beschränkt werden, bedeutet aber nicht zwangsläufig eine Einschränkung der Privatautonomie bzw.
Vertragsabschlußfreiheit: Bewußt hat der Gesetzgeber im AGBG auf vorgegebene AGB-Inhaltsbestandteile verzichtet und stattdessen das Prinzip der Klauselverbote angewandt, durch die lediglich alle Arten der Benachteiligung ausgeschlossen werden sollen.
Halten sich die Verwender beim Formulieren der AGB an diese Klauselverbote, so stehen Phantasie und Kreativität auch weiterhin nichts im Wege. Der Grundsatz der Vertragsabschlussfreiheit behält somit auch weiterhin noch Gültigkeit.
Verwendete Literatur:
Häufig gestellte Fragen
Was führte zur Entstehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)?
Die AGB entstanden als Reaktion auf die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert. Die Massenproduktion, die Entwicklung neuer Güter und Dienstleistungen (Banken, Versicherungen, Automobilindustrie) sowie neue Vertriebs- und Finanzierungsformen (Ratenkauf, Versandhandel, Leasing) erforderten eine Rationalisierung der Vertragsregelungen, die Kalkulierbarkeit des Geschäftsrisikos, die Berücksichtigung detaillierter Spezialregelungen und die Möglichkeit einer raschen Anpassung.
Welche Anforderungen wurden an die AGB gestellt?
Die Hauptanforderungen an die AGB waren:
- Rationalisierung von Vertragsregelungen
- Kalkulierbarkeit des Geschäftsrisikos
- Berücksichtigung detaillierter Spezialregelungen
- Berücksichtigung einer raschen Anpassung
Warum wurde das AGB-Gesetz (AGBG) eingeführt?
Das AGBG wurde eingeführt, um die Verbraucher vor Übervorteilung durch einseitige Vertragsbedingungen zu schützen. Das BGB bot nicht ausreichend Schutz, und es gab eine wachsende Uneinheitlichkeit in der Rechtssprechung. Der Verbraucherschutz wurde ein wichtiges Argument, da die AGB oft von juristisch erfahrenen Unternehmen formuliert wurden, während Verbrauchern die nötige Erfahrung und Zeit fehlte, um die Risiken vollständig zu verstehen.
Was waren die Kritikpunkte am BGB im Hinblick auf AGB?
Die Hauptkritikpunkte am BGB waren: Uneinheitlichkeit der Rechtssprechung, das Fehlen von gesetzlichen und inhaltsbezogenen Massstäben, und die Unfähigkeit, mit der Komplexität neuer Vertragsinhalte und Vertriebswege umzugehen. Außerdem wurde der Verbraucherschutz als unzureichend angesehen.
Wie hat das AGBG die Vertragsabschlussfreiheit beeinflusst?
Das AGBG schränkte die Vertragsabschlussfreiheit nicht zwangsläufig ein. Der Gesetzgeber verzichtete auf vorgegebene AGB-Inhaltsbestandteile und wandte stattdessen das Prinzip der Klauselverbote an. Solange die Verwender sich an diese Klauselverbote hielten, waren ihrer Phantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der Grundsatz der Vertragsabschlussfreiheit behielt somit Gültigkeit.
Welche Rolle spielt der Verbraucherschutz bei AGB?
Der Verbraucherschutz spielt eine zentrale Rolle bei AGB. Da AGB vom Verwender vorformulierte Vertragsbedingungen sind, kann der Verwender eine überlegene Verhandlungsmacht erlangen. Das AGBG soll sicherstellen, dass Verbraucher ausreichend vor Benachteiligungen geschützt werden.
Was waren die wichtigsten Einflüsse bei der Entstehung des AGBG?
Die wichtigsten Einflüsse waren:
- Die Notwendigkeit, Verbraucher vor Übervorteilung zu schützen.
- Die zunehmende Kritik an der uneinheitlichen Rechtsprechung und dem Fehlen klarer gesetzlicher Maßstäbe.
- Die wachsende Komplexität der Vertragsinhalte durch neue Produkte, Dienstleistungen und Vertriebswege.
Wann trat das AGBG in Kraft?
Das AGBG trat am 01. April 1977 in Kraft.
- Quote paper
- Matthias Wühle (Author), 2001, Entstehung und Entwicklung der AGB und des AGBG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104639