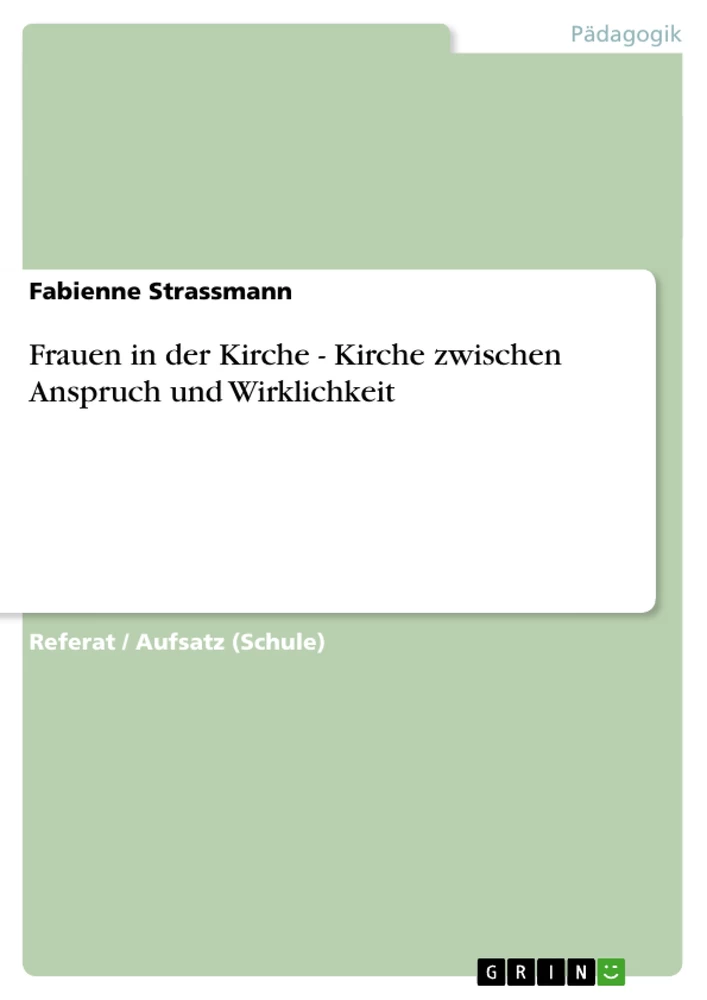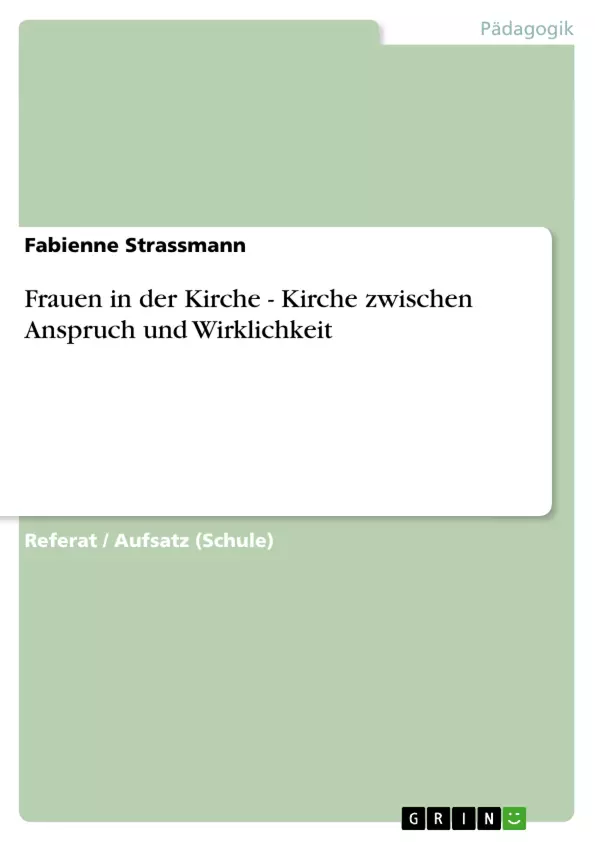1) Eingrenzung des Themas
Zu dem übergeordneten Thema "Kirche zwischen Anspruch und Wirklichkeit" werde ich den Aspekt der Frauen in der Kirche - mit Schwerpunkt in der katholischen Kirche- in Deutschland näher untersuchen. Da dieses Thema immer noch ein zu umfangreiches für das Ausmaß der Arbeit ist, grenze ich es ein auf die Zeit der Neuen Frauenbewegung (ab ca.1960).
2) Anspruch und Wirklichkeit
2.1. Anspruch von Kirche - allgemein
Der Anspruch der Kirche ist es, ihre Werte und Normen wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit aller Menschen usw. zu vermitteln. Einer ihrer Grundsätze ist es, die Sehnsüchte der Menschen (gewollt sein, angenommen zu sein, Zukunft zu haben) ernstzunehmen. Zu diesem Zweck gibt es in der Kirche Antworten auf wissenschaftlich (noch) unerklärliche Fragen (z.B. Theodicee) und dadurch bietet sie Sicherheit und Orientierung oder spendet Trost.
Kirche versucht also, Hilfebedürftigen die Hilfe in allen Bereichen zukommen zu lassen, die sie benötigen.
2.2. Wie wird dieser Anspruch Frauen gegenüber eingelöst ?
Leider muss man feststellen, dass Kirche viele dieser Grundprinzipien auf Frauen nicht anwendet. Im Laufe der Frauenforschung (vgl. 5.2) wurde immer deutlicher, dass Kirche eine zutiefst patriarchalische, hierarchische Struktur hat.
Wenn man jeden oben genannten Aspekt in Bezug zu der Frauenproblematik stellt, wird deutlich, was ich meine:
- Gerechtigkeit: es ist mit Sicherheit nicht gerecht, Frauen aufgrund ihres Geschlechts auf das Amt der Hausfrau und Mutter (als einzige Alternative der Ordensfrau) festzulegen und ihnen andere Ämter in der Kirche vorzuenthalten. (was allerdings in vergangenen Jahren schon leicht relativiert wurde)
- Gleichwertigkeit: Gleichwertigkeit würde auch gleiche Rechte beinhalten. Die sind der Frau in der Hierarchie der Kirche aber nicht gegeben.
- Sehnsüchte: Wie sollen sich Frauen gewollt und angenommen fühlen, wenn sie allein in der Struktur der Institution Kirche offensichtlich als unfähig angesehen werden?
Auf der Auftaktveranstaltung 1983 zum Marsch der Frauen nach Brüssel haben die Frauen anläßlich des Papstbesuches in Polen angemahnt: "Und auch er hat viel von Menschenrechten gesprochen, aber gleiches Recht für Frauen hat er nicht gefordert !"1
- Orientierung: Die Orientierung für Frauen in der Kirche ist doch äußerst eingeschränkt, wenn sie sich kaum bestätigt und ernstgenommen fühlen. Es ist kein Wunder, dass viele Frauen im Zuge der Frauenbewegung der Kirche den Rücken zugewandt haben und ausgetreten sind. Dieses Problem ist nicht allein auf die Säkularisierung zurückzuführen.
- Hilfe: Ein Schritt der Kirche auf die Frauen zu, hätte solche Enttäuschung wie im oben genannten Zitat vielleicht verhindert. Unterstützung der kämpfenden Frauen, die ja nur ihre Recht endlich eingeklagt haben (was nach der christlichen Lehre eigentlich sowieso eine Selbstverständlichkeit wäre), gab es offensichtlich nicht.
3) Wie die Kirche versucht, ihren Ansprüchen gerecht zu werden oder wie sie ihre Stellung begründet (exemplarische Darstellung)
3.1. Bibelauslegung
Forderungen der Frauenbewegung bzw. der feministischen Theologie (vgl. 5.2) werden mit androzentrischen Bibelauslegungen zurückgewiesen. Zum Beispiel in Bezug auf das Priestertum der Frau hielt sich neben den offensichtlich wenig reflektierten Argumenten der Kirchenmänner (durch das Weib kam die Sünde in die Welt; die Frau wurde als zweite erschaffen; die Frau ist nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen)2 das Argument, es sei nicht Jesus Absicht gewesen, Frauenpriestertum zuzulassen, da er nur seine Apostel , mit Petrus als Anführer, zu diesem Amt zugelassen habe. Hier wird ein Faktum- nämlich Jesu Auswahl der Apostel- als allgemeingültiger Fakt gewertet, auf den die Diskriminierung der Frauen in Kirchenämtern zurückgeführt wird. Nie hat sich aber jemand der kirchlichen Geschichtsforscher bemüht herauszufinden, unter welchen Voraussetzungen ausschließlich Männer als seine engsten Vertrauten zur Verfügung standen- vielleicht war das gar keine bewußt geschlechtsspezifische Auswahl, sondern eher eine zufällige, auf ganz anderen Ursachen beruhende.
3.2.Tradition
Auch hier kann man die Diskussion mit der Feministischen Theologie am Beispiel des Frauenpriestertums darstellen: Laut Verfechtern der bestehenden Situation gab es noch nie Frauen im Priesteramt. Die Argumentationsweise an sich bedarf hier meiner Meinung nach schon gar keines Gegenargumentes mehr. Nur weil etwas 2000 Jahre lang praktiziert wurde, heißt das noch lange nicht, dass es auch gut war.
Außerdem gab es (laut einiger Exegeten) innerhalb der Apostelgeschichte sehr wohl Frauen in einem solchen Amt.
3.3 Kirchendogmen
Priester handeln, als ob in ihrem Tun Christi selber handelt. Da Jesus ein Mann war, könne auch nur ein Mann ihn nun vertreten.
Selbst wenn man davon ausgeht, dass Priester wirklich "In Persona Christi" handeln, kann man dieses mit dem Galaterbrief 3,28 widerlegen, indem es heißt: "Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus".
3.4 Angst vor Vermännlichung der Frauen
Bei diesem Aspekt beziehe ich mich nicht auf das Frauenpriestertum, sondern auf eine Rede des Papst Paul VI. zum Thema "Rolle der Frau in Gesellschaft und Kirche".
In dieser Rede erwähnt der Papst zwar die grundsätzliche Gleichheit von Frau und Mann (vgl. Punkt 2), schränkt sie aber immer wieder ein in Berufung auf geschlechtsspezifische Unterschiede, die bestehen bleiben müssen, um die Persönlichkeit aufrechtzuerhalten. So sagt er z.B.: "Die Gleichberechtigung darf nicht zu einer egalitären und unpersönlichen Einebnung führen... Das Ergebnis wäre unangebrachte Vermännlichung oder aber Persönlichkeitsverlust. Heutzutage (1976) geht es vor allem darum, zu einer zu einer immer größeren und engeren Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen in Gesellschaft und Kirche zu gelangen, damit sie alle mit ihren besonderen Reichtümern und schöpferischen Kräften zum Aufbau einer Welt beitragen..."3
In wieweit die Befürchtung des Papstes und anderer Männer der Vermännlichung von emanzipierten Frauen nicht eher auf die Bewahrung männlicher Privilegien zielt, lasse ich hier mal offen. Ich denke nur, dass in dieser Argumentationsweise das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Durch die Gleichberechtigung der Frau in allen Aspekten, ist noch nicht das Ende vermeintlich weiblicher "Reichtümer" eingeläutet, eher sehe ich durch den Wegfall der starren geschlechtsspezifischen Fixierung eine Chance auf eine reichere, vielfältigere Verschiedenheit der Menschen.
Wovor diese Männer also eigentlich Angst haben ist mir nicht begreifbar und ihnen vielleicht auch nicht?!
4) Folgen dieser Argumentationen für Frauen
Die Folgen dieser 2000 Jahre alten Tradition des Patriarchalismus und Androzentrismus sind leicht erkennbar: Die immerwährende Diskriminierung der Frau aufgrund ihres Geschlechts, also Sexismus und Benachteiligung; die Reduzierung der Frau auf sogenannte weibliche Werte und Ziele (Harmonie u.ä.); Vereinnahmung ihrer Person durch vom Papst aber auch sonst in der Kirche betonte besondere Berufung zur Hausfrau und Mutter; Isolation in Haus und Familie; Ausschluss von Verantwortung in politischen und sozialen Bereichen. Diese Beschränkung weiblichen Wirkens war/ ist aber nicht nur für die Frauen nachteilig- die ganze Gesellschaft müsste - und tut es auch- auf die gewaltigen Ressourcen der Frauen verzichten.
Aus alledem kann man nur schwer deuten, was Frauen selber davon mittlerweile schon als "gottgegeben" hinnehmen und ob und in wieweit das noch oder wieder zu verändern ist. ( z.B. die offensichtlich andere Haltung vieler Frauen gegenüber Machtstrukturen und Probleme mit der Einforderung eigener Machtpositionen)
Es gibt Stimmen, die aus dieser Situation heraus behaupten, die Frauen müssten sich einer "Mittäterschaft" anklagen, weil sie ihre Diskriminierung duldeten.4
Diese Argumentation empfinde ich aber als sehr oberflächlich.
5) Möglichkeiten zur Auflösung dieses Widerspruchs (Anspruch und Wirklichkeit in der Kirche) →Feministische Theologie
5.1. Definition der Feministischen Theologie
Der Begriff "Feministische Theologie" ist an sich nicht klar definiert. Es gibt verschiedene Definitionen, die alle die Feministische Theologie auf andere Weise erklären:
Eine Umschreibung ist, dass Feministische Theologie sich im besonderen mit dem Verhältnis zwischen Mann und Frau beschäftigt und dieses theologisch erklären will. Ihre Aufgabe ist es dann, bestehende Strukturen und fixierte Muster aufgrund einer an den oben genannten (Punkt 3) Werten festhaltenden Kultur zu untersuchen und dann zu korrigieren.
Eine andere Vorstellung ist, dass die Feministische Theologie aus der Erkenntnis von Frauen, dass sie immer noch in der bestehenden Glaubenslehre benachteiligt werden, dadurch, dass eben ihre in der Bibel festgeschriebene Gleichberechtigung in der Kirche nicht berücksichtigt wird. Ihre Aufgabe oder ihr Ziel ist es, die Glaubenslehre und die Theologie neu zu formulieren.
Wieder andere verstehen die Feministische Theologie als eine kontextuelle Theologie, was bedeutet, dass sie die Geschichte und die Gegenwart in einen Zusammenhang stellt. Dadurch erhält die Geschichte eine besondere Dimension. Ziel der Theologie ist es aber auch, neben der Geschichtsforschung die Komplexität der heutigen Situation zum Ausdruck zu bringen. Die schon erwähnten Wesensmerkmale der Geschlechter spielen keine Rolle mehr. Durch das Wegfallen der "Wesensbetrachtung" steigt die Individualität. Es gilt nicht mehr das Kriterium Mann/Frau, sondern z.B. gutmütig oder böswillig. Diese Definition ist eine sehr allgemeine, sie ist eigentlich allgemeingültig für jede Art der Befreiungstheologie.
Eine wieder andere und relativ häufig verwandte Definition ist die der Genitiv-Theologie. Was vereinfacht so viel heißt, wie: Theologie von Frauen für Frauen.
Frauen erleben subjektiv eigene Glaubenserfahrung. Also weg von der Frage "für wen hält man mich?" hin zu "Wer bin ich?" . Sie wünschen, sich selbst zu definieren.5
Genitiv-Theologie kann aber auch bedeuten, dass Frauen sich objektiv, z.B. durch Bearbeitung von Schriften, mit ihrer Situation auseinandersetzen. Frauen, die sich dieser Definition anschließen, können über diese Erfahrungen (Bedeutung ihres Menschseins, Einschränkung durch die Strukturen...)sicher gut reflektieren.
Die wahrscheinlich berühmteste Feministin und politische Theologin, Dorothee Sölle, die sich unter anderem auch mit dieser Definition identifizieren konnte, hat einmal geschrieben:
"Die Schwierigkeiten mit dem Vater, Erzeuger, Machthaber und Lenker der Geschichte wurden vertieft, als ich genauer zu verstehen lernte, was es bedeutet, als Frau geboren zu sein, verstümmelt also, und zu leben in einer patriarchalischen Gesellschaft. Wie könnte ich wollen, daß Macht die zentrale Kategorie meines Lebens wird, wie könnte ich einen Gott verehren, der nicht mehr ist, als ein Mann. Mit männlicher Macht assoziiere ich Dinge wie: brüllen können, Befehle geben, sich im Schießen ausbilden. Ich glaube nicht, daß ich besonders, mehr als andere Frauen, von der patriarchalischen Kultur beschädigt bin. Es ist mir nur immer klarer geworden, daß jede Identifikation mit dem Aggressor, mit dem Machthaber, mit dem Vergewaltiger das furchtbarste Unglück ist, das einer Frau zustoßen kann."6
(Dieses Zitat verdeutlicht auch, was ich mit der Bemerkung vom Verhältnis von Frauen zu Macht unter Punkt 4 ausdrücken wollte.) Ich denke, an diesem Beispiel wird die Reflexion über subjektives Empfinden deutlich. Aber auch inhaltlich werde ich auf dieses Zitat sicherlich noch einmal zurückkommen.
Die letzte Definition stellt die Feministische Theologie in einen direkten Zusammenhang mit einer Befreiungstheologie. Meiner Meinung nach ist sie die zutreffendste, da sie die kompletteste ist. Sie beinhaltet sowohl die Loslösung von den "Wesenseigenschaften" hin zu den historischen Erfahrungen von Frauen, subjektiv und objektiv, als auch eine Mischung aus ideologischen Ansätzen und konkreten Zielen. Sie ist also ganzheitliche Theologie. Auch historisch betrachtet ist sie zutreffend. Da Feministische Theologie aus Befreiungsbewegungen entstanden ist. (Vgl.5.2.) Allgemein, und das ist jetzt die Überleitung zum nächsten Unterpunkt, betrifft die Feministische Theologie also alle, die unfrei und zum Objekt gemacht sind, aber letzten Endes wird ihr immer wieder bewußt, dass selbst in anderen unterdrückten Gruppen die Frauen die Unterdrückten der Unterdrückten sind.
5.2 Warum und wie ist Feministische Theologie entstanden?
Feministische Theologie ist eine Reaktion und ein Protest gegen eine jahrhundertelange einseitige Theologie. (vgl. Zitat unter Punkt 5.1.) Es geht um Glaubensreflexion, also darum, dass Frauen sich empfänglich und kritisch nicht nur mit ihrer Rolle in Kirche, sondern auch mit der christlichen Lehre, sprich der Bibel, auseinandersetzen und kritisch eine Auswahl treffen zwischen den patriarchalischen Texten, in denen es um die Minderwertigkeit der Frau geht und denjenigen, die die Gleichberech- tigung der Frau als Gottes Wille fordern. Es geht darum, die unter Punkt 4 beschriebenen Mißstände zu beseitigen und die Kirche auch dazu zu bringen, wissenschaftliche Erkenntnisse (z.B., dass der Mann nicht zuerst dagewesen sein kann, was in meinen Augen aber sowieso nebensächlich ist) zu akzeptieren, Strukturen - wie das Kirchenrecht, das trotz Veränderungen nicht weniger frauenfeindlich ist- zu verändern, so dass die Frau nicht länger als zweitrangig angesehen werden kann.
Der Aufbruch der Frauen begann fußend auf den Befreiungsbewegungen in Amerika , griff aber schnell auch auf Europa über.
Die sozialen und religiösen Erfahrungen in Amerika sind nicht unmittelbar auf Deutschland bzw.
Europa übertragbar, so dass das Verständnis von Feministischer Theologie in Deutschland ein anderes sein muß. Zwar gab es auch in Europa Befreiungsbewegungen -aus denen die Feministische Theologie ja letztendlich entstand-, aber ihre Motivationen fußten nicht auf dem christlichen Glauben und sie gingen nicht davon aus, daß die Bibel "das Muster der Erfahrung eines befreienden Handelns"7 abgibt.
Auch die politische Theologie, die sich bei uns entwickelte, kümmerte sich nicht oder kaum um das Problem des Sexismus, was immer wieder Grund für Vorwürfe von amerikanischer Seite war. Dort gründete sich in den späten Sechzigern eine Frauenbewegung, die dadurch etabliert war, dass Frauen die Verflechtung ihrer Probleme mit den damals (und zum Teil noch heute) brisanten Themen wie Vietnam, Rassendiskriminierung u.a. erkannten. Auch Zorn und Entrüstung waren dabei ihre Triebfedern. In diesem Zusammenhang ist es erklärlich, dass feministische Theologinnen sogenannte antifeministische Äußerungen aus der christlichen Tradition ohne Berücksichtigung des Kontextes und ohne Besinnung auf wissenschaftliche Methoden agitatorisch benutzten, was ihnen -meiner Meinung nach berechtigt- häufig zum Vorwurf gemacht wurde. Zorn und Entrüstung können Anlass sein, wissenschaftliches Forschen auszulösen. Spätestens dann jedoch sind Emotionen unzuträglich. So entwickelten sich zwei Richtungen Feministischer Theologie: zum einen die 'Women studies in Theology" und zum anderen die sozial- religiöse eher ideologisierende Bewegung.
Damit ist die Brücke zu Deutschland geschlagen, wo es ebenfalls diese Strömungen Feministischer Theologie gab: die sozial- religiöse Bewegung und die wissenschaftlich forschende, deren Ziel das "Entlarven des philosophisch-theologischen Systems der Diskriminierung"8 war und die die Stellung der Frau in Bezug auf alte biblische und historische Auslegungen bzw. Befunde anzweifelten und dieses auch wissenschaftlich beweisen wollten.
Zur Verdeutlichung der Problematik der unzulänglichen Auswertung historischer Quellen möchte ich als Beispiel die deutsche Feministin Marielouise Janssen-Jurreit zitieren, die in ihrem Buch "Sexismus" in dem Kapitel: "Die Geschichtslosigkeit der Frau wird durch die Geschichtsschreibung hergestellt" unter anderem auf das Werk von Golo Mann hinweist. Dieser -selbst Sohn einer Feministin- hat z.B. in seinen Bänden "Deutsche Geschichte des 19. Und 20. Jahrhundert" gerade mal drei Frauen dieser Epoche erwähnt und das in einem Fall auch nur mit einem Nebensatz.
Hier besteht also unbedingt die Notwendigkeit, die Geschichte bzw. historische Quellen erneut zu bearbeiten, um die Unterschlagung der Frauen in der Geschichtsschreibung aufzudecken.
Gleiches gilt für die Theologie. Geschichtlich ist noch lange nicht alles über die Rolle und das Leben der Frau im Christentum vorbehaltlos beleuchtet worden.
Die Feministische Theologie in dieser Strömung in den sechziger Jahren hat also auch den Grundstein für eine Frauenforschung -eingegliedert in eine Emanzipationsbewegung- gelegt.
Die Beschreibung der Geschichte der Feministischen Theologie in Deutschland möchte ich beginnen zum Zeitpunkt des zweiten Vatikanischen Konzils von 1962 bis 1965. Dieses veranlaßte erstmals europäische, katholische Frauen, ihre Unterdrückung in bestehenden Machtstrukturen der katholischen Kirche aufzuzeigen und Forderungen zur Gleichberechtigung zu stellen. In der Schrift "Gaudium et spes"9 ist diese Forderung durchaus unterstützt worden (z.B. wurde die "wissenschaftliche" Festschreibung von der Berufung der Frau als Ehefrau und Mutter -und Ordensfrau als einzige Alternative- endgültig theologisch widerlegt), jedoch immer mit der Einschränkung, die "Eigenart" der Frauen zu wahren. In wieweit diese Eigenart eine Diskriminierung doch wieder zulässt, bleibt offen. Dieser Konziltext bezieht sich außerdem nur auf Frauen in der Gesellschaft. Dass das auch Auswirkungen auf die Rolle der Frau in der Kirche haben könnte, gesteht sich die Kirche nur in Bezug auf das Laienapostolat ein. So wurden die Frauen auf der Ebene der Laiinnen den Männern gleichgestellt. KritikerInnen mahnten an, dass zwar die Stellung der Laien (also der Theologen ohne Amt) aufgewertet wird, nicht aber die Ausschaltung von Frauen problematisiert wird, so dass diese sich als ewige Laiinnen mit dem immer noch minderen Rang begnügen müssen.
Die immerwährende Diskussion ums Frauenpriestertum und um Frauen in leitenden Positionen des kirchlichen Bereichs wurde damit endlich öffentlich. Dadurch wurde immer mehr Kritik an der Kirche laut. Sie sei veränderungsunwillig und der allgemeine Konsens, die Kirche hätte mit den Ergebnissen dieses Konzils einen tatsächlichen Fortschritt gemacht, wurde angezweifelt.
Engagierte Frauen ließen sich jedoch nicht entmutigen. Entscheidende neue Impulse für die Feministische Theologie lieferte die Neue Frauenbewegung, die sich in Zusammenhang mit der Studentenbewegung (um 1968) gründete. Nach und nach bildeten sich in den zunächst klar abgegrenzten Foren - säkulare Frauenbewegung und Feministische Theologie- eine grosse Themenvielfalt und ein breites Spektrum an Aktionen. Bis dato tabuisierte Themen wie Mißhandlungen in der Familie, Vergewaltigung mit vertauschten Opfer/Täter- Rollen, Belastung bei Kindererziehung (alleinerziehende Frauen), Angst und Hilflosigkeit im Beruf u.v.m. werden in Frauenselbsthilfegruppen bzw. in Frauenseelsorge thematisiert und an die Öffentlichkeit getragen. Es entstehen zunehmend eigene Räume ausschließlich für Frauen, wie z.B. Frauenzentren, Frauenhäuser, aber auch Buchläden, Beratungsstellen, Gesundheitszentren. Vor allen Dingen entwickelten sich verstärkt Bildungsprogramme für Frauen. Aus solchen Aktivitäten entstanden Ideale wie Schwesterlichkeit und Solidarität. (Die Bandbreite feministischer Themen bürgte aber auch Schwierigkeiten, auf sie ich unter Punkt 5.5 noch zu sprechen kommen werde.)
Die Arbeit in der Neuen Frauenbewegung war gekennzeichnet durch ihr Theorie- Praxis- Verständnis: subjektive Betroffenheit bildeten den Ausgangspunkt; ihre Aufarbeitung und die anschließende Integration in die Analyse von Machtstrukturen.
Kurzum: Frauen erhielten oder erarbeiteten sich ein neues Selbstbewußtsein und sie verstanden sich nun "quer zu den herrschenden Erklärungsmustern als unterdrückte Gruppe, die durch Ablehnung der traditionellen Verhaltensformen und durch die Formulierung alternativer Ziele und Handlungsweisen eine Chance für Selbstbefreiung hat."10 Theologisch- religiöse Themen hatten in der Neuen Frauenbewegung überhaupt keinen Platz. Nachdem frauenfeindliche Strukturen erforscht und die Kirche und das Christentum als Hochburg des Patriarchalismus entlarvt war, war für viele dieser Frauen die einzige Alternative der Austritt aus Kirche und Religion.
Ab etwa 1982 jedoch wurden diese Gräben zwischen säkularen und innerkirchlichen Bewegungen durch Initiativen zum Aufbau von Kommunikationsstrukturen beseitigt, da Feministinnen auf der einen Seite erkannten, dass sie die Hilfe von christlichen Antworten benötigen z.B. in den Frauenhäusern oder auf der anderen Seite erkannten Theologinnen, dass der Frauenstandpunkt in der Theologie und auch in Freidens- oder Dritte- Welt- Arbeit nicht thematisiert wurde. Auf diese Weise fingen die Frauen an, gegenseitig voneinander zu profitieren. Dorothee Sölle umschrieb diesen Zustand mit den Worten: "Unsere Identität ist dort, wo wir noch nie waren"11. Im folgenden versuchten sich die Frauen zu strukturieren und von der Vorstellung loszukommen, sie müssten zu einer homogenen Masse zusammenwachsen. Es gab auch innerhalb der Feministischen Theologie immer schon unterschiedliche Schwerpunktthemen und daraus resultierende Gruppen, die ebenfalls klar abgegrenzt waren. Das wichtigste Ziel der einen war das Prespyterat für Frauen, anderen erschien dieses bloß als ein untergeordnetes Ziel und sie strebten eine andere Bibelauslegung an. Außerdem entwickelten Frauengruppen eine sogenannte feministische Spiritualität, aus der erst in den letzten Jahren (um 1996) das Ideal einer ökofeministischen Spiritualität12 erwuchs. Die Idee, dass man für das Überleben der Schöpfung eine andere Spiritualität (Willen) braucht, als die jetzige, männlich herrschende.
5.3. Ziele der Feministischen Theologie und der Neuen Frauenbewegung
Ein Ziel ist es, her(r)kömmliche Theologie und kirchliche Praxis methodisch zu revidieren und umzuformen. Um also bestehende (Personal-)Strukturen und auch das Selbstwertgefühl von Frauen zu verändern, werden tiefgreifende Veränderungen auf der Ebene der Bilder und Denkweisen notwendig sein. Wie sollen sich z.B. Frauen gleichberechtigt fühlen, wenn Gott immer mit dem Bilde des Vaters, also einem männlichen und damit "Unterdrücker", assoziiert wird. Man kann sich Gott nur in antromorphen Bildern vorstellen, damit ist auch gesagt, dass keines dieser Symbole Absolutheitsanspruch ( wie es das des "Vaters" oftmals tut) erheben kann.13 Das ist aber nicht die einzige Ebene (innerhalb der Prozeßtheologie), auf der Veränderungen vorgenommen werden müssen. Auch die Ebene der Begriffe und der Sprache muß sich verändern. Der allwissende Gott soll ersetzt werden durch einen Gott, dessen Verhältnis zu Menschen auf Gegenseitigkeit beruht. Die Veränderung der Sprache hängt eng mit der Veränderung von Bildern zusammen. Sie soll sensibler und mehr umschreibend werden.
Feministische Theologie will die Scheidung, Polarisierung und Degradierung zwischen den Geschlechtern aufheben :"...dadurch, daß sie Frauen zu Personen heranreifen läßt, die sich selbst definieren; dadurch, daß sie die Strukturen humanisiert und sie befreit von den harten, konkurrierenden Zügen"14
Feministische Theologie muß sich mit anderen Befreiungstheologien auseinandersetzen, um gegenseitige Erfahrungen im Kampf um Veränderungen auszutauschen und neue Impulse zu bekommen ( wie z.B. die Erweiterung der feministischen- zu einer ökofeministischen Theologie). Konkretere Ziele der Feministischen Theologie sind unter anderem die aktive Mitbestimmung von Frauen in der umstrittenen Frage der Abtreibung, Vertretungen von Frauen in allen Entscheidungsgremien der Kirche (Pfarr-, Diözesan-, National-, und Weltebene), Abschaffung des Amtszölibats und Einführung des Presbyterats für Frauen.
5.4. Warum ist die Feministische Theologie heute noch wichtig ?
Wenn man sich die Ziele der Feministischen Theologie unter Punkt 5.3. ansieht, stellt man fest, dass auch heute noch lange nicht alle erreicht sind. Die Gleichberechtigung der Frau in der Institution Kirche ist in der Praxis noch nicht durchgesetzt. Der Schritt zur Einflussnahme der Frau auf Kirchenbasis ist halbwegs geschafft, jetzt geht es darum, ihnen auch Verantwortung zu übertragen. Was sie bis jetzt geschafft hat, ist lediglich, dass eine Diskussion um die Themen eingesetzt hat. Der Aufschrei der Frauen gegen den Papst, als er deutschen Bischöfen verboten hat Frauen "den Schein" auszustellen, der sie zu einer Abtreibung berechtigte, ist eindrucksvolles Beispiel. Die Frauen haben wenigstens für sich ein anderes Selbstbewußtsein erlangt, frei und gleichberechtigt ihre Meinung zu sagen, dass das bis jetzt noch nichts wirklich greifbares erreicht hat, ist hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit.
5.5 Schwierigkeiten der Feministischen Theologie
Von aussen: Die grundsätzliche Gleichberechtigung der Frau, die laut dem zweiten vatikanischen Konzil wie erwähnt festgestellt wurde hatte leider nicht zur Folge, dass auch alle Universitäten - vor allen Dingen nicht die katholisch- theologischen Fakultäten - den Frauen ihre Tore öffneten. Es regierte (und regiert immer noch?!) eine männliche Hierarchie! Wissenschaftliche Arbeit zur Behebung des beschriebenen Defizits in der Geschichtsschreibung und anderen theologischen Themen war also nicht möglich und somit war die Möglichkeit wissenschaftlich fundierte Kritik zu üben (was ja zumindest der Feministische Theologie die ich beschrieben habe ein wichtiger Grundsatz war) den Frauen zunächst verwehrt oder sehr erschwert.
Durch ein bestehendes Kommunikationsgefälle zwischen Universität und Kirchengemeinden und durch die Geschlossenheit des kirchlichen Raums, die die Aufnahme dieses progressiven Gedankenguts verhindert wurden die Emanzipationsbestrebungen der Theologinnen nicht wahrgenommen.
Feministische Theologinnen mußten oft den Preis der finanziellen Not in Kauf nehmen, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren: Gemeindereferentinnen wurde nahegelegt, ihren Beruf zu wechseln, Religionslehrerinnen wurden auf ihre Einstellung überprüft und unerwünschte Forschungsergebnisse wurden nicht publiziert.
Von innen: Die inneren Probleme der Feministischen Theologie waren weitaus komplexer.
Die Frage nach dem Verhältnis von Abhängigkeit und Unabhängigkeit stand häufig im Zentrum der Diskussion. Ist Unabhängigkeit das neue Maß aller Dinge für Frauen oder gehören Abhängigkeiten einfach zum "Geschaffensein"? Inwieweit führt Unabhängigkeit zur Isolation oder Oberflächlichkeit? usw. Oft endete dieser Balanceakt zwischen Seperation und Teilhabe beim "In-der-Luft-hängen". Wenn die Frauen diese Fragen für sich beantwortet haben und entscheiden sich zu engagieren, stellen sie bald fest, dass der Prozeß der Veränderung nur sehr langsam vorangeht und Frustration breitet sich aus.
Eine andere Hürde, die viele Frauen ebenfalls in Konflikt bringt, ist die, dass sie aus ihrer Rolle ausbrechen müssen und -auf christlicher Ebene- das verinnerlichte Ideal der tugendhaft- unschuldigen Maria relativieren müssen. Dieses beinhaltet nämlich eine in meinen Augen falsche Demutshaltung der Frau, die dadurch so harmoniesüchtig ist, dass sie ihre eigne Produktivität aufgibt und keine Konflikte austrägt.
Lucie Stapenhorst hat diesen Gedanken und die Forderung nach der schon unter Punkt 5.3. genannten Veränderung des Gottesbildes in der Kirche so formuliert: "Warum, Mutter (Kirche), kannst du deine Kinder nicht erwachsen werden lassen? Du bist keine Mutter, die ins Leben begleitet. Du willst uns in Abhängigkeit und Infantilismus halten. Warum, Mutter Kirche? Du ließest mich nicht selbst suchen und finden. Du hieltest alle Antworten schon parat, bevor ich die Fragen fand, und ich hatte sie nur noch als die meinen nachzubeten. Du beharrtest auf striktem Gehorsam, als ich längst eigene Verantwortung übernehmen konnte. Du hältst es nicht aus, wenn deine Kinder ihre Gedanken denken. Es ist nicht übertriebene Muttersorge, die uns die Verbote diktiert,- es ist nichts als nacktes Machtstreben, was dich reglementieren und uniformieren läßt. Diese Erfahrung war ernüchternd."15 Feministinnen kämpfen darum, dass in der Gesellschaft nicht weiter der Fehler gemacht wird, Feminismus mit einer Scheinbefreiung zu verwechseln, die dazu führte, dass die Frau sich mit dem Mann vergleicht und versucht, ihm zu ähneln, weil sie ihr Anderssein nicht akzeptiert (so als ob sie die eigene Unterlegenheit akzeptiere) bzw. die Gradwanderung zwischen dem Anderssein und trotzdem der Gleichberechtigung zu beherrschen.
Die erwähnten Abgrenzungen zwischen der säkularen und der kirchlichen Frauenbewegung und auch die innerhalb der Feministischen Theologie kamen daher, dass Frauen ihre Anliegen und Methoden als so unterschiedlich empfunden haben, dass sie das Selbstverständnis einer Gruppe häufig nur durch Gegenüberstellung mit einer kontrastierender anderer Positionen verdeutlicht werden konnten. Ein Profitieren der Gruppen voneinander war damit selbstverständlich nicht mehr gegeben. Besonders brisant wurde diese Situation, wenn Vertreterinnen der einen Gruppe die Rechtgläubigkeit einer anderen bezweifelten und damit versuchten in christliche und nicht christliche Feministische Theologinnen zu spalten.
Real existierende Unterschiede, z.B. in Bezug auf den Ausbildungsstatus, wurden zunächst versucht zu beseitigen, um die hierarchischen Strukturen abbauen zu können. Daraus entstand aber längst keine konkurrenzlose Schwesterlichkeit. Die gesellschaftlichen Positionen waren niemals so unterschiedlich wie zu diesem Zeitpunkt. Also mussten die Frauen lernen, ihre Unterschiedlichkeit zu respektieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Die sich durch diese Verschiedenheit auch ergebenden Konkurrenzsituationen wurden lange nicht thematisiert, da (wie schon erwähnt) Macht und Machtstreben für Frauen und insbesondere für Theologinnen tabuisierte Themen waren (vgl. Dorothee Sölle unter Punkt 5.1.), da sie sie in der Geschichte immer in Zusammenhang mit Machtmissbrauch erfahren hat, die ihre Selbstbestimmung verhinderte oder einschränkte. Daraus resultierte die sogenannte "psychologische Hemmung" , die Macht in Zusammenhang mit dem Aufzwingen eines fremden Willens bringt und auch die "idealistische Hemmung", die die Macht zu einem per se unerwünschten Phänomen macht. Da Macht aber notwendig ist, um sich zu organisiern, müssen Frauen lernen, besser mit ihr umzugehen, also einen Missbrauch nicht zu dulden.
6) Interviews
Um einen aktuelleren und praktischen Aspekt in meine Arbeit einfließen zu lassen, habe ich mit zwei Frauen ein Interview geführt, die zwei unterschiedliche Standpunkte vertreten. Eine ist sehr engagiert in der katholischen Kirche, die andere ist vor ca. zehn Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die Beweggründe für ihre Entscheidung möchte ich hier sinngemäß wiedergeben.
Übergeordnetes Argument der engagierten "Vertreterin" der Kirche war, dass sie ihre Kirche, die in der Bibel und der Tradition wurzelt, liebt. Das hieße zwar nicht, dass es keine Kritikpunkte für sie gäbe, wohl aber, dass diese in den Hintergrund treten gegenüber dem Positiven, was sie in ihrer Gemeinde erlebe. Sie habe, seit sie sich aktiv auch in der Pfarrgemeinde engagiert, noch nie eine Diskriminierung ihrer Person erlebt. Zwar müsse man die Männer hin und wieder daran erinnern, dass es die Frauen auch noch gibt, aber sie seien dann auch einsichtig.
Im übrigen müsse man sowieso zunächst das Schreckensbild der katholischen Kirche, dass in der Öffentlichkeit durch die Medien propagiert wird, relativieren, da diese häufig falsch und reißerisch zitieren würden. Sie habe zum Beispiel noch nie die angeblich so strenge Hierarchie in der Katholischen Kirche erfahren. Man könne sowohl mit Bischöfen als auch mit dem Papst ganz normal über vermeintlich tabuisierte Fragen (Hildesheimer Synode) diskutieren und würde dabei sicherlich auf offene Ohren stoßen.
Deswegen sei sie auch nicht einer Meinung mit den Frauen, die im Zuge der neuen Frauenbewegung sofort ihre Gleichberechtigung in sämtlichen Bereichen forderten. Man könne solch gravierende Änderungen nicht übers Knie brechen und auch in der Kirche, deren Stützpfeiler ja - wie erwähnt - auch die Tradition ist, sei man mit Geduld und Ausdauer (und weniger rebellischem Geist?!) erfolgreicher. Die Kirche bestünde eben auch nur aus Menschen und was 2000 Jahre lang gedacht wurde, liesse sich eben nicht so schnell umstossen.
Auch in Bezug auf das Frauenpriestertum stützt sie sich auf diese Argumentationsweise. Diese Frage sei ein schleichender innerkirchlicher Prozess, der aber nicht nach aussen getragen werden müsse. Aus Gesprächen wisse sie, dass Frauen, die wirklich Priesterinnen werden wollten, zwar zutiefst traurig über ihre Ohnmacht seien, nie aber dafür demonstrieren würden, allerdings nicht, weil das in der Kirche an sich tabuisiert sei, sondern weil es für diese Frauen einfach gar nicht in Frage käme.
Sie habe nicht das Gefühl, dass sie sich noch für die Rechte von Frauen in der katholischen Kirche (gesondert) einsetzen müsse, da sich vieles schon geändert habe . Zum Beispiel wird in der Sprache in Gottesdiensten oder anderen Verlesungen immer häufiger auch die weibliche Komponente erwähnt.
Insgesamt stünde es völlig ausser Frage, dass Frau und Mann nach der Bibel gleichberechtigt sind (Genesis) und das die Kirche diesen Grundsatz auch immer deutlicher vertrete, was man u.a. allein am Titel der Hildesheimer Diözesansynode -an der sie selbst mitgearbeitet hat- sehe: "Gemeinschaft mit Gott/ Miteinander/ Mit der Welt".
Meine zweite Gesprächspartnerin ist nicht ausschließlich wegen ihrer Situation als Frau in der katholischen Kirche aus eben dieser ausgetreten. Dieser Schritt war letztendlich die Konsequenz aus einer Summe von Bedingungen unter denen sie sich nicht mehr mit der Kirche identifizieren konnte. Als konkreter Anlass für den letzten Schritt war die Haltung der Kirche zur Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre. Schleichend hatte aber ein Prozess der Entfremdung schon lange stattgefunden. So stimmten schon lange nicht mehr die Werte des realen, gelebten Lebens mit den Traditionen und den als Dogmen empfundenen Werten der Kirche überein. Besonders hatte sie auch Schwierigkeiten in ihrer Rolle als Mutter diese Tradition weiterzugeben. Auch die Bevormundung in Sachen Geburtenkontrolle konnte sie nicht akzeptieren. Der Umgang der Amtskirche mit Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen mussten kam ihr verlogen und unredlich vor. Dass eine Kirche die Hälfte ihrer Mitglieder nicht ernstnimmt und gleichberechtigt und ihre persönliche Ohnmacht, dagegen etwas auszurichten haben ihre Entscheidung für den Austritt beschleunigt. Auch das Erleben von katholisch geprägtem Glauben in ihrer Kindheit hat sie eher verunsichert, als ihr Halt zu geben. Sie erinnert sich an das ständige Gefühl der Kontrolle ("der liebe Gott sieht alles") und des daraus resultierenden Sich- schuldig- fühlens so wie an den Zwang zur Beichte. Später kam das Verleugnen jeglicher Sexualität als weiterer Entfremdungsgrund hinzu.
Auch das Mitarbeit in der Kirche für sie immer nur ehrenamtlich soziale Arbeit seien sollte, konnte sie nicht akzeptieren. Gesprächskreise zur Situation der modernen Frau in der Kirche hat sie in ihrer Gemeinde nicht gefunden. Einen solchen Gesprächskreis fand sie dann aber in der evangelischen Kirchengemeinde ihrer Stadt. Trotzdem ist sie nach ihrem Austritt aus der katholischen Kirche nicht zum evangelischen Glauben konvertiert. Zu tief sitzt ihr Misstrauen gegenüber jeglicher Form von institutionalisierter Kirche.
7) Stellungnahme
Ich denke, für eine abschließende Stellungnahme ist es nach allem, was ich neu über die Frauenbewegung bzw. die Feministische Theologie gelernt habe, noch zu früh. Das wird erst möglich sein, wenn der Prozess der Emanzipation der Frauen fortgeschrittener ist.
Bis jetzt kann ich allerdings sagen, sympathisiere ich mit der von mir hier hauptsächlich dargestellten Art der Bewegung, in der es nicht um rein oberflächliche Auseinandersetzung mit dem Thema geht, nur weil es zu der Zeit gerade "in" war. Die Vorwürfe an die Kirche, die ich in Punkt 2.2 sicherlich provokant formuliert habe, sind meiner Ansicht nach immer noch berechtigt, auch wenn sich in den 30 Jahren schon einiges bewegt hat. Es ist eben ein sehr langwieriger Prozess, wenn man zweitausend Jahre Unterdrückung beseitigen will. Denn dazu muss man die Mentalität, das Unterbewusstsein der Menschen - besonders auch der Frauen- verändern. Ich glaube nämlich nicht, dass die Diskriminierung vornehmlich auf Vernunft begründeten Argumenten basiert, denn die kann man ja mittlerweile - wie am Beispiel des Presbyterats für Frauen gezeigt- sehr leicht widerlegen.
Ich finde es schade, dass viele Frauen sich heute nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Allgemein denken viele, es geht sie nichts mehr an, schließlich seien sie gleichberechtigt. Woher Frauen diese Überzeugung nehmen, ist mir ein Rätsel. Ich meine, der Anteil an Frauen in bestimmenden Positionen, ist doch sehr gering. Das kann man wohl kaum auf eine mindere Qualifikation schieben, eher ist es das Problem, sich mit männlichen Machtstrukturen abzufinden und sich sogar noch zu integrieren.
Auf kirchlicher Ebene ist von der großen Aufbruchstimmung nach dem zweiten Vatikanischen Konzil auch nicht viel geblieben. Der Hoffnungsschimmer auf Veränderung hat sich sehr bald im Sande verlaufen und das Thema Feministische Theologie wird kaum noch erwähnt. Das zeigt sich auch in der veröffentlichten Literatur zu dieser Thematik: in den letzten Jahren gab es nur wenige Publikationen. Die Frauen in der Kirche haben ihren eigenen Weg gefunden, mit der Diskriminierung umzugehen. Auch wenn das für viele katholische Ohren vielleicht übertrieben klingt (kann ich nicht beurteilen), muß ich für mich sagen, dass die Kirche - und die katholische unangefochten an der Spitze- ihrem Auftrag, nämlich die christliche Lehre zu verkünden, nicht nachkommt. Sie stellt sich gegen Gottes Wort. Diese 2000 Jahre lang betriebene "Sünde" vergeben zu lassen, müssen sie wohl noch sehr lange beichten.
Vielleicht, um diese harten Worte zu mildern, oder auch nur für besseres Verständnis, muss ich sagen, dass meine klare, unnachgiebige Meinung nicht nur aus tiefster Überzeugung, sondern auch aus einer großen Aggression stammt. Nun kann man mir vorwerfen, dass auch ich dann nicht zwischen Emotionen und Fakten unterscheiden kann, wie ich es selber unter Punkt 5.2 verurteilt habe; allerdings ist mein Ziel ja auch nicht das wissenschaftliche Widerlegen von überholten Vorstellungen, sondern hauptsächlich die Veränderung durch moralische Überzeugungsarbeit.
Insofern stimme ich weitestgehend auch nicht mit meiner ersten Interviewpartnerin überein. Ich bin nämlich sehr wohl der Meinung, dass noch viel in der Kirche getan werden muß und dass man auch mit tiefster religiöser Überzeugung seine Ziele oder seine Kritik durch Öffentlichmachen zum Ausdruck bringen darf oder sogar sollte. Was das Priesteramt der Frauen und die angeblich nicht mehr so stark vorhandene Hierarchie in der Kirche angeht, wäre es schön, wenn ich auch behaupten könnte, es wäre alles nur noch eine Frage der Zeit. Aber erstens werde ich das wohl nie können, wenn es keine Frauenbewegung in irgendeiner Form mehr gibt und zweitens schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt, wo man als "Außenstehender" noch kaum etwas von der angeblichen Veränderung merkt.
[...]
1 Uta Ranke-Heinemann: Widerworte. Friedensreden und Streitschriften. 1.Auflage Essen 1985 S.79
2 Vgl. Bernadette Brooten, Norbert Greinacher (Hrsg): Frauen in der Männerkirche. Mainz 1982 S.190
3 vgl. Volker Hochgrebe, Michaela Pilters (Hrsg.): Geteilter Schmerz der Unterdrückung. Frauenbefreiung im Christentum? 1. Auflage Stuttgart, 1984 S.73
4 vgl. z.B.: Andrea Schulenberg: Feministische Spiritualität: Exodus in eine befreiende Kirche? Stuttgart;Berlin;Köln 1993 S.43
5 vgl. Bernadette Brooten, Norbert Greinacher (Hrsg.): Frauen in der Männerkirche -München,1982 S. 161
6 Bernadette Brooten, Norbert Greinacher (Hrssg.): Frauen in der Männerkirche -München, 1982 S. 153
7 Elisabeth Gössmann: Die streitbaren Schwestern- Was will die feministische Theologie. Freiburg 1981. S.14
8 Christine Schaumberger, Monika Maaßen: Handbuch Feministische Theologie. Münster 1988. S.15
9 vgl. Volker Hochgrebe, Michaela Pilters: Geteilter Schmerz der Unterdrückung: Frauenbefreiung im Christentum?- 1. Auflage - Stuttgart, 1984 S.69f
10 Christine Schaumberger, Monika Maaßen: Handbuch Feministische Theologie -2. Auflage - Münster, 1988 S.17
11 Christine Schaumberger, Monika Maaß: Handbuch Feministische Thaeologie -2. Auflage -Münster, 1988
12 Dorothee Sölle, Luise Schottroff: Den Himmel erden- Eine ökofeministische Annäherung an die Bibel
2. Auflage -München, 1996
13 vgl. Dorothee Sölle: Vater, Macht und Barbarei- Feministische Anfragen an autoritäre Religion
14 Bernadette Brooten, Norbert Greinacher: Frauen in der Männerkirche -München, 1982
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Kirche zwischen Anspruch und Wirklichkeit" bezüglich Frauen in der katholischen Kirche?
Der Text untersucht kritisch die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Kirche, Werte wie Gleichheit und Gerechtigkeit zu vermitteln, und der Realität der Diskriminierung von Frauen, insbesondere in der katholischen Kirche Deutschlands ab ca. 1960 (der Zeit der Neuen Frauenbewegung).
Welche Kritikpunkte werden bezüglich der Behandlung von Frauen durch die Kirche vorgebracht?
Die Kirche wird kritisiert für ihre patriarchalischen Strukturen, die Frauen auf die Rolle der Hausfrau und Mutter beschränken, ihnen gleiche Rechte in der Hierarchie verweigern und ihre Sehnsüchte nach Akzeptanz und Gleichwertigkeit ignorieren. Es wird argumentiert, dass dies zu Enttäuschung und Abwendung von der Kirche führt.
Wie rechtfertigt die Kirche ihre Haltung gegenüber Frauen?
Die Kirche beruft sich auf androzentrische Bibelauslegungen, Traditionen und Kirchendogmen, um die Ungleichbehandlung von Frauen zu rechtfertigen. Beispielsweise wird die fehlende Zulassung von Frauen zum Priesteramt mit der Auswahl der männlichen Apostel Jesu begründet.
Welche Folgen hat diese Argumentation für Frauen?
Die Argumentation führt zu Sexismus, Benachteiligung, Reduzierung auf vermeintlich weibliche Werte, Vereinnahmung durch die Betonung der Rolle als Hausfrau und Mutter, Isolation und Ausschluss von Verantwortung in politischen und sozialen Bereichen.
Was ist feministische Theologie und wie ist sie entstanden?
Feministische Theologie ist eine Reaktion auf jahrhundertelange einseitige Theologie und eine Glaubensreflexion, die sich kritisch mit der Rolle der Frau in der Kirche und der christlichen Lehre auseinandersetzt. Sie entstand aus Befreiungsbewegungen und zielt darauf ab, patriarchalische Strukturen aufzudecken und zu verändern.
Welche Ziele verfolgt die feministische Theologie?
Zu den Zielen gehören die Revision herkömmlicher Theologie und kirchlicher Praxis, die Aufhebung der Polarisierung zwischen den Geschlechtern, die Auseinandersetzung mit anderen Befreiungstheologien und die aktive Mitbestimmung von Frauen in wichtigen Fragen wie Abtreibung und die Besetzung von Entscheidungsgremien.
Warum ist die feministische Theologie heute noch wichtig?
Die feministische Theologie ist weiterhin wichtig, da die Gleichberechtigung der Frau in der Institution Kirche noch nicht durchgesetzt ist und weiterhin Diskussionsbedarf besteht, um Verantwortung zu übertragen und Strukturen zu verändern.
Welche Schwierigkeiten hat die feministische Theologie zu bewältigen?
Die feministische Theologie hat mit externen Schwierigkeiten wie dem Widerstand männlicher Hierarchien und internen Schwierigkeiten wie der Frage nach Abhängigkeit und Unabhängigkeit sowie der Abgrenzung zwischen säkularen und kirchlichen Frauenbewegungen zu kämpfen.
Welche unterschiedlichen Standpunkte werden in den Interviews zu Frauen in der katholischen Kirche vertreten?
Ein Interviewpartnerin engagiert sich in der Kirche und sieht keine Diskriminierung, betont die Liebe zur Tradition und plädiert für Geduld bei Veränderungen. Die andere Interviewpartnerin ist ausgetreten, kritisiert die Bevormundung, die fehlende Gleichberechtigung und das Verleugnen von Sexualität durch die Kirche.
Wie lautet die abschließende Stellungnahme des Autors?
Der Autor sympathisiert mit der feministischen Bewegung, hält die Kritik an der Kirche für berechtigt und bedauert, dass sich viele Frauen heute nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Es wird betont, dass noch viel in der Kirche getan werden muss, um die Mentalität und das Unterbewusstsein der Menschen zu verändern.
- Citation du texte
- Fabienne Strassmann (Auteur), 1997, Frauen in der Kirche - Kirche zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104717