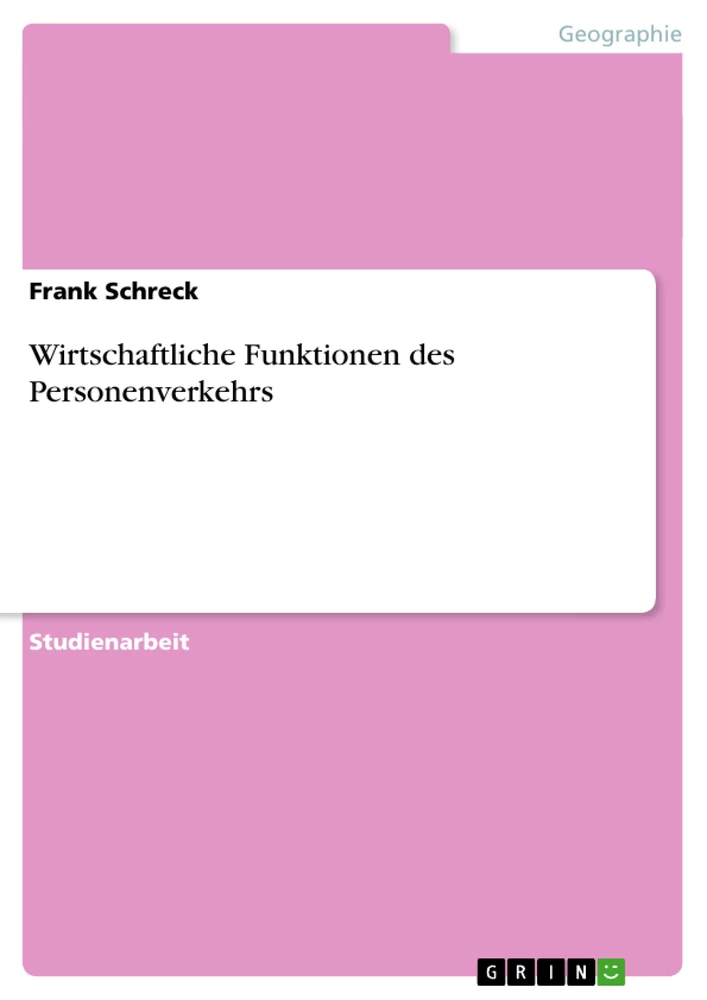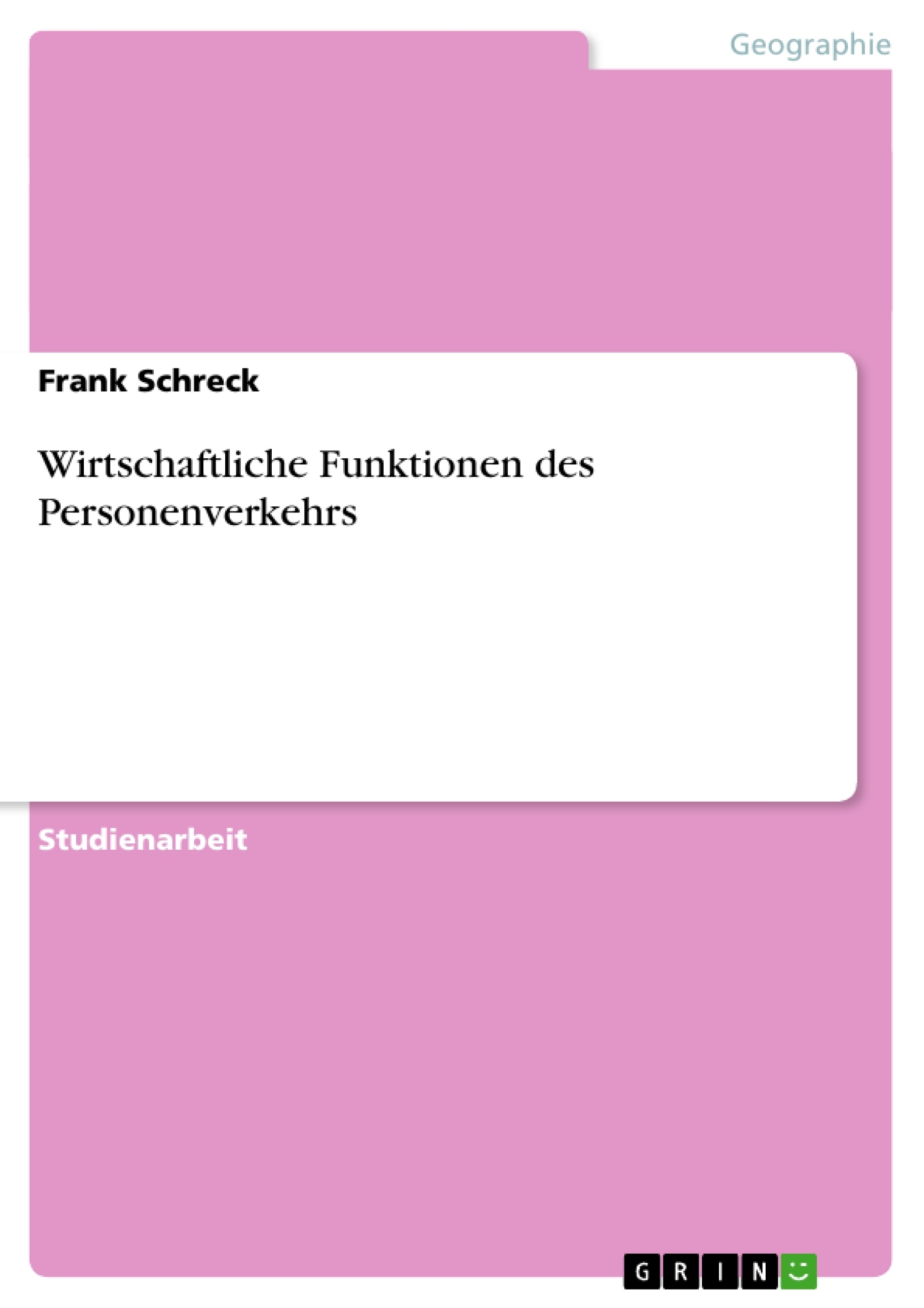Inhalt
1. Einleitung
2. Versuch der Definition der Dienstleistungsaufgaben des Verkehrs
2.1 Distanzüberwindung und Raumerschließung
2.1.1 erwerbs- und berufsorientierte Beförderungsleistungen
2.1.2 versorgungsorientierte Beförderungsleistungen
2.1.3 ausbildungsorientierte Beförderungsleistungen
2.1.4 freizeitorientierten Beförderungsleistungen
2.2 Raumwirksamkeit des Verkehrs
3. Der Personenverkehr im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Hand und privater Initiative
3.1 Aufgaben der öffentlichen Hand
3.2 Interessen der öffentlichen Hand
3.3 Kostendeckung - neue Wege mit Privaten
3.3.1 Interne Kosten
3.3.2 Externe Kosten
3.4 Steuerungsmöglichkeiten des Staates
4. Wirtschaftliche Potentiale ausgewählter Formen des Personenverkehrs
4.1 Fahrradverkehr
4.2 Regionalluftverkehr
5. Fazit
6. Literatur
1. Einleitung
Das Thema „wirtschaftliche Funktionen des Personenverkehrs“ legt durch seine semantische Konstruktion eine monodirektionale Betrachtungsweise des Personenverkehrs nahe. Doch die Existenz von Funktionen bedeutet auch immer, daß zwischen zwei Untersuchungsgegenständen eine Wechselwirkung1 existiert. Im folgenden soll also untersucht werden, ob eine wechselseitige Interaktion zwischen dem Verkehrsgeschehen und der Entwicklung der Wirtschaft besteht und in wie weit die Theorie auch Niederschlag in der Praxis findet.
2. Versuch der Definition der Dienstleistungsaufgaben des Verkehrs
„Ein funktionierendes Verkehrswesen ist Voraussetzung für alle wirtschaftlichen und darüber hinausgehenden räumlichen Betätigungen des Menschen.“2
Da Verkehr als Ortsveränderung von Personen, Gütern und Nachrichten, also als das Verbinden zweier Punkte (Quelle und Ziel) definiert ist3, liegt die Hauptleistung der Dienstleistungen des Verkehrs in der Ermöglichung der Überwindung der Distanz zwischen zwei Punkten, die somit zur Quelle und zum Ziel von Verkehr werden.
Besonderes Augenmerk ist in der Definition auf die Formulierung „Person“ zu richten, denn sie enthält eine Ambivalenz von beträchtlichem Ausmaß: Bei der Interpretation nach rechtlichen Gesichtspunkten muß damit eine Person im juristischen Sinn gemeint sein. Personen im juristischen Sinn sind:
1. Natürliche Personen (Individuen, die die privaten Haushalte bilden)
2. Juristische Personen (also Wirtschaftsunternehmen, Vereine, Stiftungen und Juristische Personen des öffentlichen Rechtes4).
Dies sind also die beiden Gruppen des Personenverkehrs, die die Dienstleistungen, welche durch die Verkehrssysteme5 bereitgestellt werden, in Anspruch nehmen. Entsprechend unterschiedlich sind die für die Nutzer hauptsächlich signifikanten Dienstleistungen, die die Verkehrssysteme erbringen. Während für Individuen die Überwindung einer konkret definierten Distanz als Leistung im Vordergrund steht, also die Erschließung des Raumes an sich, so ist für Körperschaften des öffentlichen Rechtes die Qualität der Erschließung des Raumes (entspricht der Raumwirksamkeit) ausschlaggebend.
2.1 Distanzüberwindung und Raumerschließung
„Die infrastrukturellen Voraussetzungen der Verkehrswege und Transportmittel ermöglichen die Distanzüberwindung von Personen [...].“6
Verkehr entsteht also auf Grundlage der räumlichen Aktionen der Verkehrsteilnehmer; er befriedigt das Bedürfnis, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen.
Er ist also nicht nur per se eine Grunddaseinsfunktion, sonden auch gleichzeitig die Grundlage für die Ausübung aller anderen Grundfunktionen menschlicher Daseinsäußerungen.
Entprechend lassen sich die Dienstleistungen, die vom Verkehr bereitgestellt werden müssen, nach der Intention des Nutzers gliedern in7 :
a) erwerbs- und berufsorientierte Beförderungsleistungen
b) versorgungsorientierte Beförderungsleistungen
c) ausbildungsorientierte Beförderungsleistungen
d) freizeitorientierten Beförderungsleistungen
Die einzelnen Bereiche wiederum unterscheiden sich nicht nur in ihrer quantitativen Ausprägung der Anteile am Gesamtverkehrsaufkommen, sondern auch in ihren qualitativen Anforderungen an die Versorgungsorientiert Ausbildungsorientiert Freizeitorientiert Sonstige
Verkehrssysteme. Abb. 1 verdeutlicht, daß sich die Anteile der spezifischen Arten der Beförderungs- leistungen im zeitlich- historischen Kontext nicht Eigene Darstellung. statisch verhalten und u.a. damit unterschiedliche Anforderungen an die Verkehrssysteme entstehen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Anteil der Fahrtzwecke am Gesamtpersonenverkehrsaufkommen 1976-82 in %. Quelle: MAIER, J. / ATZKERN, H.-D. (1992): Verkehrsgeographie. Stuttgart, Seite 23.
2.1.1 erwerbs- und berufsorientierte Beförderungsleistungen
Der Schwerpunkt bei den erwerbs- und berufsorientierten Beförderungsleistungen liegt hier infolge der Konzentration auf private Haushalte in erster Linie auf der Gruppe der Berufspendler und der durch sie stattfindenden verkehrsräumlichen Aktivitäten. Ihre Bedürfnisse sind aufgrund der Dauerhaftigkeit und des Umfangs am besten zu erfassen. Schwieriger meßbar dagegen sind Verkehrsbewegungen durch Erwerbsgruppen, die qualitativ und eventuell sogar quantiativ nur unregelmäßig stattfinden, wie das beispielsweise bei fahrenden Händlern oder im Dienstreiseverkehr und Geschäftsverkehr der Fall ist. Insgesamt stellen bei dem Typus der erwerbs-und berufsorientierten Beförderungsleistungen die Pendlerbewegungen den Großteil der Verkehrsaktivitäten dar - macht doch der Nahverkehr (bis 50 km Entfernung) 98 % (Bezugsjahr 1992) all dieser Wege aus8. Dabei nehmen der motorisierte Individualverkehr (MIV) und der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) mit durchschnittlich 65 % aller Wege eine überragende Rolle ein, auch wenn in den
Städten der Fußgänerverkehr klar dominiert (Abb. 2). Der Dienst- und Geschäftsreiseverkehr dagegen spielt mit durchschnittlich 7 % Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen nur im Fernverkehr mit durchschnittlich 12 %eine Rolle (Bezugszeitraum 1976-82). Er spielt somit eine wichtige Rolle im Schienenfernverkehr und im Flugverkehr.
Abb. 3: Jährlich gefahrene PKW-Km nach Verkehrszwecken.
Quelle: Kulke, E. (1994): Auswirkungen des Standortwandels im Einzelhandel auf den Verkehr. In: Geographische Rundschau46 (5), Seite 294.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Verkehrsmittelwahl nach Stadtgrößenklassen.
Quelle: MAIER, J. / ATZKERN, H.-D (1992):Verkehrsgeographie. Stuttgart, Seite 31. Eigene Darstellung.
2.1.2 versorgungsorientierte Beförderungsleistungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die versorgungsorientierten Beförderungsleistungen sind gekennzeichnet von weitaus geringerer Frequenz und Bindung an bestimmte Ziele als die erwerbs- und berufsbedingten, so daß sie an weniger statische Verkehrssysteme gebunden sind. Diese Tatsache wird bei einer hohen Motorisierung der Bevölkerung und gleichzeitigen Suburbanisierungsprozessen besonders deutlich, auch wenn man im Fall der Bundesrepublik Deutschland noch nicht von einer „Auflösung der Raumstruktur“9sprechen kann:
Bei einer Ausstattung von einem PKW auf 2,2 Personen (1992)und einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,3 Personen pro Haushalt (1987) kann man von einer Vollausstattung der deutschen Haushalte mit PKW als erfüllt ansehen10. Dies ermöglichte die Niederlassung von Einzelhandelsunternehmen an Standorten ohne Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Das wiederum hatte negative Auswirkungen auf die Versorgungslage im Nahbereich. Insgesamt entstand so eine Anhebung der durchschnittlichen Einkaufsdistanz und eine Vergrößerung des Gesamtverkehrsaufkommens des Einkaufsverkehrs, da nun (absolut) mehr Wege mit dem PKW bewältigt wurden (Abb.3).
2.1.3 ausbildungsorientierte Beförderungsleistungen
Das Aufkommen des bildungsorientierten Verkehrs liegt bei lediglich 10 % des Gesamtverkehrsvolumens und seine Verursacher sind zumeist minderjährig (sog. Fahrschüler). Dennoch kommt diesem Bereich insofern eine Sonderrolle zu, als daß die Verkehrsströme hier von besonderer Beständigkeit sind und meist die Verkehrsmittelwahl der Nutzer auf den öffentlichen Verkehr beschränkt ist. Die Bereitstellung der Beförderungsleistung ist deshalb ungewöhnlich gut planbar; dies bestätigen die in Abb. 4 dargestellten Beförderungszahlen11.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Beförderungszahlen von Schülern und Studenten im ÖPNV 1988,1990 -1992, 1996
Quelle: BMVBW(Hrsg.)(1999): Bericht der Bundesregierung über den ÖPNV in Deutschland nach Vollendung der deutschen Einheit, Seite 5. Eigene Darstellung.
2.1.4 freizeitorientierte Beförderungsleistungen
Das Verkehrsaufkommen des Freizeitverkehrs hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen (vgl. Abb. 3). Dabei spielen auch die verstärkte Wahrnehmung kurzfristiger Freizeitangebote im Nah- und Regionalbereich des Wohnstandortes in Zusammenhang mit der wachsendenVielfalt an Freizeitangeboten für unterschiedliche Personengruppen eine große Rolle.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Genauso wie aber die definitorische Abgrenzung des Begriffes „Freizeit“ Schwierigkeiten aufwirft, ist es u.U. unmöglich, eine begriffsscharfe Abgrenzung von freizeitorientierten Verkehrsaktivitäten und damit einer Konkretisierung der durch sie in Anspruch genommenen
Beförderungsleistungen zu finden. MAIER differenziert in diesem Zusammenhang nach Entfernung des Zieles, kommt dabei aber lediglich zu dem Ergebnis, daß Freizeitverkehr in jeder Entfernung (Stadt-, Nah-, Regional- und Fernverkehr) stattfindet 12.
Ein Ergebnis liefern hierbei Umfragen, die aus o.g. Gründen allerdings nur eine eingeschränkte Aussage machen können. Nichtsdestotrotz fällt auf, daß der Anteil der im Freizeitverkehr getätigten Wege einen ausgesprochen hohen Anteil am Gesamtindividualverkehr aufweist, MIV, Fahrrad- und Fußgängerverkehr bzw deren Verkehrssystemen hier die wichtigste Rolle zufällt (Abb. 5).
Abschließend zu diesem Punkt muß noch erwähnt werden, daß die Befriedigung des quantitativ (und qualitativ) steigenden Bedürfnisses nach Beförderungsleistungen sich nicht ausschließlich in einem höheren Verkehrsaufkommen, sondern auch in der ständigen Entwicklung und Einführung von innovativen Verkehrssystemen manifestiert.13 Eine Betrachtung der Entwicklung der durchschnittlichen Personenverkehrsmobilität (Abb. 6) verdeutlicht, daß das gestiegene und prognostizierte Befördeungsbedürfnis Motor dieses Zusammenhangs war und auch in Zukunft sein wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.6: Entwicklung der Personenverkehrsmobilität [in tkm / Jahr]. Quelle: NUHN, H: (1994): Verkehr und Kommunikation. In: KULKE, E. (Hrsg.) (1998): Wirtschaftsgeographie Deutschlands. Gotha / Stuttgart, Seite 204.
2.2 Raumwirksamkeit des Verkehrs
Die Träger wirtschaftlicher Aktivitäten, die privaten Haushalte, Wirtschaftsunternehmen und öffentliche Institutionen, suchen sich solche Standorte im Wirtschaftsraum, die für ihre wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten den höchsten ökonomischen Nutzen und die maximale gesellschaftliche Anerkennung in Aussicht stellen14 Einfluß auf den ökonomischen Nutzen eines Standortes hat der Verkehr, indem er durch eine möglichst umfangreiche Bereitstellung an Verkehrssystemen (d. h. an Verkehrswegen und –mitteln) den Aktionsradius des Akteurs vergrößert. Dies wiederum geschieht durch:
a) Zeitersparnis: die Reduzierung der zur Distanzüberwindung benötigten Zeit durch möglichst zeitsparende Verkehrssysteme.
b) Kostendeduktion: die Reduzierung der durch die Inanspruchnahme des Verkehrssystems entstehenden Kosten.
c) Verbesserung der Bequemlichkeit: die Bereitstellung möglichst bequem zu nutzender Verkehrssysteme.
Im konkreten Vollzug finden wirtschaftliche Interaktionen nicht an einem, sondern zwischen zwei Punkten statt, woraus sich aus den einzelnen Standorten Funktionsräume ergeben. Der innerhalb dieser Fuktionsräume existierende Austausch von Gütern, Dienstleistungen, Kaufkraft, Kapital, Arbeitskräften und technischem Wissen bildet die Basis des regionalen - und in der Summe dann gesamten - Wirtschaftswachstums 15.
[...]
1 WAGNER, H-G. (1998): Wirtschaftsgeographie. Braunschweig, Seite 20.
2 Vgl.: VOPPEL, G. (1999): Wirtschaftsgeographie: Räumliche Ordnung der Weltwirtschaft unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Stuttgart, Seite 118
3 Vgl.: NUHN, H. (1994): Verkehrsgeographie. Neuere Entwicklungen und Perspektiven für die Zukunft. In: Geographische Rundschau 46 (5),Seite 260.
4 KÖHLER, H. (Hrsg.) (1999): Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). München, Seite 6.
5 Verkehrssysteme bestehen aus Verkehrswegen und Verkehrsmitteln.
6 NUHN, H. (1998): Verkehr und Kommunikation. In: KULKE, E. (Hrsg.) (1998): Wirtschaftsgeographie Deutschlands. Gotha / Stuttgart, Seite 203.
7 Vgl.: MAIER, J. / Atzkern, H.-D. (1992):Verkehrsgeographie. Stuttgart, Seite 23.
8 Vgl.: MAIER, J. / ATZKERN, H.-D. (1992):Verkehrsgeographie. Stuttgart, Seite 31.
9 BUCHWALD, K. / ENGELHARDT, W. (1999): Umweltschutz: Grundlagen und Praxis. Bonn, Seite 9.
10 Vgl: KULKE, E. (1994): Auswirkungen des Standortwandels im Einzelhandel auf den Verkehr. In: Geographische Rundschau 46 (5). Seite 292.
11 BMVBW (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen) (Hrsg.) (1999):Bericht über den Öffentlichen Nahverkehr in der Fläche. Bonn, Seite 5.
12 Vgl.: MAIER, J. / Atzkern, H.-D. (1992):Verkehrsgeographie. Stuttgart, Seite 38.
13 Vgl.: VOPPEL, G. (1999): Wirtschaftsgeographie: Räumliche Ordnung der Weltwirtschaft unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Stuttgart, Seite 124.
14 Vgl: WAGNER, H-G. (1998): Wirtschaftsgeographie. Braunschweig, Seite 10. und OBERENDER, P. (1989): Marktstruktur und Wettbewerb in ausgewählten Branchen der Bundesrepublik Deutschland. München, Seite 5 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Wirtschaftliche Funktionen des Personenverkehrs"?
Der Text untersucht die wirtschaftlichen Funktionen des Personenverkehrs und analysiert die Wechselwirkungen zwischen Verkehrsgeschehen und Wirtschaftsentwicklung. Er beleuchtet, wie der Personenverkehr die Wirtschaft beeinflusst und umgekehrt.
Wie definiert der Text die Dienstleistungsaufgaben des Verkehrs?
Der Text definiert Verkehr als Ortsveränderung von Personen, Gütern und Nachrichten. Die Hauptleistung des Verkehrs liegt demnach in der Überwindung von Distanzen zwischen Ausgangspunkt und Ziel.
Welche Arten von Beförderungsleistungen werden unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen erwerbs- und berufsorientierten, versorgungsorientierten, ausbildungsorientierten und freizeitorientierten Beförderungsleistungen. Diese unterscheiden sich in ihren quantitativen Anteilen am Verkehrsaufkommen und in ihren qualitativen Anforderungen an die Verkehrssysteme.
Was sind erwerbs- und berufsorientierte Beförderungsleistungen?
Diese Kategorie umfasst vor allem die Pendlerbewegungen, die den Großteil der Verkehrsaktivitäten ausmachen. Der Nahverkehr spielt hier eine bedeutende Rolle.
Was sind versorgungsorientierte Beförderungsleistungen?
Diese Leistungen sind durch geringere Frequenz und Bindung an bestimmte Ziele gekennzeichnet. Die hohe Motorisierung und Suburbanisierungsprozesse beeinflussen diese Art von Beförderungsleistungen.
Was sind ausbildungsorientierte Beförderungsleistungen?
Obwohl ihr Anteil am Gesamtverkehrsvolumen gering ist, zeichnen sie sich durch Beständigkeit aus und sind meist auf öffentliche Verkehrsmittel beschränkt.
Was sind freizeitorientierte Beförderungsleistungen?
Der Freizeitverkehr hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, wobei sowohl kurzfristige Freizeitangebote im Nahbereich als auch vielfältige Angebote für verschiedene Personengruppen eine Rolle spielen. Hier spielt der Individualverkehr eine große Rolle.
Wie beeinflusst der Verkehr die Raumwirksamkeit?
Der Verkehr beeinflusst die Standortwahl wirtschaftlicher Akteure, indem er durch die Bereitstellung von Verkehrssystemen den Aktionsradius vergrößert. Dies geschieht durch Zeitersparnis, Kostendeduktion und Verbesserung der Bequemlichkeit. Der Austausch von Gütern, Dienstleistungen, Kaufkraft, Kapital, Arbeitskräften und technischem Wissen zwischen Standorten bildet die Basis des regionalen Wirtschaftswachstums.
Welche Rolle spielen interne und externe Kosten im Zusammenhang mit dem Personenverkehr?
Der Text erwähnt interne und externe Kosten, deutet jedoch an, dass diese im weiteren Verlauf des Textes diskutiert werden. Details zu diesen Kostenarten finden sich nicht im extrahierten Text.
Welche Rolle spielt der Staat bei der Steuerung des Personenverkehrs?
Der Text erwähnt Steuerungsmöglichkeiten des Staates im Kontext des Personenverkehrs, ohne jedoch Details zu nennen, wie diese Steuerung konkret aussieht.
Welche wirtschaftlichen Potenziale haben Fahrradverkehr und Regionalluftverkehr?
Der Text erwähnt diese beiden Verkehrsformen als ausgewählte Beispiele für wirtschaftliche Potenziale im Personenverkehr, ohne jedoch spezifische Details oder Analysen zu liefern.
- Citar trabajo
- Frank Schreck (Autor), 2000, Wirtschaftliche Funktionen des Personenverkehrs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/104742