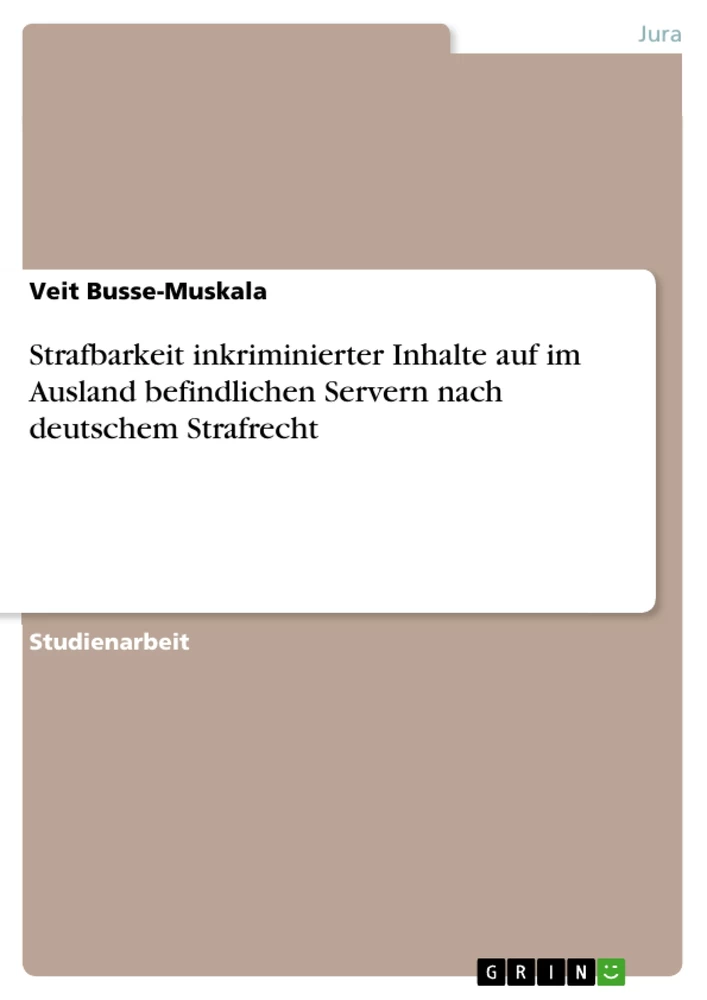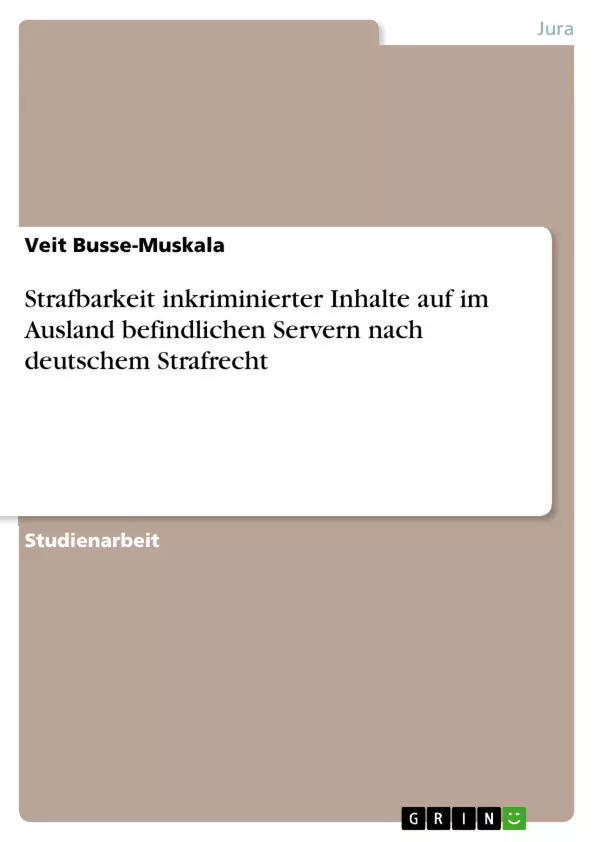Die zunehmend technische Vernetzung von Computern und die damit einhergehende exponentielle Ausbreitung der im Netz verfügbaren Informationen hat das Internet in jüngerer Vergangenheit zu dem Medium des Kommunikationszeitalters gemacht, mit dem der Einzelne sich nicht nur ein nahezu grenzenloses Informationsangebot erschließen sondern auch grenzüberschreitend weltweit kommunizieren kann.1 Dies eröffnet gesellschaftliche und wirtschaftliche Perspektiven von unüberschaubarem Ausmaß, es wirft zugleich bislang rechtlich ungeklärte bzw. umstrittene Fragen auf.2 Die Bedeutung des Internet wird mit der Zunahme von Computern in privaten Haushalten - bei sinkenden Preisen und vereinfachter Bedienbarkeit - künftig weiterhin stetig zunehmen. Allerdings sind mit dieser positiven Entwicklung auch weniger erfreuliche Begleiterscheinungen verbunden, da auch Straftäter die Möglichkeiten erkannt haben, die ihnen das Internet bietet. Das weltweite Datennetz ist ein Bereich, in dem die Einstellung strafbarer Inhalte durch nationale Gesetze nicht effizient verhindert oder geahndet werden kann, was einen nahezu unkontrollierbaren Informationsfluss ermöglicht. Welche strafrechtlichen Probleme hiermit verbunden sind, soll ein jüngst höchstrichterlich entschiedener Fall verdeutlichen.3 [1 Kenntnisse über Begriff, historische Entwicklung und Funktionsweise des Internet werden im Folgenden vorausgesetzt; näher dazu Kienle, Internationales Strafrecht und Straftaten im Internet, Seiten 4 - 27; Lehle, Der Erfolgsbegriff, Seiten 10-15; Römer, Verbreitungs- und Äußerungsdelikte, Seiten 21-36; 2 Sieber JZ 1996, 429; 3 BGH, Urteil v. 12. Dezember 2000 1 StR 184/00, Recherche vom 18.09.01: http://www.caselaw.de/caselaw.dll?DocumentShow&3144&none; s.a. NJW 2001, 624.]
Inhaltsverzeichnis
- A) Problemstellung, BGH Urteil vom 12.12.2000 - 1 StR 184/00
- I) Der Sachverhalt
- II) Das Problem
- B) Typische Straftaten im Internet
- I) einzelne Delikte und Beispiele
- 1) Delikte gegen die öffentliche Ordnung und staatsgefährdende Delikte
- a) Volksverhetzung (Auschwitzlüge) § 130.
- b) Verwenden von Kennzeichen Verfassungswidriger Organisationen und Verbreiten von Propagandamitteln §§ 86, 86 a
- c) öffentliche Aufforderung zu Straftaten § 111
- d) Anleitung zu Straftaten § 130 a
- e) öffentliche Billigung von Straftaten § 140 Nr. 2
- f) Gewaltdarstellung bzw. -verherrlichung § 131
- g) sonstige Staatsgefährdungsdelikte §§ 90 a I, 90 b, 129, 129 a
- 2) Delikte gegen die persönliche Ehre §§ 185 ff.
- 3) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, §§ 184 I, III
- 1) Delikte gegen die öffentliche Ordnung und staatsgefährdende Delikte
- II) Tatbestandsübergreifende Probleme - Versuch der Kategorisierung
- 1) Einteilung der Delikte anhand bestimmter Kriterien
- a) nach Beziehung zwischen Handlung und Erfolg
- aa) Erfolgsdelikte
- bb) schlichte Tätigkeitsdelikte
- b) nach Intensität der Beeinträchtigung des Schutzobjektes
- aa) Verletzungsdelikte
- bb) Gefährdungsdelikte
- a) konkrete Gefährdungsdelikte
- B) abstrakte Gefährdungsdelikte
- ?) potentielle Gefährdungsdelikte
- 2) Schriftenbegriff § 11 III
- 3) „Verbreiten“ und „zugänglich machen“ von strafbaren Inhalten
- a) nach Beziehung zwischen Handlung und Erfolg
- 1) Einteilung der Delikte anhand bestimmter Kriterien
- C) Anwendbarkeit deutschen Strafrechts - Strafverfolgungskompetenz
- I) Prinzipien des deutschen Internationalen Strafrechts
- 1) Territorialitätsprinzip
- 2) Flaggenprinzip
- 3) aktives Personalitätsprinzip
- 4) Schutzgrundsätze (Realprinzip, passives Personalitätsprinzip)
- 5) Weltrechtsgrundsatz (Universalprinzip).
- 6) Grundsatz der Stellvertretenden Strafrechtspflege
- 7) Ubiquitätsgrundsatz
- II) Der strafrechtliche Erfolgsbegriff.
- 1) Allgemeines
- 2) deliktsspezifische Erfolgsbestimmung
- a) Erfolgsdelikte, Verletzungs- und konkrete Gefährdungsdelikte
- b) Tätigkeitsdelikte, abstrakte und potentielle Gefährdungsdelikte
- aa) erfolgsbejahende Ansicht
- bb) Gegenansicht
- cc) vermittelnde Ansicht: „Tathandlungserfolg\"\ndd) Stellungnahme
- c) Zwischenergebnis
- 3) Konsequenz für die untersuchten Tatbestände
- III) Einschränkung des Ubiquitätsprinzips
- 1) subjektivierende Auslegung, teleologische Reduktion des § 9
- 2) Territoriale Spezifizierung
- 3) Anlehnung an § 7
- 4) geltende Regelungen § 17 StGB, Art.296 EGStGB, § 153 c II StPO
- 5) Beschränkung des Anwendungsbereichs de lege ferenda
- 6) Stellungnahme
- D) Ausblick
- E) Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage der Strafbarkeit inkriminierter Inhalte auf im Ausland befindlichen Servern nach deutschem Strafrecht.
- Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf Straftaten im Internet.
- Sie analysiert die verschiedenen Tatbestände, die im Zusammenhang mit inkriminierten Inhalten im Internet relevant sind.
- Die Arbeit beleuchtet die Prinzipien des internationalen Strafrechts und deren Anwendung auf den Bereich der Computer- und Datennetzkriminalität.
- Sie diskutiert die Problematik des strafrechtlichen Erfolgsbegriffs im Kontext von internetbasierten Straftaten.
- Schließlich werden die Möglichkeiten und Grenzen der Strafverfolgung im Internet betrachtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Problemstellung und analysiert das BGH-Urteil vom 12.12.2000 zum Thema der „Auschwitzlüge“ im Internet.
Das zweite Kapitel widmet sich der Beschreibung typischer Straftaten im Internet. Es werden verschiedene Delikte gegen die öffentliche Ordnung und staatsgefährdende Delikte, Delikte gegen die persönliche Ehre sowie Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf Straftaten im Internet. Es werden die relevanten Prinzipien des internationalen Strafrechts erläutert und die Problematik des Erfolgsbegriffs im Kontext von internetbasierten Straftaten diskutiert.
Das vierte Kapitel betrachtet die Einschränkung des Ubiquitätsprinzips im Kontext von internetbasierten Straftaten.
Schlüsselwörter
Computer- und Datennetzkriminalität, Strafbarkeit, inkriminierte Inhalte, internationales Strafrecht, Territorialitätsprinzip, Ubiquitätsgrundsatz, Erfolgsbegriff, Strafverfolgungskompetenz, Internet, Auslandsserver.
Häufig gestellte Fragen
Gilt deutsches Strafrecht für Inhalte auf ausländischen Servern?
Ja, nach dem Ubiquitätsprinzip (§ 9 StGB) kann deutsches Strafrecht anwendbar sein, wenn der Erfolg der Tat (z.B. der Abruf volksverhetzender Inhalte) im Inland eintritt.
Was entschied der BGH im Jahr 2000 zur „Auschwitzlüge“ im Internet?
Der BGH bestätigte, dass Volksverhetzung auch dann in Deutschland strafbar ist, wenn die Inhalte von einem ausländischen Server (z.B. in den USA) ins Netz gestellt wurden.
Was besagt das Territorialitätsprinzip?
Es besagt grundsätzlich, dass die Strafgewalt eines Staates auf Taten beschränkt ist, die auf seinem Staatsgebiet begangen wurden.
Wann ist ein Internet-Delikt ein Erfolgsdelikt?
Ein Delikt gilt als Erfolgsdelikt, wenn der Tatbestand den Eintritt einer messbaren Außenwirkung (z.B. Störung des öffentlichen Friedens) voraussetzt.
Können abstrakte Gefährdungsdelikte im Ausland verfolgt werden?
Dies ist rechtlich umstritten; die Arbeit diskutiert verschiedene Ansichten, ob bei reinen Tätigkeitsdelikten ohne konkreten Erfolg eine deutsche Strafgewalt besteht.
- I) Prinzipien des deutschen Internationalen Strafrechts
- I) einzelne Delikte und Beispiele
- Quote paper
- Dr. Veit Busse-Muskala (Author), 2002, Strafbarkeit inkriminierter Inhalte auf im Ausland befindlichen Servern nach deutschem Strafrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10506