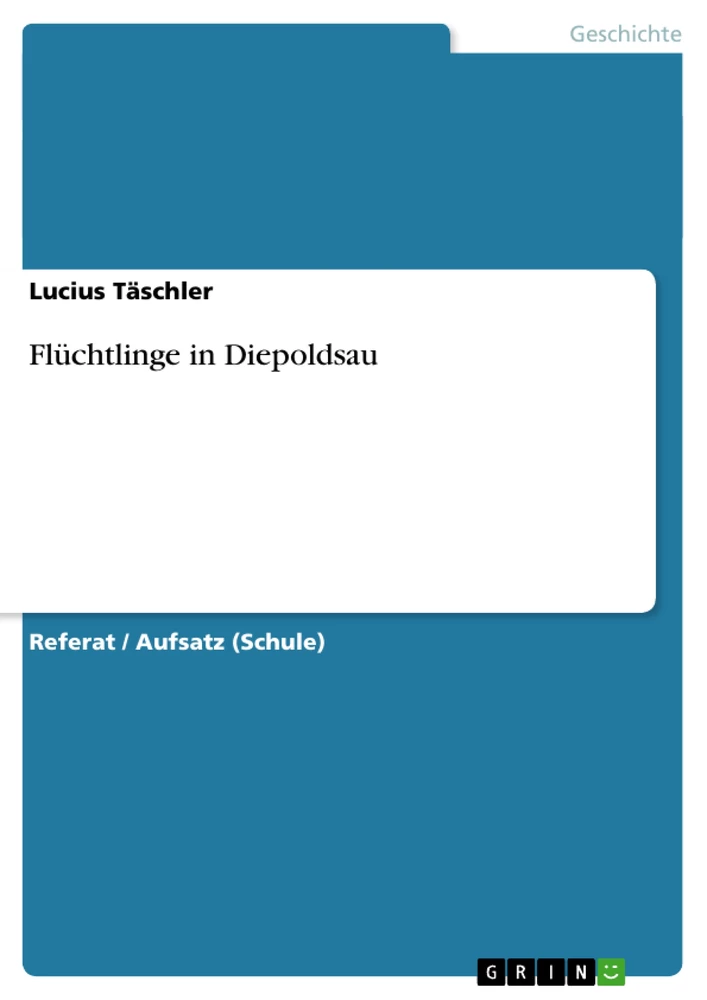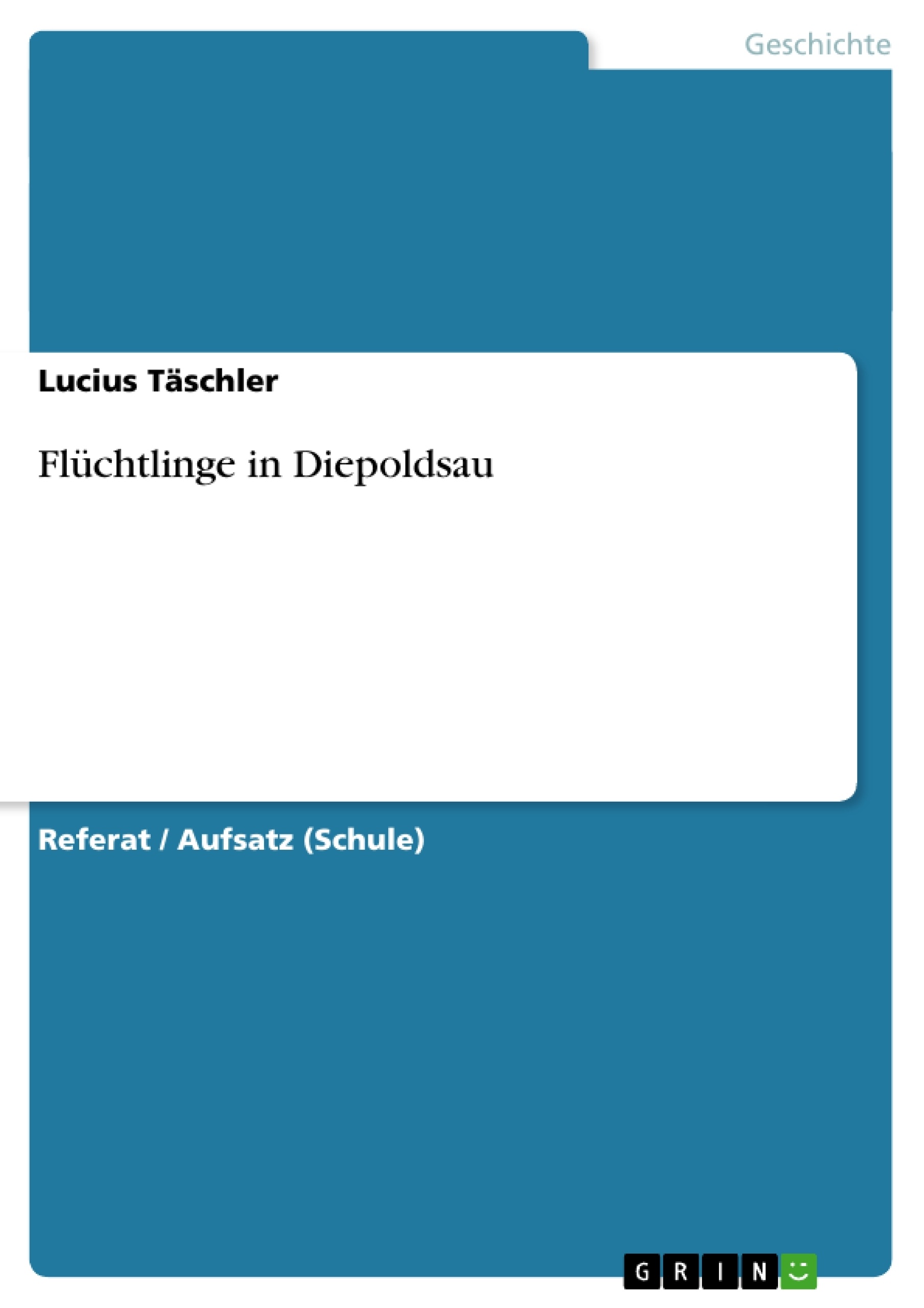Flüchtlinge in Diepoldsau
1. Flüchtlingspolitik
- Die Schweiz steht inmitten Europas und dessen Grundtatsachen Krieg, Verfolgung und Vernichtung gegenüber.
- Brennpunkt: Neutralität <-> wirtschaftliche Abhängigkeit von Deutschland
- Nach dem 1. Weltkrieg wurde Fremdenpolizei gegründet, welche sich vor allem darin berufen sah, den CH-
Arbeitsmarkt zu schützen und sogenannt „wesensfremde Elemente“ abzuwehren
- Da die Flüchtlingszahl in den Kriegsjahren rasant anstieg, setzte die Fremdenpolizei, wie der damalige Chef der Polizeiabteilung der Eidg. Fremdenpolizei, Heinrich Rothmund meint, „energische Massnahmen“ ein.
- Nach 1938 schloss die Schweiz schrittweise ihre Grenzen
- Gegner der Flüchtlingspolitik fordern offenere, liberalere Flüchtlingspolitik, da die Schweiz seit der Bundesstaatsgründung das Recht, Verfolgte auch gegen den Einwand eines anderen Staates Schutz zu gewähren, innehatte.
- Doch: Wenn Gruppen von politischen Parteien, kirchlichen Kreisen oder Hilfswerken in der Kriegszeit eine Öffnung der Grenzen verlangten, so dachten sie in erster Linie an die von ihnen betreuten Flüchtlinge. Die Betreuung der Flüchtlinge war in diesen Kreisen Aufgabe von privater Organisationen.
- Ein Beispiel dazu:
- Für die jüdische Gemeinde, die am meisten Flüchtlinge zu unterstützen hatte, hatte wohl die schwierigste Aufgabe.
- Als der jüdische Bund 1938 zum ersten Mal in finanzielle Notlage kam, lehnte der Bund ein Unterstützungsgesuch ab und drohte mit der Schliessung der Grenze, falls die Flüchtlinge der Öffentlichkeit zur Last fallen sollten.
- Erst 1943 übernahm der Bund die Kosten für die Unterbringung und Betreuung aller zivilen Flüchtlinge.
- Es lässt sich sagen, dass in der Schweiz eine allgemein gültige flüchtlingsorientierte Praxis entstand:
Flüchtlinge, die nur aus Rassengründen (z.B. Juden), nicht als politische Flüchtlinge galten wurden abgewiesen. Ausnahmen machte man bei Kindern, Familien und alten oder kranken Personen. Erst als sich 1944 ein Sieg der Alliierten abklärte wurden die Grenzen für alle Flüchtlinge grundsätzlich geöffnet. Es war jedoch zu spät.
2. Rolle Diepoldsaus als rettende Insel
2.1 Wirtschaftliche Lage
- Wie wir im Vortrag gehört haben, florierte anfangs des Jahrhunderts in Diepoldsau die Stickereiindustrie (à Bild). Als jedoch in den zwanziger Jahren dieser wichtige Zweig zerfiel und gleichzeitig auch noch die Arbeit am Rheindurchstich (à Bild) zu Ende ging, beklagte das Dorf eine grosse Arbeitslosenzahl. Zu all dem wütete Ende der dreissiger Jahre noch die Maul- und Klauenseuche, was den Lebensstandard nochmals erniedrigte.
- Viele Dorfbewohner begannen deshalb mit dem Schmuggeln von Waren. Die 87-jährige Emma Kuster erinnert sich:
- Alle im Dorf waren furchtbar arm. Mit Schmuggeln versuchten sich die Leute durchzubringen. Da wurde schon mal bei einem Velo der Sattel weggeschraubt und die Velostange mit Kaffe gefüllt. Wir Kinder wurden dann jeweils herbeigerufen, wir mussten sagen ob wir den Kaffee riechen konnten oder nicht.
- Wirtschaftliche Lage im Vorarlberg:
- Mit dem Einmarsch der Deutschen begann für die Vorarlberger ein kleineres Wirtschaftswunder: überall wurden Strassen saniert, Eisenbahnlinien erweitert und Industrien ausgebaut.
2.2 Herkunft der Flüchtlinge
- Also noch einmal zusammengefasst: März 1938, die Nationalsozialisten marschieren in Österreich ein.
Wien erwartet den Führer. Der Terror gegen die Juden beginnt, die fanatisierte Menge macht Tausende von Juden zu Freiwild.
- Jakob, Kreutner, jüdischer Flüchtling, schildert die Situation über dem Rhein folgendermassen:
Film
- Judith Kohn:
Film
- Auch in der NZZ wurde Diepoldsau und die Flüchtlinge ein Thema. Ein Artikel vom 21. August 1938:
- Den Unterkörper entblösst, die Schuhe und Beinkleider unter dem Arm so sind zwei Flüchtlinge durch das Wasser des alten Rheinlaufes gewatet. Hohläugig, todmüde und hungrig, liessen sie sich bei den Grenzwächtern nieder. Ganze vierzehn Mark hatten sie zusammen, die beiden in den dreissiger Jahren stehenden Männer. Ein Wachmeister holte ihnen Wurst und Brot. Sie flehten darum in der Schweiz bleiben zu dürfen; mittel- und schriftlos wie sie waren. Acht Tage hätten sie im Gefängnis in Feldkirch zubringen müssen und seien dann von uniformierten Männern abgeführt worden. Mit vorgehaltenem Revolver habe man ihnen die Stelle gewiesen, wo sie die Grenze überschreiten könnten, und habe ihnen gedroht, ja nicht mehr zurückzukommen. Rund eine Stunde ruhten sie sich aus, dann mussten sie zurück.
- Über die idyllische Flusslandschaft bei Diepoldsau versuchten Tausende von bedrohten Juden nach dem Einmarsch in Österreich den Fluss zu überqueren und das rettende Dorf zu erreichen.
- Der Rhein führte damals kaum Wasser, ein idealer Fluchtweg. Doch Schweizer Zoll und Armee patrouillierten Tag und Nacht rund ums Dorf. Der einzige noch lebende Fluchthelfer, Jakob Spirig dazu:
- Film
- Doch zum Glück unterstützten viele heimlich Grenzwächter die Fluchthelfer, wie Alfons Eigenmann, der Sohn eines Zöllners erklärt:
- Film
- Die flüchtenden Juden kamen, wie schon gesagt, völlig mittellos an der Grenze an. Ein paar hätten jedoch Skizzen und Fotos dabei gahabt, um den Weg zu finden, wie im Buch „Grüningers Fall“ von Stefan Keller geschrieben steht.
- Dort ist auch geschrieben, dass ein Kurierdienst bis nach Wien die Information über den Fluchtweg beim Schmitterzoll weiterverbreitete, sodass, wie der damalige Landjäger, Ernst Kamm, meint „jedes Jüdli haargenau gewusst, wo es durchmusste“.
- Ohne ortskundige Helfer schafften es allerdings nur wenige. So suchten viele Flüchtlinge nach einem kundigen Fluchthelfer. Der letzte, noch lebende Fluchthelfer von Diepoldsau ist Jakob Spirig.
- Über die Auftragsbeschaffung meint Jakob Spirig, in der Volkszeitung vom 10. Januar 2000:
- Zusammen mit Kollegen gingen wir jeweils nach Hohenems ins Restaurant Hoher Freschen. Dieses lag sehr nahe beim Bahnhof, wo viele Juden aus Wien in Richtung Schweiz flüchten wollten. Sie mussten erfahren haben, dass der einfachste weg in die Freiheit bei Diepoldsau ist.
- Auch Jakob Spirig hatte eine Taktik, so dass er die Flüchtlinge ohne grosse Probleme über die Grenze brachte, wie er ebenfalls am 10. Januar gegenüber der Rheintalischen Volkszeitung verriet:
- Am Abend gegen 20 Uhr lösten sich die Zöllner jeweils ab. Das war die beste Zeit um die Juden in die Schweiz zu bringen. Wir haben die Flüchtlinge dann in Österreich abgeholt und sind mit ihnen über ein etwa eineinhalb Meter breites Bächlein gewatet. Dieses war nur etwa 20 Zentimeter tief und diese Stelle wurde eigentlich nie kontrolliert. In aller Ruhe konnten wir die Schuhe und Socken ausziehen und so durch das Bächlein gehen. Erst danach kam die schwierigste Stelle. Wir mussten am Schweizer Zollhäuschen vorbei. Vom Hause eines Kollegen erhielten die Zöllner dann jeweils ein Telefonanruf. Der Zöllner hatte dann etwa 30 bis 40 Meter unter die Füsse zu nehmen um vom Zollhäuschen zum Hauptzoll (Schmitterzoll à Karte/Foto) zu gelangen wo das Telefon war.
Genau diese Zeit nutzten wir, um am Zoll vorbeizukommen. Auch standen andere Kollegen immer wieder Schmiere. Wir pfiffen dann das Lied „Wozu sind Strassen da?“ und wenn wir vom Kollegen die Melodie „..- zum Marschieren“ hörten wussten wir, dass kein Zöllner in der Nähe war.
- Ein bekannter Fluchtweg war derjenige beim Strandbad Diepoldsau. Damals sah die Umgebung dort noch komplett anders aus. Der Rehin war nur etwa 80 Zentimeter breit. Er führte kaum Wasser. Die Leute konnten praktisch trocken über die Gegend hereinkommen, es war wie ein kleiner Fussweg von Hohenems, Österreicher Seite, in die Schweiz.
- Eine andere Methode:
- Die Gemeinde Diepoldsau besitzt Land in Österreich, das sogenannte Schweizer Riet. Während der dreissiger Jahren stellte man das Land den arbeitslosen Stickern zur Verfügung. Sie kamen täglich hierher und bauten Gemüse an. So lernten sie das Grenzgebiet auswendig kennen. So kam es, dass sich auch im Schweizer Riet ein Türchen auftat. Dazu Hanna Weder, die Tochter eines Stickers, der Land im Schweizer Riet bekam, in einem Interview mit Nadja Baumann, die eine Arbeit über die Flüchtlinge in Diepoldsau schrieb:
- Wenn man Heu über die Grenze brachte, nahm man viele Male zwei, drei Kerle herüber. Und dann haben sie beim Zoll angefangen mit so langen Eisenstangen durchs Heu, dann war das auch wieder fertig. Die Leute versteckten sich häufig in den Äckern und warteten, dass sie jemand mit herüber nimmt.
2.3 Fluchthilfe als Nebenverdienst
- Wie für Jakob Kuster stand auch für viele andere der Verdienst im Vordergrund. Die Fluchthilfe war eine willkommene Gelegenheit das Einkommen aufzubessern. Jakob Kuster meint dazu gegenüber der Volkszeitung:
- Etwa zehn bis fünfzehn Mark erhielten wir von den Juden, die in die Schweiz wollten. Sie hatten nicht viel bei sich, aber für uns war es doch ein grösseres Sackgeld in einer schweren und arbeitslosen Zeit. Wir waren damals etwa 18 oder 19 Jahre alt und wussten weder was ein Konzentrationslager ist noch wie grausam die Juden verfolgt wurden.
- Doch nicht alle Fluchthelfer taten es in erster Linie des Geldes wegen. Hierzu ein Beispiel: Judith Kohn hatte einen Bräutigam, der schon in der Schweiz war. Bisherige Fluchtversuche waren allesamt gescheitert.
Da begegnete sie in einem Gasthaus Johann Spirig:
- Film
- Johann Spirig galt als Schmugglerkönig. Viele Juden hat er in dieser schwierigen Zeit über die Grenze gebracht ohne Geld zu verlangen. Briefe bewiesen das.
2.4 Die Haltung der Behörden
- Nach dem Einmarsch der Deutschen schoben die Nazibehörden systematisch Juden über die Grenze ab. Die schwarz einreisenden Flüchtlinge machten sich zu einem Problem.
- Der Bundesrat handelte: ab sofort mussten alle Personen, die mit einem österreichischen Pass ohne das
erforderliche Visum eines schweizerischen Konsulates die schweizerische Grenze passieren wollten, auf Berner Befehl hin zurückgewiesen werden. Solche, denen es gelungen ist, sind wieder zurückzustellen.
- Aus diesem Grund werden zusätzliche Grenzmänner nach Diepoldsau gebracht. Auch freiwillige nahmen den Job an. Das ganze geschah im August 1938.
- Am 12. Und 14. September zogen die beiden Grenzschutzkompanien, die vom Bund zur Verstärkung von
Zoll und Polizei geschickt wurde, aber wieder ab. Den Befehl dazu hatte ein gewisser Hauptmann Grüninger gegeben. Dieser hat dem EJPD nämlich versichert, er übernehme nun jede Garantie, dass die Grenze dicht genug bleibe.
- Die Grenzschliessung machte den Nebenerwerb für viele Fluchthelfer zu riskant. Jakob Spirig riskierte trotzdem noch einige Aktionen. Eines Abends ging jedoch eine daneben, als sie den Auftrag bekamen, drei Frauen über die Grenze zu führen, dann aber fünf dort standen. Die Volkszeitung schreibt:
- Wir durchschnitten den Stacheldraht und hätten es beinahe geschafft. Die Frauen waren aber schon älter und waren nicht gerade flink. Irgendwann hörten wir dann Stimmen: „Halt, deutsche Zollwache“. Kurz darauf fielen Schüsse. Darauf liessen wir die fünf Frauen allein und machten uns aus dem Staub.
- Die sechs Fluchthelfer wurden erwischt und vor ein Militärgericht gestellt und, im Falle von Spirig für drei Monate verurteilt.
- Viele Jahre später erfuhr der mittlerweile 80-jährige Jakob Spirig von einer Frau aus Bielefeld, dass nur eine der fünf Frauen entwischen konnte. Eine andere hatte sich noch am gleichen Tag das Leben genommen und die restlichen drei Frauen seien kurz vor Kriegsende in einem Konzentrationslager umgekommen.
2.5 Flüchtlingslager Diepoldsau
- Vom Flüchtlingslager ist in den Akten erstmals Mitte August 1938 die Rede. Finanziert wurde das Lager in Diepoldsau durch die Israelitische Flüchtlingshilfe.
- Aus dem Tagblatt vom 23. August 1938:
- Wer gegenwärtig in der Gegend von Diepoldsau-Widnau zu tun hat, dem fallen unwillkürlich die vielen fremdländischen Gestalten auf, meist Leute im Alter von 20-30 Jahren, die das Strassenbild beleben und auf den ersten Blick als jüdische Emigranten erkannt werden. In einer leerstehenden Schifflistickerei (heutige Sandheer Packungen à Bild), in Diepoldsau ist seit einigen Tagen das Sammellager der in die Schweiz geflüchteten oder abgeschobenen Wiener Juden eingerichtet. Der zurzeit bezogene Bau umfasst 120 Personen, und ein Haus der Rheinkorrektion (heutiges Restaurant National à Bild) wird als Krankenzimmer und Raum für die weiblichen Emigranten und verheirateten Paare genützt. Die Leute haben sich zum Zimmerverlesen zu stellen, Appell einzuhalten, Plankenordnung zu machen usw. Während das für die meisten am Anfang ganz fremde Dinge waren, scheinen sich heute alle daran gewöhnt zu haben und erkennen den Wert solcher Ordnung.
- Zum Essen wurden die Flüchtlinge jeweilen kolonnenweise in nahe Gasthöfe, wie zum Beispiel der
Alpenblick (à Bild) geführt.
- Aus Dankbarkeit haben die Emigranten gelegentlich das ganze Dorf zu kulturellen Darbietungen ins Lager eingeladen, zuTheateraufführungen und Konzerten. Jakob Spirig dazu:
- Die meisten Juden kamen aus Wien und viele von ihnen waren künstlerisch begabt. Sie malten und zeichneten oft Kunstwerke.
- Am Tag konnten sich die Flüchtlinge frei im Dorf bewegen und hatten dabei oft auch Kontakt mit den
Einheimischen (obwohl dies eigentlich verboten war). Obwohl es auch in Diepoldsau überzeugte Nazis gab, hinterblieb den Flüchtlingen meist ein positives Bild des Dorfes. Dazu Harry Weinreb, ein jüdischer Flüchtling:
- In Diepoldsau hat es eine gewisse Gegnerschaft zwischen Katholiken und Protestanten gegeben.
Häufig gestellte Fragen zu "Flüchtlinge in Diepoldsau"
Was war die allgemeine Flüchtlingspolitik der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs?
Die Schweiz versuchte, ihre Grenzen zu schützen und den Arbeitsmarkt vor "wesensfremden Elementen" zu bewahren. Nach 1938 schloss die Schweiz schrittweise ihre Grenzen. Flüchtlinge, die nur aus Rassengründen (z.B. Juden) verfolgt wurden, galten nicht als politische Flüchtlinge und wurden abgewiesen, mit Ausnahmen für Kinder, Familien und kranke/alte Personen. Erst 1944, als sich ein Sieg der Alliierten abzeichnete, wurden die Grenzen grundsätzlich für alle Flüchtlinge geöffnet.
Wie war die wirtschaftliche Situation in Diepoldsau während des Zweiten Weltkriegs?
Die Stickereiindustrie in Diepoldsau, die anfangs des Jahrhunderts florierte, zerfiel in den 1920er Jahren. Gleichzeitig endete die Arbeit am Rheindurchstich, was zu hoher Arbeitslosigkeit führte. Ende der 1930er Jahre verschärfte die Maul- und Klauenseuche die Situation zusätzlich. Viele Dorfbewohner begannen deshalb mit dem Schmuggeln von Waren.
Woher kamen die Flüchtlinge, die nach Diepoldsau kamen?
Viele Flüchtlinge kamen aus Österreich, insbesondere aus Wien, nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten im März 1938. Der Terror gegen Juden begann, und viele versuchten, über den Rhein in die Schweiz zu fliehen.
Wie halfen die Einwohner von Diepoldsau den Flüchtlingen?
Einige Einwohner von Diepoldsau halfen den Flüchtlingen heimlich bei der Überquerung der Grenze. Sie fungierten als Fluchthelfer, die die Flüchtlinge durch das Grenzgebiet führten. Einige Grenzwächter unterstützten die Fluchthelfer ebenfalls heimlich.
Wie verdienten die Fluchthelfer ihr Geld?
Viele Fluchthelfer erhielten Geld von den Flüchtlingen für ihre Dienste. Dies war eine willkommene Gelegenheit, das Einkommen in einer schwierigen und arbeitslosen Zeit aufzubessern. Einige Fluchthelfer taten es jedoch auch aus humanitären Gründen, ohne Geld zu verlangen.
Wie reagierten die Behörden auf die Flüchtlingssituation?
Der Bundesrat ordnete an, dass Personen mit österreichischem Pass ohne das erforderliche Visum zurückgewiesen werden mussten. Zusätzliche Grenzmänner wurden nach Diepoldsau geschickt, um die Grenze zu sichern. Hauptmann Grüninger versicherte, dass die Grenze dicht genug bleibe, was aber nicht der Fall war.
Gab es ein Flüchtlingslager in Diepoldsau?
Ja, es gab ein Flüchtlingslager in Diepoldsau, das von der Israelitischen Flüchtlingshilfe finanziert wurde. Es befand sich in einer leerstehenden Schifflistickerei und später auch in einem Haus der Rheinkorrektion. Die Flüchtlinge wurden in nahegelegenen Gasthöfen verpflegt und durften sich tagsüber im Dorf frei bewegen.
Wie war die Beziehung zwischen den Flüchtlingen und den Einheimischen in Diepoldsau?
Obwohl es in Diepoldsau auch überzeugte Nazis gab, hatten die Flüchtlinge meist ein positives Bild des Dorfes. Sie hatten Kontakt zu den Einheimischen, obwohl dies eigentlich verboten war. Einige Flüchtlinge brachten aus Dankbarkeit kulturelle Darbietungen im Lager dar.
- Citation du texte
- Lucius Täschler (Auteur), 2001, Flüchtlinge in Diepoldsau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105246