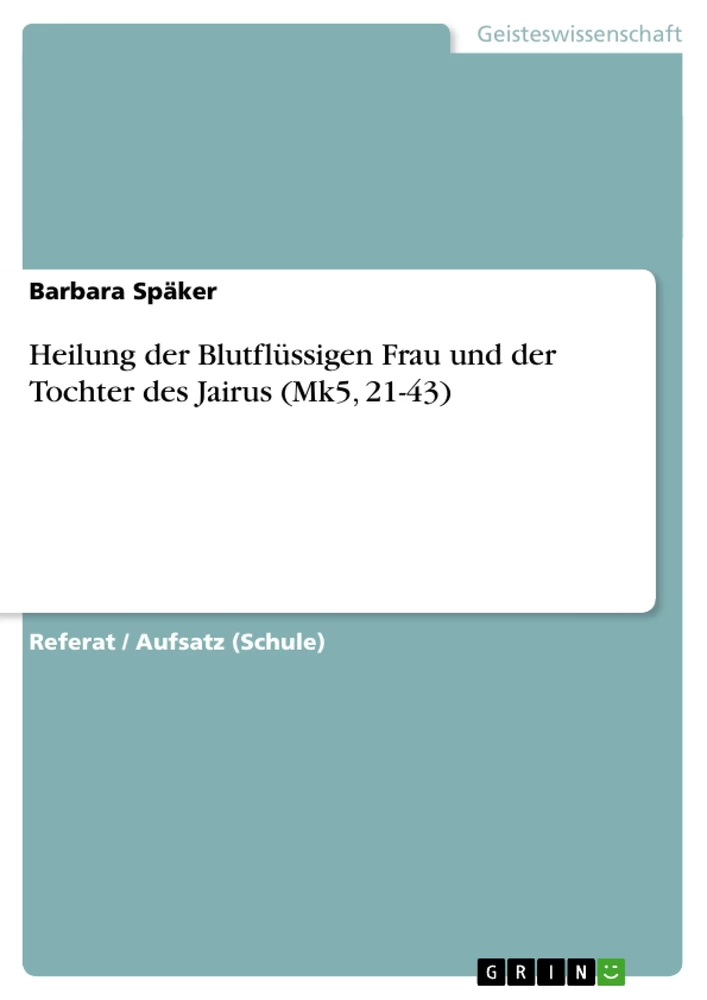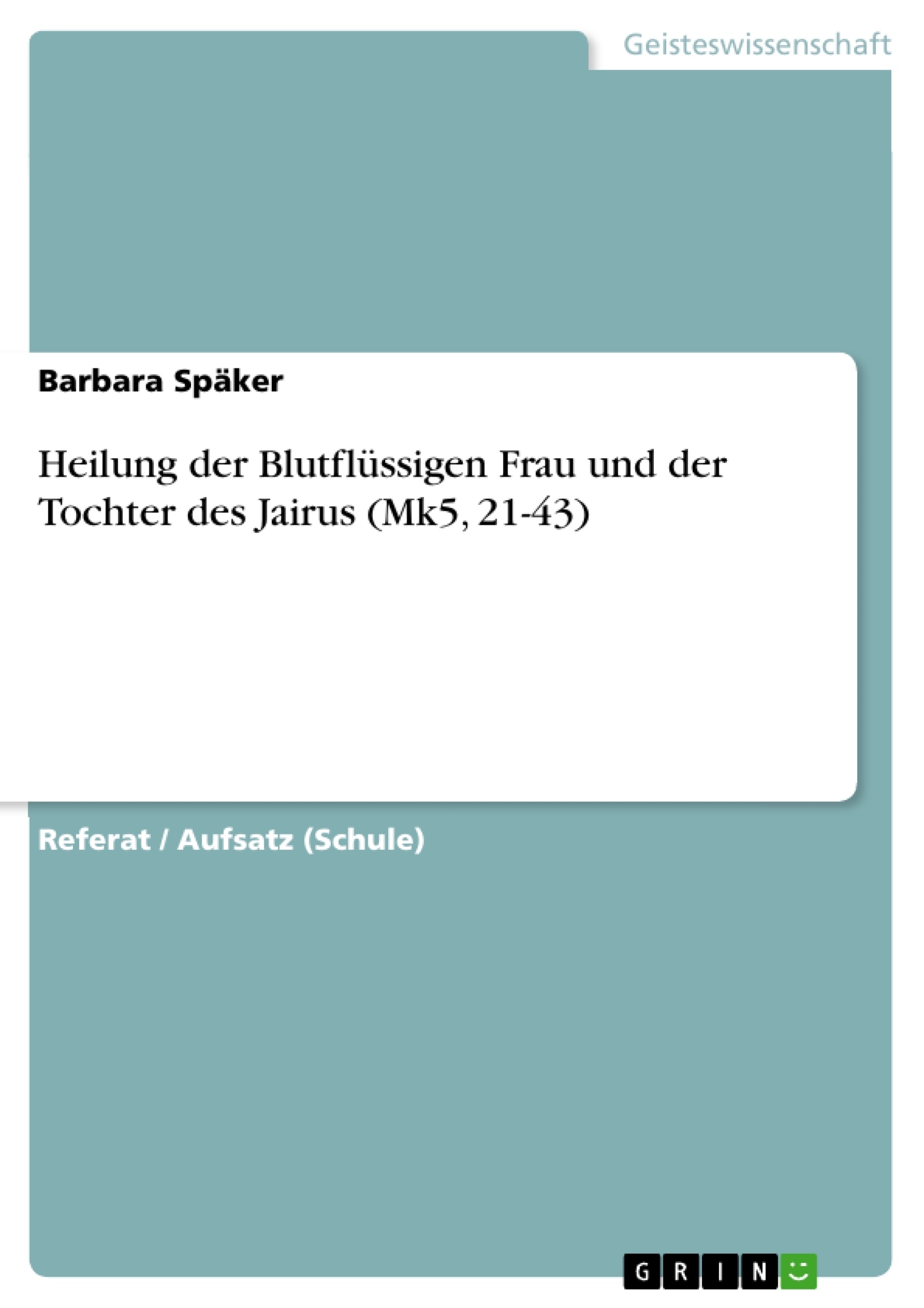Was bedeutet es wirklich, eine Frau in einer von Männern dominierten Welt zu sein? Diese tiefgründige Analyse zweier biblischer Erzählungen – die Heilung der blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus (Markus 5,21-43) – enthüllt erschütternde Einblicke in weibliches Leid, gesellschaftliche Ausgrenzung und die Suche nach Heilung. Entgegen oberflächlicher Interpretationen werden hier die psychologischen und sozialen Dimensionen der Geschichten freigelegt, wobei Eugen Drewermanns tiefenpsychologische Exegese als Fundament dient. Die blutflüssige Frau, geplagt von einem Tabu, das sie zur ständigen Isolation verdammt, ringt mit dem Gefühl, wertlos und unrein zu sein. Ihre Verzweiflung führt sie zu Jesus, in der Hoffnung auf eine Berührung, die mehr als nur körperliche Heilung verspricht: die Wiederherstellung ihrer Würde. Parallel dazu kämpft Jairus um das Leben seiner zwölfjährigen Tochter, einem Mädchen an der Schwelle zur Weiblichkeit, das von den Erwartungen einer patriarchalischen Gesellschaft erdrückt wird. Ihre Krankheit wird zum Ausdruck eines tieferliegenden Konflikts, der Angst vor dem Erwachsenwerden und dem Verlust kindlicher Unschuld. Sind diese beiden Frauenschicksale zufällig miteinander verwoben? Oder spiegeln sie vielmehr die universelle Erfahrung von Frauen wider, die in einer Welt nach Autonomie und Selbstbestimmung streben, in der Liebe oft mit Schmerz und Ablehnung einhergeht? Diese fesselnde Interpretation biblischer Texte regt dazu an, über Geschlechterrollen, Trauma, Glaube und die transformative Kraft der Akzeptanz nachzudenken. Eine wichtige Lektüre für alle, die sich für Theologie, Psychologie und die Rolle der Frau in der Gesellschaft interessieren. Entdecken Sie verborgene Botschaften, die auch heute noch von Bedeutung sind, und gewinnen Sie neue Perspektiven auf alte Geschichten über Heilung, Erlösung und die unerschütterliche Stärke des weiblichen Geistes. Erfahren Sie, wie diese beiden Frauenfiguren miteinander verbunden sind und wie ihre Erfahrungen uns helfen können, die Herausforderungen zu verstehen, mit denen Frauen konfrontiert sind, wenn sie versuchen, Glück und Gesundheit in einer von Männern dominierten Gesellschaft zu finden. Diese Analyse bietet eine tiefgründige Betrachtung der weiblichen Sexualität, der Beziehung zwischen Vater und Tochter und der psychosomatischen Auswirkungen von emotionalem Trauma.
Die Heilung der blutflüssigen Frau und der Tochter des Jairus (Mk 5,21-43)
Grundlage: Eugen Drewermann, Tiefenpsychologie und Exegese, Band II,
1) Problem: Schachtelperikope > gehören die beiden Wunder wirklich zusammen oder wurden sie erst später
zusammengefügt?
- kaum vorhandene Historizität (typisches Erzählgut)
- Verkündigungscharakter: - Glaube hat Frau gerettet
- Erweckung = Tod hat Macht verloren
Tod ist natürlich keine Tatsache, sondern todesähnlicher Zustand (Hysterie 279) Fazit: theologische Verkündigungsinhalte ohne historische Grundlage
2) Die beiden Frauen:
Geschichte erzählt Schicksal zweier Frauen
- eine leidet seit 12 Jahren eine Frau zu sein
- eine droht ihr Leben im Alter von 12 Jahren zu verlieren
Blutflüssige Frau Tochter des Jairus
- geht von Arzt zu Arzt, um geheilt zu
werden
- Frau sucht Jesus auf
- Frau muss sich Weg durch die
Menge bahnen
- sie trägt nichts zu ihrer Genesung
bei
- Jesus muss sie aufsuchen
- Jesus muss sich seinen Weg durch die Menge bahnen
- Parallelisierung der Einzelelemente
- Beide Erzählungen beleuchten gemeinsam und in wechselseitiger Beziehung ein und dasselbe Problem:
Wie man als Frau inmitten einer Gesellschaft von Männern leben und ein gewisses Maß an Glück und Gesundheit finden kann
(Geschichte ähnelt im Aufbau und Thematik in wesentlichen Zügen der Tobit - Erzählung (AT))
3) Krankheitsbild der blutflüssigen Frau: Ø Anomalie der weiblichen Periode
ABER: Welches Schicksal verbirgt sich dahinter? Wie kann sie damit leben? Lev 15, 25-27 (S.282 unten)
- man ist zu einer ständigen Berührungs angst verurteil Ø man ist für die anderen ein lebendes Tabu
- man muss jeden engeren Kontakt meiden, andere förmlich bitten, den Kontakt zu meiden
- Insgesamt: ständiges Leben im Abseits
Psychanalytisch:
Frau zeigt Charakterbild > weibliche Sexualität = etwas Schmutziges, Schulhaftes, Schädliches
- zurückzuführen auf problematische Beziehung zum Vater (sowohl geliebt als auch gefürchtet)
- Mutter = schwach, unterwürfig; kann sich nicht gegen den gewalttätigen Vater durchsetzen
- Hinzu kommt, um Blutfluss hervorzurufen, eine schwere Enttäuschung und seelische Verwundung in einer wichtigen Liebesbeziehung Beispiel der Frau: Einzelkind - ständige Spannungen im Elternhaus - Angstvor- bild für eheliche Zusammenleben - wollte nie Kinder, nie heiraten - Berufswahl = Pädagogik und Lehrerin - Abschied von zu Hause = Erleichterung - mit 30 3 ½ J. in einen Mann verliebt, der nur ihr Äußeres mochte - Liebe = Trauma - ein Jahr lang Schmerzen und ununterbrochene Blutungen - Krankenhaus konnte nicht helfen > psychso-matisch - durch die Liebe fühlte sie sich zu Tode verletzt - sie meint, sie verlange in der Liebe zu viel, idealisiert sie - Blutungen hörten auf, als sie sich in einen zweiten Mann verliebte - gab ihr nach einem Jahr den Laufpass (sie sei zu schwierig) - das alte Leiden begann erneut Ø Frau wollte nie wieder einem Mann lästig werden: sie verbarg ihre Verwundungen in sich und sie hoffte, jeden engeren Kontakt durch Bezahlung wiedergutzumachen.
4) Bei der blutflüssigen Frau läßt sich beides wiederfinden:
- sie vergeudete in den 12 Jahren ihr ganzes Geld bei den Ärzten, ohne dass sie ihr helfen konnten
- Besuch der Ärzte = einziger Kontakt zu anderen Menschen
- Frau glaubt, den anderen mit ihrem Wunsch nach Liebe nur lästig zu sein Ø Grundgefühl = Dasein ohne den geringsten Sinn und Nutzen
Was ging in der Frau vor, als sie nun hörte, dass Jesus in die Stadt kommt? Ø Wunsch, dass Jesus ihr die Hand auflege und sie heile
- Traum, dass er sie berühre und dass sie dann nichts Unreines mehr an ihrem Körper findet
- Aber sie empfindet auch Angst, Scham, Resignation
>> sie hofft nicht, dass sie Jesus für ihr Leid gewinnt, aber sie denkt, dass sie ihn unbemerkt berühren kann, ohne dass es jemand merkt, ohne lästig zu sein
Sie wagt es dieses entscheidende Mal, sich gegen alle Scham und Scheu dem Anderen (Jesus) zuzumuten.
- Sie dringt durch den Trubel der Menge zu Jesus vor
- Sie belästigt ihn mit ihrem persönlichen Problem und hält ihn auf
Sie handelt in diesem Moment völlig anders als zuvor, aber sie macht es wie ein Dieb: sie schleicht sich von hinten unbemerkt an, nutzt den Trubel als ihr Versteck
Berührung: von so großer Intensität, dass Jesus mit vollständiger Wärme und Hingabebereitschaft antwortet.
>> Frau erhält zum ersten Mal das zurück, was sie gibt. Sie wird nie wieder unrein, ausgesetzt, nicht-angenommen fühlt
5) Die Geste wirkt jedoch nicht allein. Sie muss sich, wie bei einem Sakrament mit dem Wort verbinden:
„Wer hat meine Kleider angerührt?“ > Eindruck, als ob wirklich ein Diebstahl geschehen sei, außerdem Reaktion der Jünger Jedoch hat Jesus Zeit: man muss die Frage erstaunt aussprechen.
Die Frau kommt mit Furcht und Zittern auf Jesus zu > vielleicht nimmt er ihr ihre gerade gewonnene Reinheit wieder weg Sie wirft sich ihm vor die Füße > alles steht auf dem Spiel: entweder endgültige Verurteilung oder endgültige Rettung Jesus erklärt sie ausdrücklich für gerettet.
Glaube der Frau bekommt noch zusätzlichen Inhalt: „Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet.“
„Geh hin in Frieden“ und was es bedeutet: „ Sei von deiner Qual gesund“ In diesem Augenblick ist das Wunder vollendet. Sie muss sich von nun an nicht mehr als Diebin fühlen, sie ist rein und wieder ein Teil der Gesellschaft.
6) Zu der Zeit, als sich Jesus mit der blutflüssigen Frau beschäftigt, wartet Jairus, dass Jesus seine Tochter heilt > ein sich ins unertragbare dehnende Verzögerung, da seine Tochter im Sterben liegt.
Sinnloser Zwischenfall = Hinführung zur Rettung der Tochter Ø beide Frauengestalten sind ineinander verschachtelt
- man muss das wechselseitige Ineinander verstehbar machen und es nicht bloß als literarische Manier stehenlassen.
- Parallelität
Tochter des Jairus: leidet anscheinend auch daran, eine Frau zu sein, oder eine Frau zu werden
- 12 Jahre = Zeitpunkt an dem ein Mädchen heiraten kann
- auch unter normalen Umständen ein einschneidender Schritt: Tod der
Kindheit; Ängste vor der unbekannten, geheimnisvollen Kraft erwachender Liebe
Also: Erweckung = Befreiung der Liebe von der Angst
Die Tochter ist gesetzlich mit 12 Jahren erwachsen, dennoch wird von ihr nur als Tochter des Jairus gesprochen: sie selbst erscheint namenlos, ohne eigenes Ich, sie ist die verkörperte Unselbständigkeit, Abhängigkeit - nur die Tochter des Jairus
Synagogenvorsteher = Dorfpfarrer, Dorfschullehrer; Kinder = Muster an Sitte und Anstand
- wenn den Kindern ein Fehler unterläuft, so schmälert das die Ehre des Vaters
- außerdem, scheint das Mädchen ein Einzelkind zu sein (es ist von
Geschwistern nicht die Rede), so dass sich alle Hoffnungen und
Erwartungen des Vaters auf seine einzige Tochter richten.
„MeinTöchterleinist sterbenskrank...“ > der Vater sieht in ihr, obwohl sie erwachsen ist, immer noch seine süße, kleine Tochter
Die Tochter kann so nicht erwachsen werden, die Sorge des Vaters engt sie ein, sie kann kein Selbstwertgefühl, Eigenständigkeit entwickeln. Siel lebt mit dem ängstlichen Gefühl etwas falsch zu machen.
- Ihre Entwicklung wird gestoppt; Problem der Sexualität: Sie wird sich schwer tun, ihren Vater gegen einen anderen Mann einzutauschen und Jairus wird sie immer durch seine Eifersucht schützen wollen.
- Patriarchalische Gesellschaft: Wenn die Tochter einen Mann nimmt, dann nur dem Vater zuliebe und nicht aus eigenem Antrieb.
- Sexualkontrolle: das Leben eines Mädchens ist von Anfang an mit Tabus und Schuldgefühlen durchsetzt
Psychosomatische Erklärung der Krankheit: Totstellreflex, der aus einer genitalen Berührung resultiert > keine kurzzeitige sondern längerfristige hysterische Lähmung
Akuter Zustand = Resultat geheimer Todes wünsche und -sehnsüchte
Ähnlich: Magersüchtige versuchen durch Hungern am Beginn der Pubertät die körperliche Entwicklung zu stoppen und zu verhindern > langsamer Suizid Die Tochter ist aber nicht magersüchtig; (S.300 unten)
- sie will ihren Körper abstreifen
Fazit: Mit der Jairus - Tochter muss ein Mädchen gerettet werden, das aus Angst vor dem Frau-werden den Tod herbeisehnt, um sich die Reinheit der Kindheit zu bewahren.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse von Markus 5,21-43 ("Die Heilung der blutflüssigen Frau und der Tochter des Jairus")?
Die Analyse, basierend auf Eugen Drewermanns "Tiefenpsychologie und Exegese", Band II, untersucht die beiden Wundergeschichten (die Heilung der blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus) und ob sie ursprünglich zusammengehörten oder erst später verbunden wurden. Sie betont den Verkündigungscharakter, wonach der Glaube die Frau rettete und die Auferweckung den Tod entmachtet. Es wird festgestellt, dass die Geschichten eher theologische Verkündigungsinhalte ohne historische Grundlage darstellen.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden zwischen der blutflüssigen Frau und der Tochter des Jairus hervorgehoben?
Beide Geschichten thematisieren das Schicksal von Frauen in einer von Männern dominierten Gesellschaft. Die blutflüssige Frau leidet seit 12 Jahren, während die Tochter des Jairus im Alter von 12 Jahren zu sterben droht. Parallelen in ihren Geschichten werden aufgezeigt: Die eine sucht Ärzte, die andere Jesus; die eine bahnt sich einen Weg durch die Menge, die andere wird von Jesus aufgesucht. Beide Erzählungen beleuchten, wie Frauen in dieser Gesellschaft leben und Glück/Gesundheit finden können.
Was bedeutet die Krankheit der blutflüssigen Frau im psychoanalytischen Kontext?
Die Krankheit symbolisiert eine Anomalie der weiblichen Periode, die im psychoanalytischen Kontext als Ausdruck einer problematischen Beziehung zum Vater (Liebe und Furcht) und einer schwachen, unterwürfigen Mutter interpretiert wird. Weibliche Sexualität wird als etwas Schmutziges und Schulhaftes betrachtet. Die Blutungen können auch auf eine schwere Enttäuschung in einer Liebesbeziehung zurückzuführen sein, wobei die Frau sich durch Liebe zu Tode verletzt fühlt und ihre Verwundungen verbirgt.
Wie wird die Heilung der blutflüssigen Frau interpretiert?
Die Frau hat in den 12 Jahren vergeblich ihr Geld bei Ärzten ausgegeben und fühlt sich nutzlos und lästig. Als sie von Jesus hört, hofft sie auf Heilung durch seine Berührung, befürchtet aber Scham und Resignation. Sie wagt es, Jesus unbemerkt zu berühren und erfährt so eine intensive Wärme und Akzeptanz. Durch das Gespräch mit Jesus wird ihr Glaube bestärkt und sie wird von ihrer Qual geheilt.
Was symbolisiert die Krankheit der Tochter des Jairus?
Die Tochter des Jairus, die mit 12 Jahren (dem heiratsfähigen Alter) stirbt, symbolisiert die Angst vor dem Erwachsenwerden, der Sexualität und der unbekannten, geheimnisvollen Kraft der Liebe. Sie wird als namenlos und unselbstständig dargestellt, abhängig von ihrem Vater, einem Synagogenvorsteher, dessen Ehre durch ihre Fehler geschmälert würde. Die übermäßige Sorge des Vaters engt sie ein und hindert sie daran, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ihre Krankheit wird als psychosomatische Reaktion auf die patriarchale Gesellschaft und die damit verbundene Sexualkontrolle interpretiert.
Was ist die Kernaussage bezüglich beider Frauengestalten?
Die Jairus-Tochter muss vor dem Tod gerettet werden. Sie sehnt sich nach dem Tod aus Angst vor dem Frau-werden, um die Reinheit der Kindheit zu bewahren. Die blutflüssige Frau ist das vollendete Bild dieser Angst. Die Jairus-Tochter hingegen ist das Kind, das die Frau war, bevor ihr Leiden begann. Die Geschichten sind ineinander verschachtelt und thematisieren beide die Herausforderungen von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Barbara Späker (Autor:in), 2000, Heilung der Blutflüssigen Frau und der Tochter des Jairus (Mk5, 21-43), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105256