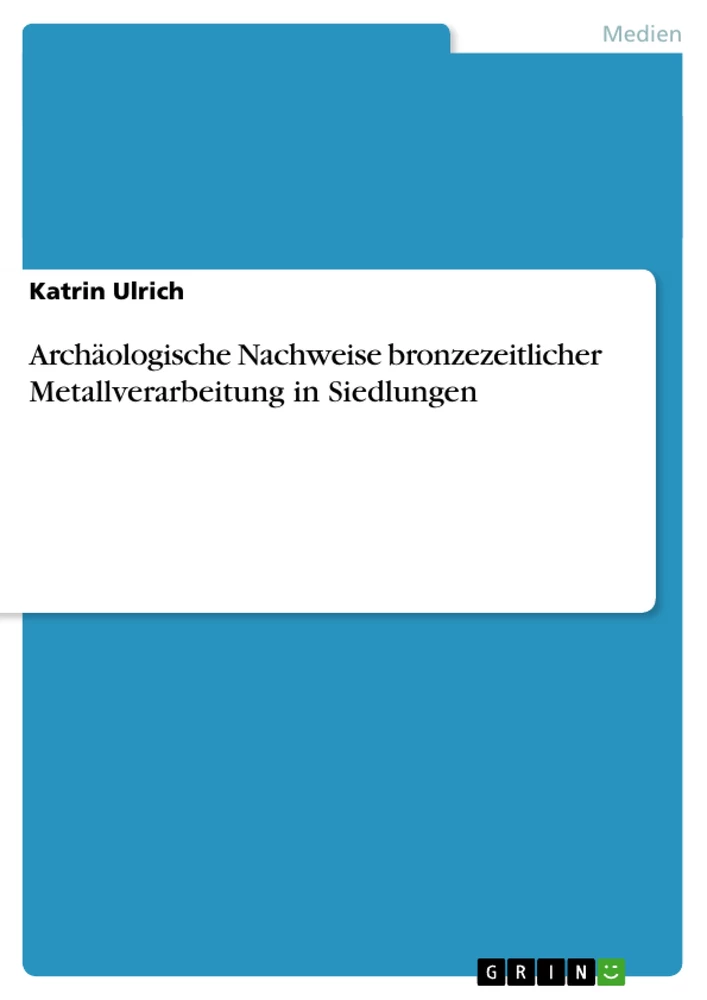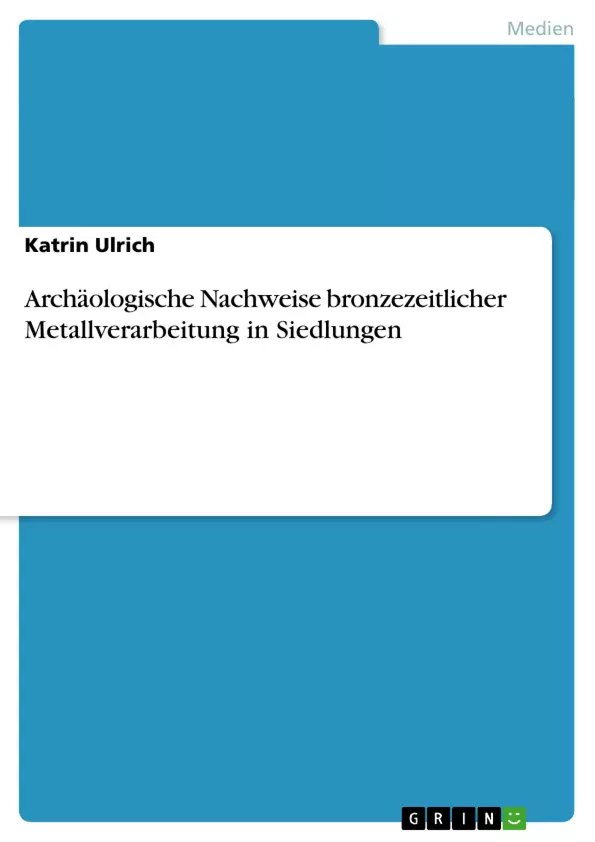Gliederung:
1 EINLEITUNG
2 DIE METALLURGIE IN DER BRONZEZEIT
2.1 DIE ENTWICKLUNG DER BRONZE
2.2 BRONZEZEITLICHER BERGBAU UND KUPFERVERHÜTTUNG
2.3 DER BRONZEGUß
3 SIEDLUNGSFUNDE
3.1 ALLGEMEIN
3.2 BUCHBERG
3.3 WALKEMÜHLE
3.4 TALTITZ
3.5 HEIDENSCHANZE
3.6 URNENFELDERZEITLICHE SIEDLUNGEN SÜDDEUTSCHLANDS
4 ZUSAMMENFASSUNG
LITERATUR:
1 Einleitung
Die Archäometallurgie und die dazugehörigen wirtschafts- und soziohistorischen Untersuchungen nehmen bei der Beschäftigung mit der Bronzezeit eine besondere Rolle ein. So sind die Fragen nach der Herstellung von Bronze, ihrer Verbreitung und der gesellschaftlichen Auswirkungen von Herstellung und Verbreitung schon seit langem Kernfragen der Forschung zur Bronzezeit.
Die zur Herstellung der Bronze verwandten Techniken und Verfahren sind dabei heute nur noch schwer nachweisbar. Mit dieser Arbeit werde ich die einzelnen archäologischen Hinweise bronzezeitlichen Metallhandwerks in Siedlungen untersuchen.
Hierzu sind nicht nur die sichtbaren Zeichen, wie erhaltene Metallstücke, Werkzeuge und - wenn noch vorhanden - Öfen in Betracht zu ziehen, sondern auch Aspekte wie Struktur der Wirtschaft oder Techniken der Handwerker.
Aus diesem Grund werde ich zunächst einen Überblick über das bronzezeitliche Metallhandwerk geben, bevor ich auf die Siedlungsfunde und einzelne Beispiele komme. Mein Hauptaugenmerk richte ich dabei v.a. auf die Ofenfunde, da zum einen alle weiteren metallurgischen Funde mit ihnen in Verbindung stehen und da sie mir auch in methodischer Hinsicht besonders interessant erschienen. Leider gibt es m.W. bisher - bis auf eine Ausnahme[1] - keine Überblicksdarstellungen, die sich mit dem Thema näher beschäftigen und eine Bestandsaufnahme entweder für bestimmte Regionen oder Zeiten geben.
Zusammenfassend folgt zum Schluß ein Überblick über die methodischen Probleme. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, den aktuellen Forschungsstand vollständig wiederzugeben. Daher werde ich mich vor allem darauf konzentrieren, Fragen aufzuwerfen, für die es bisher m.W. noch keine oder zumindest noch keine befriedigende Antworten gibt.
2 Die Metallurgie in der Bronzezeit
2.1 Die Entwicklung der Bronze
Die Anfänge der Metallurgie sind schon im 8. Jt. v.u.Z. zu suchen, als in Siedlungen des Vorderen Orients, der östlichen Türkei, Südwestpersien und Südsyrien natürlich vorkommendes, gediegenes Kupfer durch Kaltschmieden bearbeitet wurde. Im 5. Jt. v. Z. wurde im Vorderen Orient nachweisbar gediegenes Kupfer gegossen. Die Verhüttung von Kupfererzen wie Malachit und Azurit begann zum Ende des 5. Jt. v. u. Z. Schon im 4. Jt. v.u.Z. ist die Verhüttung und Gußtechnik von Kupfer auch in Osteuropa, v.a. auf dem Balkan[2], weit verbreitet.
Über die Ausbreitung der Technik nach ganz Europa gibt es mehrere Theorien. So könnte z.B. die Metallurgie analog der Ausbreitung von Ackerbau, Viehzucht und Keramikherstellung über den Balkan aus dem Vorderen Orient in den mitteleuropäischen Raum gelangt sein. Möglich wäre aber auch eine eigenständige Entwicklung der Kupferverarbeitung auf dem Balkan. Die Technik hätte sich dann über Osteuropa weiter nach West- und Mitteleuropa verbreitet.
Erste Legierungen von Kupfer mit Arsen in der sog. Arsenbronze sind schon im 6. Jt. v. Z. im Kaukasus sowie am Anfang des 4. Jt. v.u.Z. im Vorderen Orient nachgewiesen. Die Kupfer-Zinn-Legierungen der klassischen Bronze erscheinen erst ab dem 3. Jt. v.u.Z., an dessen Ende auch der Beginn der Bronzezeit in Mitteleuropa gesetzt wird.
Der Vorteil von derartigen Legierungen ist, daß der relativ hohe Schmelzpunkt von Kupfer (von 1084° C) durch den Zusatz von Arsen oder Zinn herabgesetzt wird. Die Bronze erhält dennoch bei der Nachbearbeitung einen wesentlich höheren Härtegrad. Nicht zuletzt hatte vermutlich die klassische Bronze gegenüber metallischem Kupfer auch den ästhetischen Vorteil eines schimmernden Goldglanzes.
Derartige Vorteile dürften dazu geführt haben, daß die zwei Rohstoffe Kupfer und Zinn, die meist nur örtlich weit voneinander entfernt vorkommen, mit erheblichen Aufwand über weite Teile Europas verhandelt wurden.
2.2 Bronzezeitlicher Bergbau und Kupferverhüttung
Spuren eines prähistorischen Bergbaus findet man heute in Mitteleuropa nur in den Alpen, so z.B. am Mitterberg in den Ostalpen, wo ein intensiver Bergbau auf sulfidische Kupfererze betrieben worden ist.
In den Mittelgebirgen wurden die prähistorischen Spuren wahrscheinlich durch den mittelalterlichen Bergbau zerstört oder durch Abraumhalden überlagert. Jedoch kam Kupfer z.B. in Deutschland relativ häufig vor, so u.a. im Erzgebirge, in Westthüringen (Schmalkaldener Revier), im Harz, im nordwestlichen Odenwald, am Donnersberg in Saarland und auf Helgoland.
Von besonderer Bedeutung waren dabei in der Bronzezeit die oberflächennahen Kupferschiefervorkommen. Diese wurden in den sog. Pingen (trichterförmige Gruben) abgebaut oder man legte Schächte und Stollen an, die den erzführenden Schichten folgten. Der Abbau erfolge hier mit Hilfe der Feuersetzmethode[3]. Ebenso konnte Kupfer als Ausbiß auf der Oberfläche an Geländekanten oder in Flußablagerungen vorkommen, oder es wurde als Rohstoff oder im Fertigprodukt importiert. Zusätzlich wurde auch Altmetall erneut eingeschmolzen. Zinn hingegen kam seltener vor. Es wurde im Fichtel- und im Erzgebirge abgebaut, sowie in Cornwall, in der Bretagne, in Spanien und auch in Portugal. Aufgrund des enormen Holzbedarfes bei beiden Vorgängen, erfolgte der Abbau des Kupfererzes und seine Verhüttung an unterschiedlichen Stellen.
Noch an der Abbaustelle wurde das Erz mit Hilfe von Rillenschlägeln, Klopfsteinen, Unterlagsplatten und Mühlen weiter zerkleinert und zermahlen, in Sichertrögen ähnlich wie Gold gewaschen und wahrscheinlich auch geröstet. Das Röstverfahren richtete sich nach der Beschaffenheit des Erzes: Kupferkarbonate wie Malachit und Azurit mußten nur ausreichend erhitzt werden, um den Sauerstoff aus der Verbindung zu entfernen. Sulfidisches Kupfererz wie Kupferkies hingegen wurde mit Mist und Lehm vermengt und so geröstet. Danach konnte es wie Kupferkarbonat behandelt werden.
Die Kupferschmelze selbst wurde weiter von der Abbaustelle entfernt durchgeführt. Man benötigte dazu Holzkohle, die wahrscheinlich in einem Grubenmeiler in der Nähe hergestellt worden ist. Oft man Zuschläge wie Fluß- oder Kalkspat hinzugefügt, um die Verschlackung von Fremdmetallverbindungen wie Eisen zu fördern.
Die Öfen selbst sind bis auf wenige Ausnahmen (s.u.) selten überliefert. So ist es schwer, über ihre Konstruktion und Handhabbarkeit Aussagen zu machen. Deutliche Anzeichen für einen Verhüttungsplatz sind jedoch u.a. Tondüsen, die der Verbindung zwischen Ofen und Blasebalg dienten, und Schmelztiegel in Verbindung mit Erz- und Schlackeresten.
2.3 Der Bronzegu ß
Zuerst wurde die Bronze in einem Tiegel aus Stein, Ton oder Graphit zum Schmelzen gebracht. Zeitgleich mußte auch die Gußform vorgewärmt werden, damit die Temperaturunterschiede zwischen Form und geschmolzener Bronze nicht zu hoch wurden und die Bronze zu schnell erstarrte bzw. die Form zersprang. Anhand der Gebrauchsspuren an Tiegeln versuchte JANTZEN experimentell nachzuweisen, auf welche Art und Weise das Metall geschmolzen wurde[4]. Dabei fand er heraus, daß Schachtöfen eher ungeeignet für den Bronzeguß sind, da der Tiegel während des Erhitzens von oben nach unten „wanderte“ und somit die heißeste Zone sehr schnell verließ und zugleich auch immer schwerer schnell herauszuholen gewesen wäre.
Eine flache topfförmige Feuerstelle, die von unten mit einem Blasebalg belüftet wurde, hatte zwar einen besseren Zugang, aber ließ durch die hohen Temperaturen das nicht feuerfeste Tiegelmaterial zu schnell reißen oder schmelzen. Am effektivsten war schließlich folgende Rekonstruktion. Sie entsprach auch weitgehendst den beobachteten Brandspuren an bronzezeitlichen Tiegeln: Um den Tiegel herum und auch darüber wurde Holzkohle aufgeschichtet, eine abgewinkelte, auf einem Sandstein plazierte Tondüse regelte die Luftzufuhr von oben. Die Schmelze selbst lief dann folgendermaßen ab:
„Durch die Öffnungen zwischen den glühenden Kohlestückchen konnte dieser Vorgang beobachtet werden: Zunächst fing das Kupfer an zu ‚schwitzen’, d.h. es bildeten sich kleine Tröpfchen an der Oberfläche, die besonders gut zu beobachten sind, sobald die Luftzufuhr etwas aussetzt. Ist das ‚Schwitzen’ erreicht, dauert es nur noch kurze Zeit, bis das Kupfer schmilzt und mit dem Zinn eine Legierung eingeht. [...] Zwischen den Holzstückchen ist nun die spiegelnde Oberfläche der flüssigen Bronze zu erkennen, auf der als dünne Schollen, Schlacken und Verunreinigungen schwimmen.“[5]
Diese mußten vor dem Guß selbst z.B. mit grünem Holz entfernt werden. Der Vorgang des Gusses selbst mußte sehr schnell vonstatten gehen, die Bronze blieb im allgemeinen höchstens 10 bis 15 Sekunden flüssig.
Zu Beginn der Bronzezeit waren die Gußtechniken eher einfach. Vornehmlich ist hier der offene Herdguß zu nennen, bei dem die Form eine einseitige Vertiefung erhält, in die die flüssige Bronze eingegossen werden konnte. Die andere, unprofilierte Seite des Werkstückes mußte danach noch mit weiteren Werkzeugen bearbeitet werden.
Eine weitere Variante dieses Gußverfahrens ist der verdeckte Herdguß, bei dem die Form nach dem Guß mit einer ebenen Steinplatte bedeckt wurde. Auch hier bleibt eine Seite des Werkstückes flach. Als Beispiele für den Herdguß wären die frühbronzezeitlichen Ösenring- und Spangenbarren, Dolchklingen oder Nadeln mit Scheiben- oder Ruderkopf zu nennen.
Mit der Aunjetitzer Kultur entwickelten sich komplexere Gußformen. Dazu gehörten der Schalen- bzw. Kokillenguß und der Guß in der verlorenen Form sowie der Kernguß.
Für den Schalenguß besteht die Form aus mindestens zwei Teilen, die für den Guß zusammengesetzt und nach Abkühlen des Werkstücks wieder abgehoben werden. Das Material für die Formhälften war sehr unterschiedlich. So wurden dafür verschiedene Steinsorten wie feiner Sandstein, Schiefer, Gneis oder Speckstein oder Bronze benutzt werden.
Charakteristisch für im Schalenguß hergestellten Stücke ist die Gußnaht, da die Verbindung zwischen den Schalen nicht fest war, sondern entweder durch ineinandergreifende Vorsprünge im Material oder durch Löcher an der Verbindungsnaht, realisiert wurden, in die Stifte eingesetzt wurden. Experimente zeigten, daß ein Guß mit eng sitzenden Formhälften weniger erfolgreich waren, als einer, bei dem die Schalenhälften leicht verrutschten[6]. Ebenfalls war es notwendig in diese Formen Windpfeifen einzubauen, damit die Luft beim Guß selbst entweichen konnte.
Wahrscheinlich ist, daß Steinformen - v.a. die ohne Windpfeifen und erkennbare Brandspuren - nicht zum direkten Gießen verwendet wurden, sondern als Modellvorlage für den Guß in der verlorenen Form dienten[7].
Bei diesem Gußverfahren wird das Original zunächst als ein Wachsmodell vorgeformt. Dieses erhielt danach einen feinen Lehmüberzug und einen Mantel aus grob gemagerten Lehm. Durch den Zusatz von organischem Material wurde der Lehm so porös, daß Windpfeifen nicht mehr notwendig waren. Beim Brennen der Lehmform schmolz das Wachs und floß aus dem Modell heraus. Nach dem Guß mußte allerdings die Form zerstört werden, um das Werkstück zu entnehmen, und war somit verloren.
Schalenguß und Guß in der verlorenen Form konnten auch miteinander kombiniert werden. So wurden z.B. Tüllenäxte mit Öhr zuerst im Schalengußverfahren ohne Öhr gegossen, dann das Öhr frei mit Wachs angesetzt und als Guß in der verlorenen Form bzw. Überfangguß (s.u.) gegossen.
Für Hohlkörper wie z.B. Tüllenbeile, ist noch eine weitere Gußart bekannt: der Kernguß.
Die vorbereitete Form, wurde innen mit Lehm ausgedrückt. Dieser Kern wurde dann entnommen, um die gewünschte Wanddicke beschnitten und mit Brücken bzw. Stiften wieder zum Guß eingesetzt. Eine andere Möglichkeit ist auch das Vormodellieren des Kerns. Dieser wird dann mit einer Wachsschicht überzogen und erst danach von der Gußhülle als Schalen- oder verlorene Form ummantelt. Der Kernguß wurde in allen Perioden angewandt.
Eine weitere Sonderform ist der sogenannte Überfangguß, mit dem v.a. kompliziertere Werkstücke mit mehreren Gußvorgängen hergestellt oder auch Reparaturen durchgeführt wurden[8].
Diese bisher vorgestellten Gußtechniken sind archäologisch relativ gut belegbar. Nicht belegbar hingegen ist der Formsandguß. Dabei wird ein Modell zur Hälfte in zähen, in einem Kasten befindlichen Sand oder Lehm gedrückt. Eine zweite Kastenform wird übergestülpt und wieder aufgeklappt, danach das Modell entnommen, die Gußtrichter eingeschnitten und das Ganze wieder zusammengefügt. Diese Gußart ist archäologisch generell nicht nachweisbar, da nur Sand und ein Holzkasten verbleiben, jedoch aufgrund ethnologischer Parallelen anzunehmen[9].
3 Siedlungsfunde
3.1 Allgemein
Im folgenden werde ich mehrere Beispiele für einige bisher bekannte und umfangreicher publizierte Funde von Ofenanlagen darlegen.
Oft werden in den verschiedenen Publikationen von Siedlungen oder zum Bronzeguß allgemein Gießereifunde erwähnt. Sie sind jedoch bisher nur selten ausführlich analysiert und beschrieben. So benennt z.B. A. GÖTZE in dem Artikel „Bronzeguß“ im Reallexikon der Vorgeschichte10 die Gießereiwerkstätten Haag in Ostjütland und St. Peter bei Görz oder GOLDMANN11 ein von JAANUSSEN publizierter Befund12 eines Hauses mit 12 Schmelzöfen in Hallunda (bei Birka, Schweden). Gefunden wurden dort Fragmente von 40 Schmelztiegeln und 70 Gußformen, datiert auf 1000 v.u.Z. Derartigen Angaben im großen Umfang jedoch nachzugehen und zu beschreiben, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Auch die Beschreibungen außergewöhnlicher Gußformen in Siedlungen, wie die des Nagelbaums aus der Wasserburg Buchau oder der Gußformen für Stäbe von Göttingen Walkemühle werden im folgenden vernachlässigt.
Die Funde beschränken sich alle auf den deutschsprachigen mitteleuropäischen Raum. Bis auf den Fund in Buchberg, welcher frühbronzezeitlich datiert wird, gehören alle Funde chronologisch zur Spätbronzezeit, beschreiben aber meist verschiedene Produktionsstadien oder wurden zu unterschiedlichen Fragestellungen untersucht, so daß vermutlich ein relativ breites Spektrum vorgestellt wird.
3.2 Buchberg
An dem Fundort der Höhensiedlung Buchberg bei Wiesing, Tirol wurden 1992 während der archäologischen Begleitung eines Wegebaus zahlreiche Schlacken und Rohkupferstücke zusammen mit frühbronzezeitlicher Keramik geborgen. Bei der 1994 von W. Sydow geleiteten Grabung wurde weiteres metallurgisches Material wie Rohkupferstücke, technische Keramik und Erzstücke, jedoch kein Schmelzplatz in situ gefunden.
Gefunden wurden eine Blasrohrdüse, die vermutlich erst zum Kupferguß eingesetzt worden war13, ein Schmelztiegel, dessen ursprüngliche Form zwar nicht mehr rekonstruierbar ist, aber vermutlich aufgrund seiner Stellfläche ein Vorratsgefäß war, das nur sekundär als Schmelztiegel verwandt wurde14. Die Verschlackung des Schmelztiegels zeigte eine Hitzeeinwirkung von oben an, so daß ein ähnlicher Schmelzvorgang wie der von JANTZEN beschriebene möglich ist.
Die Analyse des Erzes ergab, daß das Kupfer in dem Bergwerk Schwaz-Brixlegg abgebaut wurde. Das Erz aus Schwaz-Brixlegg besaß einen recht hohen Kupfergehalt, und bot somit eine „[…] plausible Erklärung für die Verhüttung der Erze abseits der Lagerstätte. Ein ‚Rucksack voll’ (20 kg) von diesem Erz reicht selbst unter Annahme hoher Verluste durch einen unvollkommenen Schmelzprozeß für die Produktion von wenigstens einem Kilogramm Kupfer.“15
Interessant sind auch weitere Ergebnisse der Metallanalysen. Demnach wurden dem Erz beim Schmelzen außer Kalkstein auch Buntsandstein und Quarzphyllit sowie Schlacke bzw. Schlackensand zugeschlagen. Der Schmelzprozeß selbst lief wahrscheinlich einstufig ab, da aufgrund des geringen Eisengehaltes und hohen Anteil oxidischer Kupferminerale auf den Röstvorgang verzichtet wurde. Auch sulfidisches Kupfererz brauchte nicht geröstet werden, da mit Kupferkarbonat zusammen verhüttet wurde. Dabei verbinden sich Sulfide und der Sauerstoff zu Schwefeldioxid. Dies setzt allerdings einen oxidierenden Brand voraus: „Die dargestellten Prozesse der Kupfergewinnung laufen am besten in einer flachen Herdmulde unter Holzkohle ab. Mit einem starken Gebläse (z.B. Blasebalg) kann die für den Prozeßablauf nötige Temperatur (ca. 1200° C) und eine oxidierende Atmosphäre im Reaktionsbereich erreicht werden. In einem Schachtofen würden die Schmelzreaktionen in einer reduzierenden Atmosphäre verlaufen und es wäre völlig andere Befunde zu erwarten.“16
Laut einer kallibrierten 14 C-Datierung bestand die Siedlung zwischen 1955 und 1885 v.u.Z. Der Fund fällt somit in eine Zeit des technischen Übergangs von der Verarbeitung oxidischer Erze zur Verarbeitung von Fahlerzen und könnte somit diesen technischen Übergangszustand belegen.
3.3 Walkemühle
Die Untersuchungen zu den metallurgischen Funden der in den 1960er Jahren gegrabenen urnenfelderzeitliche Siedlung Göttingen Walkemühle wurde 1988 von H. DRESCHER publiziert17.
In einer am Nordrand der Siedlung ausgegrabenen, unregelmäßig geformten Grube fanden sich „[...] typische Schmelzschlacke [...]“18, eine Wandungsscherbe eines Tiegels und 92 Gießformfragmente aus gebrannten Lehm. Darunter waren u.a. Gießformen für Stäbe, für ein Tüllenbeil bzw. einen Tüllenmeißel, eine Gußhälfte einer Lanzenspitze und Gußformen für sechs weitere Gegenstände. „Die Lage der meisten Gießformen in der Hauptfundschicht zeigt [...], daß die Keramik mit den Gießformen in einem Vorgang - vielleicht an einem einzigen Tag - eingebracht worden sind.“19 Andererseits ist es auch möglich, daß die weite Streuung der Funde „[...] auf eine ausgedehnte Tätigkeit hindeuten [...]“20. Ebenfalls wurde ein unbenutzter Napf gefunden: „Wozu der kleine Napf bestimmt war, konnte nicht ermittelt werden. Doch wäre er z.B. zum Schmelzen von Zinn, aber auch Gold geeignet gewesen.“21
Als Herdeinfassung werden drei Lehmbruchstücke angesprochen, die z.T. Spuren starker Hitzeeinwirkungen besitzen. Sie „[…] zeigen den Übergang vom vielleicht im Boden oder unmittelbar darübersitzenden unteren rauhen Teil der Wandung zum oberen, der mit parallelliegenden tiefen Fingerstrichfurchen verziert ist.“22 Sie wurden in einer Grube gefunden, in der sonst keine Gießereifunde vorkamen und könnten demnach auch anderen Tätigkeiten zugeordnet werden.
Die Ofenkuppel rekonstruiert DRESCHER als ein Gerüst runder Stäbe, die mit Lehm geschlossen wurden. Dies sei ein übliches Verfahren zum Bau von Schmiedeessen, Backöfen, Rennfeueröfen und Schmelzöfen.
Methodisch kritisch äußert sich der Autor gegenüber dem Fund von zerschmolzenen Bronzestücken: „Solche Metallreste stammen in Gießereibereichen in der Regel vom Schmelzen bzw. Gießen des Metalls. Sie haften an Schlacken, an den Tiegeln, an den Ofenwandungen und an Gießformen, oder es ist Metall, das beim Gußvorgang verspritzt ist, oder es stammt von Fehlgüssen. Bei Siedlungsfunden besteht aber auch die Möglichkeit, daß es Teile von Metallgegenständen sind, die bei Schadenfeuern verbrannten. Diese Funde [...] lassen sich daher nur mit Vorbehalt zuordnen.“23
Insgesamt ist zu sagen, daß es sich bei dem beschriebenen Befund eindeutig um Überreste einer metallurgischen Tätigkeit in Göttingen-Walkemühle handelt. Jedoch ist ungeklärt, welche Stellung diese Tätigkeit innerhalb der Siedlungsaktivitäten hatte. Ein Ofen in situ wurde nicht nachgewiesen.
3.4 Taltitz
In den 1950er Jahren wurden von Gerhard BILLIG24 in Taltitz bei Plauen eine mehrphasige Siedlung mit dazugehörigem Friedhof ergraben, die in die ausgebildete Jungbronzezeit bis beginnende Jüngstbronzezeit (nach Lausitzer Gliederung) zu datieren ist.
Schon 1936 hatte hier Amandus HAASE eine von einem Flechtzaun umgebene Ofenanlage gefunden.
Der Ofenbefund zeigt folgendes Bild:
„ [...] zwei abgerundet-rechteckige Gruben mit ebenem Boden und steilkonischen Wänden von rund 0,5 m Länge und 0,3 m Breite bzw. Tiefe, die durch einen ‚flachen Kanal’ miteinander verbunden waren. ‚Zwischen den Gruben war der Boden kreisförmig stark gerötet’. Eine flach-muldenförmige Erweiterung dieser Rinne in der Mitte wies besonders intensive Hitzespuren auf, jedoch fehlten offenbar Hinweise auf Verschlackung bzw. Versinterung.“25
SIMON rekonstruiert diese Ofenanlage nach ägyptischen und griechischen Vorbildern in Form eines hochgebauten Schachtofens, „[...] wie er gewöhnlich zum Erzschmelzen vorrausgesetzt [...] wird.“26
Demnach sind die zwei vorgefundenen Gruben keine Schmelz- sondern eher Gebläsegruben, in denen zwei Kupferschmelzer standen bzw. saßen und mit jeweils einem Gebläse die Temperatur im Ofen gleichmäßig aufrechthielten. Diese Vermutung belegt der Autor mit Standspuren und Absätzen in den Gruben, die als Sitzbank fungiert haben könnten.
Vom Ofen selbst sind nur noch die Standspuren erhalten. „Solche Überlieferung teilt er mit den meisten Belegen in aller Welt, denn die Öfen wurden oft gleich nach Gebrauch bis zum Fuße abgebaut, um auch die metallhaltigen Mantelschlacken zurückzugewinnen und Platz für neue Anlagen zu schaffen.“27 Insgesamt nimmt SIMON ein sehr kleines Ofenvolumen an.
Die Erz- und Schlackereste weisen auf eine reine Kupferproduktionsstätte mit der typischen Gangart dieser Gegend hin.
Derartige Ofentypen sind auch aus dem 14.-12. Jh. v.u.Z. in Verhüttungslagern im Timnatal in Südisrael belegt28 und ihre Effektivität experimentell bestätigt29. Eine Parallele glaubt SIMON auch in den 1987 untersuchten Schmelzofenresten von Parchim in Mecklenburg zu finden30. Ergraben wurden hier zwei durch eine Rinne miteinander verbundene Gruben, wobei die tiefere von beiden sowohl Siedlungsreste als auch Schlackestücke enthielten, sowie einen ganzen und Fragmente mehrerer Düsenziegel und einen Schmelztiegel. Dieser Ofen wurde wahrscheinlich nur mit einem Gebläse bzw. einem zweikammrigen Gebläse bedient.
SIMON nimmt, wahrscheinlich dem Standort entsprechend, an, daß der Ofen nicht der Verhüttung sondern dem Aufschmelzen von Barren- und Altmaterial diente. Verwunderlich ist ein wenig, daß der Ofen von Taltitz, wenn auch mit einem Flechtzaun abgeschirmt, mitten in der Siedlung steht, obwohl derartige Anlagen oftmals außerhalb der Siedlungen vermutet werden, da sie einen enormen Holzbedarf haben und gleichzeitig aufgrund der hohen entstandenen Temperaturen sehr gefährlich waren. Andererseits glaubt SIMON, daß die Metallurgie trotz der schlechten landwirtschaftlichen Vorraussetzungen nahe am Gebirge der Siedlung „[...] zwingende lokale Standortvorteile [...]“31 bot.
Zusammengefaßt interpretiert der Autor den Ofen u.a. aufgrund seiner Lage und seiner geringen Größe als ein Versuchsofen, der „[…] analog dem sogenannten Probieren in den Bergstätten des Mittelalters, mehr einer Prüfung der Verwertbarkeit von Erzen als dem regulären Hüttenbetrieb gedient [...]“32 hat.
Dieser Schluß ist durchaus nachvollziehbar, da der logistische Aufwand für das Schmelzen von Kupfer sehr hoch ist und man sicherlich auch in der Bronzezeit den Aufwand und Nutzen einer solchen Unternehmung abwiegen mußte. Insgesamt bleibt diese Interpretation jedoch eine Theorie, die nicht vollständig überprüfbar ist.
3.5 Heidenschanze
Die Bronzeschmelzstätte auf der sog. Heidenschanze von Dresden-Coschütz wurde 1967 von A. PIETZSCH ausgegraben und galt lange Zeit als einzigartig. Zeitlich wird die Siedlung in das „[...] ältere Billendorf [...]“33, d.h. in die frühe Hallstattzeit datiert.
Der Fundort war schon seit den 1930er Jahren bekannt und wurde aufgrund des dortigen Steinbruchbetriebes seitdem mehrmals in Notgrabungen untersucht. Jedoch ist die Quellenlage ziemlich schlecht, da Teile des Befundes schon vor der Untersuchung abgebaut waren.
Gefunden wurde eine „[...] große Schmelzgrube […]“ mit einer „[...] Lehmtenne […]“ als Fundament, unter der sich „ […] ein reiches, noch nicht restlos verbranntes, großklobiges Holzkohlelager mit einzelnen eingestreuten faustgroßen Steinen […]“34 befand. Die Tenne wurde von einem „[...] deutlich abgesetzte(n) und glattgestrichene(n) Lehmsockel […]“35 getragen. Sowohl Lehm als auch zur Grube gehörige Steine zeigten deutliche Spuren eines Brandes mit hohen Temperaturen. Ebenfalls gefunden wurde ein „[…] einwandfrei erkannte(r) Kanal […]“36, der jedoch nicht in einer Grabungsdokumentation festgehalten wurde, weiterhin mehrere Schmelzwannen, Gußkuchen und technische Keramik. Das Ganze deutet PIETZSCH als einen Kuppelbronzeschmelzofen am Rande einer Höhensiedlung, der mit Hilfe eines sehr langen Windkanals am Abhang belüftet worden ist.
Ähnliche Funde seien auch an anderen Höhensiedlungen gemacht worden. Daher kommt PIETZSCH zu folgendem Schluß:
„Die Bronze- und früheisenzeitlichen Gießerwerkstätten liegen hauptsächlich auf leichteren Erhebungen im Flachland, an Hängen, Höhen und Bergen. Dies Örtlichkeiten tragen in nicht geringer Zahl offene und befestigte Siedlungen. Je wichtiger nun eine solche Anlage ist, desto sicherer finden wir die Zeugen handwerklicher Tätigkeit, bei der unter anderem der Bronzeguß eine besondere Stellung einnimmt.“37
Die weiteren als Schmelzwannen angesprochenen Gruben wurden vom Autor als eine zweite Art Ofen interpretiert: „Hierbei können wir nun feststellen, daß es zwei Arten von Schmelzöfen gegeben hat. Die großen Öfen, die einen Schlackekuchen hinterließen, dienten der Erzverhüttung. […] Die kleineren Öfen dagegen waren für das Umschmelzen der Schmelzkuchenstücke sowie kleinerer Mengen Gerätebruch für den Form- und Geräteguß hergerichtet.“38
Interessant ist, daß sich unter dem Befund von Pietzsch Ofenanlage teilweise in Fels eingehauene Pfostengruben befanden, die „[...] sehr schwer drei Reihen erkennen […]“39 ließen. PIETZSCH interpretiert sie als eine Stützkonstruktion. Die rekonstruierte Ofenanlage fand nirgendwo auf der Welt eine Parallele. Aus diesem Grund gab es auch Anfang der 1990er Kritik an PIETZSCHS Interpretation: „In aller Welt und zu allen Zeiten war die urtümliche Kupfergewinnung auf winzige Schmelzapparate angewiesen [...]“40, kritisiert SIMON die Größe der Anlage. Zwar
seien aufgrund der geographisch-geologischen Gegebenheiten „[...] Verhüttungsanlagen [...] gerade hier zu erwarten; in der rekonstruierten Art und Weise haben sie jedoch ganz gewiß nicht existiert.“41 Der publizierte Befund entspräche eher einem Haus mit Backofenanlage.
Jedoch gäbe es auf der Grabungfläche der Heidenschanze einen 1940 von H. DENGLER ausgegrabenen Befund42, der wiederum dem Taltitzer Ofen ähnlich sei. Der von PIETZSCH als Töpferofen angesprochene birnenförmige Ofen besaß zwei Verzieglungshorizonte mit aufliegendem Holzkohleband. Dies spricht für eine wiederholte Nutzung. Eine größere Anzahl an zerbrochenen Düsen belegt eine zusätzliche Luftzufuhr.
Die Kritik an PIETZSCHS kann gerade aufgrund der Einzigartigkeit dieses Befundes durchaus berechtigt sein. Eine genauere Untersuchung würde wahrscheinlich wegen der schon erwähnten schlechten Quellenlage erschwert und steht m.W. noch aus.
3.6 Urnenfelderzeitliche Siedlungen Süddeutschlands
A. JOCKENHÖVEL hat in den 1980er Jahren 34 Fundstellen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern untersucht und somit eine Übersicht über die süddeutsche Metallverarbeitung der Urnenfelderzeit geschaffen43.
Funde von Ofenanlagen selbst konnte JOCKENHÖVEL nicht feststellen, wohl aber eine größere Anzahl von Gußkuchen, Gußtiegelfragmente, Gußformen und Kannelurensteine, die als „Klopfsteine“ im Metallgewerbe gedeutet werden. Somit kann auch hier eindeutig das Metallhandwerk nachgewiesen werden. Herausragend aus den von JOCKENHÖVEL beschriebenen Funden ist vermutlich die ehemalige Rheininsel von Säckingen. Hier wurden vom Ausgräber E. GERSBACH zwei Gruben als Schmelzwannen interpretiert, die JOCKENHÖVEL daraufhin als „ [...] einfache Grubenöfen [...]“44 anspricht. Zudem lieferte das Fundspektrum eine hohe Anzahl weiterer verschiedener Objekte wie „[...] Schmelztiegel aus Stein und Ton, Reste einer Ofensau, Bronze- und Zinnbarren, [...] ein Kannelurenstein und steinerne Gußformfragmente für Messer, Ringlein und Nadel (?) [...]“45.
C. SEEWALD ist dabei der Meinung, daß „[...] hier eine gewissen ‚Industrialisierung’ stattgefunden hat, die das Herstellen von Bronze und den Bronzeguß zum Ziel hatte. Hierzu gehören wohl zwei aufgedeckte Bronzeschmelzereien, falls sie urnenfelderzeitlich einzuordnen sind.“46
Einen weiteren Hinweis auf einen Ofen könnte auch die „[...] recht stattliche Tondüse von Buchau [...]“47, sowie mehrere Schlackereste Gußabfälle liefern. Die Schmelztiegel ordnet JOCKENHÖVEL sowohl der Aufbereitung der Erze als auch dem Bronzeguß zu: „Ihre Zuordnung ist fraglich, denn es kann nicht ausgeschlossen werden, daß sie ausschließlich im Bereich der Fertigung - als Gußtiegel während des Gußvorgangs - benutzt wurden.“48 Weitere Angaben zu Benutzungsspuren der Tiegel fehlen.
Auf dieses Manko weist der Autor auch bei der Beschreibung der Gußformen hin: „Die Gußformen sind, soweit Angaben hierzu vorliegen, geschwärzt oder zeigen sonstige Spuren der Hitzeeinwirkung, die auf einen ehemaligen Ausguß schließen lassen; bei den meisten fehlen jedoch in den Publikationen Hinweise auf eine Benutzung. So muß die sehr wichtige Frage noch unbeantwortet bleiben, ob die Steingußformen auch als Gußmodelle gedient haben.“49
Als Ergebnis seiner Untersuchungen kommt JOCKENHÖVEL zu dem Schluß, daß in den untersuchten Siedlungen vor allem kleinere Alltagsgegenstände im Bronzegußverfahren hergestellt wurden. „[…] Qualitätserzeugnisse, wie Schwerter, Werkzeuge und Ringschmuck […]“50 hingegen fehlen. Eine Aussage zu der Wichtigkeit bestimmter Siedlungstypen (befestigte Siedlung, Höhensiedlung, offene Siedlung und Uferrandsiedlung) in bezug auf die Metallverarbeitung kann er aufgrund des Forschungsstandes nicht machen51.
Leider sei der Forschungsstand insgesamt „ […] ungenügend […]“52, gerade im Hinblick auf die Wirtschaftsgeschichte.
Zwar ist es gerade für Siedlungen der Bronzezeit oftmals schwer, konkrete Aussagen zu ihrer Wirtschaft und deren Organisation zu treffen, doch fehlt es m.W. weniger an Einzelpublikationen zu den Siedlungen, sondern mehr an Überblicksdarstellungen, wie JOCKENHÖVEL sie gegeben hat, und damit auch an konkreten Fragestellungen und Lösungsansätzen für die verschiedenen Regionen.
4 Zusammenfassung
Die Fundlage für den Bronzeguß in Siedlungen ist insgesamt eher spärlich. Gründe dafür gibt es viele. Zum einen ist der Forschungsstand der bronzezeitlichen Forschungen in bezug auf Siedlungen relativ niedrig anzusetzen, „[...] aber auch Quellenlage und Befundsituation sowie gewisse Erhaltungsbedingungen schränken die Fundstatistik stark ein.“53
So gibt es z.B. für die Frühe Bronzezeit bis auf Pfahlbauten in Seeufersiedlungen kaum Siedlungsfunde, nicht einmal siedlungsanzeigende Gruben. Trotz vermehrter Siedlungsfunde in hügelgräber- und urnenfelderzeitlichen Siedlungen ist auch hier die Quellenlage für bronzezeitliche Metallverarbeitung eher gering.
Eine mögliche Ursache wäre, daß die Werkstätten aufgrund der Feuergefahr und der riesigen benötigten Holzmengen, vermehrt außerhalb der Siedlungen gelegen haben und daher, bis auf wenige Ausnahmen, noch nicht ergraben worden sind. Weiterhin sind auch die Erhaltungsbedingungen für die schlechte Fundsituation verantwortlich. Die am häufigsten gefundenen Gußformen sind solche aus Stein, während bronzene Gußformen nach ihrer Abnutzung wahrscheinlich dem Metallkreislauf wieder zugeführt worden sind. Formen aus Ton wurden nach ihrem Guß im Wachsausschmelzverfahren zerschlagen und sind in zahllose Einzelteile zersprungen, was „...ihre Erhaltung und Entdeckung im Boden, von der stets unsicheren Ansprache, welche Metallformen ausgegossen wurden, einmal abgesehen [...]“54 stark erschwert.
Dieses Beispiel verweist somit auf das nächste Problem, welches die Quellenlage ebenfalls erschwert: das Problem der Beobachtungsmöglichkeiten. So sind z.B. kleinflächige Schmelzplätze, archäologisch kaum nachweisbar.
Auch die im Experiment von JANTZEN beschriebenen Feuerstellen wären nur schwer als Schmelzplätze erkennbar.
So schreibt der Autor:
„Als archäologischen Befund wären Feuerstellen der zuletzt beschriebenen Art nur sehr unscheinbar, sofern überhaupt von speziell angelegten Feuerstellen die Rede sein kann; im Prinzip ist jedes vorhandene Herdfeuer für diesen Zweck geeignet. Es wäre nur dann als Herdfeuer erkennbar, wenn entsprechende Funde - Tiegel, Formen, Metalltropfen u.a. - vorhanden sind. Auch Feuerstellen mit einem Sandstein oder einer Lehmplatte für den Tiegel, wie sie in geringer Zahl bekannt sind, könnten als Schmelzplätze gedeutet werden, sofern die entsprechenden Funde vorhanden sind.“55
Auch das Forschungsproblem der ‚fehlenden Gußformen’ könnte ein Problem der Beobachtungsmöglichkeiten der Archäologen sein. So ist es durchaus möglich, daß die von GOLDMANN beschriebene Methode des Formsandgusses56 für „[…] eine Reihe offener Probleme eine einfache und technologisch einsichtige Lösung […]“57 wäre.
Letztlich ist auch zu bedenken - und dies gilt für alle Zeiten und Fundgattungen -, daß bei einer „[...] bewußt aufgegebenen Siedlung [...] sicherlich alle materiellen Werte mitgenommen worden [sind], während dagegen eine zerstörte und/oder plötzlich verlassene Siedlung wesentlich mehr entsprechende Funde liefert.“58 Ein weiterer Problembereich entsteht bei der Deutung der vorhandenen Metallverarbeitungsstätten. War die Herstellung von bronzenen Gegenständen ein Wander- oder ein ortsansässiges Handwerk? War speziell der Bronzeguß „Hauswerk“, das die meisten Menschen beherrschten, oder konnten nur wenige Spezialisten alltägliche Gegenstände wie Sicheln, Beile etc. herstellen? Wurde das Handwerk von einer Elite aus kontrolliert?
JOCKENHÖVEL geht z.B. davon aus, „[...] daß in vielen Siedlungen - besonders den offenen, kein Metall verarbeitet wurde; sie waren demnach abhängig von Nachbarsiedlungen. In vielen anderen wurden im Rahmen eines ‚Hauswerks’ die alltäglichen Arbeitsgerät, wie Sicheln, Beile usw., und Kleinschmuck hergestellt.“59 KRAUSE ist hingegen der Meinung, daß nur „[...] die exponiert liegenden Siedlungen mit metallverarbeitenden Werkstätten [...] Privileg und herrschaftlichen Anspruch [...]“ hatten, „[...] die Kontrolle über die Gewinnung und Verarbeitung des wertvollen Materials auszuüben.“60
WILLROTH wiederum gibt folgendes zu bedenken: „Der Metallbedarf einer Siedlung sollte trotz der Sitte der Grabbeigabe metallener Bewaffnungs- und Trachtbestandteile nicht überschätzt werden. [...] Reparaturen waren möglich und nötig, aber sicher nicht alltäglich. So konnte sich der Aufwand für eine kleine Gruppe in einem Gehöft oder einem Weiler auf eine Arbeit von wenigen Tagen im Jahr beschränken.“61
Obwohl die Meinungen verschieden sind, ist es möglich, daß alle für eine bestimmte Region und Zeit relevant sind. Dasselbe gilt auch für die verschiedenen Konstruktionen der Öfen.
Weitere Fragen gab es zur Wirtschaftsgeschichte: Gab es Probeöfen, wie sie SIMON für Taltitz annimmt? Welche Ofenart wurde wirklich genutzt? Und schließlich wer war wann auf welchem technologischen Stand?
All diese Fragen sind aufgrund der unzureichenden Quellenlage nur schwer beantwortbar. Es können lediglich Einzelfälle dargestellt und auch - wie bei Taltitz - rekonstruiert werden. Verallgemeinerungen sind somit so gut wie unmöglich.
Literatur:
- D. Becker: Bronzezeitliche Schmelzofenreste von der Gemarkung Parchim. In: Ausgrabungen und Funde 34. 1989. S. 129-132
- H. Drescher: Der Überfangguß. Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Metalltechnik. Mainz. 1958
- H. Drescher: Die Gießereifunde der Siedlungsgrabung an der Walkemühle in Göttingen. In: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 18. 1988. S. 147-160
- K. Goldmann: Guß in verlorener Sandform - das Hauptverfahren alteuropäischer Bronzegießer. In: Archäologisches Korrespondenzblatt 11. 1981. S. 109-116
- A. Götze: Bronzeguß. In: M. Ebert: Reallexikon der Vorgeschichte II. Berlin 1925. S. 147-162
- D. Jantzen: Versuche zum Metallguß der nordischen Bronzezeit. In: Experimentelle Archäologie. Bilanz 1991. (= Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland. Beiheft 6) Oldenburg 1991. S. 305-316
- H. Jaanusson: Smärre meddelanden. Bronsålden bodplatsen vid Hallunda. In: Fornvännen 66. 1971. S. 173-85
- A. Jockenhövel: Struktur und Organisation der Metallverarbeitung in urnenfelderzeitlichen Siedlungen Süddeutschlands. In: Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 20. 1986. S. 213-234
- W. Kimmig: Die « Wasserburg Buchau » - eine spätbronzezeitliche Siedlung. (= Materialhefte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg. Heft 16). Stuttgart 1992
- R. Krause: Vom Erz zur Bronze. Bergbau, Verhüttung und Bronzeguß. In: Goldene Jahrhunderte. Die Bronzezeit in Südwestdeutschland. (= ALManach 2). Stuttgart 1997. S. 26-40
- K.-P. Martinek: Archäometallurgische Untersuchungen zur frühbronzezeitlichen Kupferproduktion auf dem Buchberg bei Wiesing, Tirol. In: Fundberichte aus Österreich 34. 1996. S. 575-584
- B. S. Ottaway: Prähistorische Archäometallurgie. Espelkamp 1994
- A. Pietzsch: Bronzeschmelzstätten auf der Heidenschanze in Dresden-Coschütz. In: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 19. 1971. S. 35-68
- C. Seewald: Die urnenfelderzeitliche Besiedlung der ehemaligen Rheininsel von Säckingen und ihrer Umgebung. In: Badische Fundberichte 21. 1958. S. 93-127
- K. Simon: Ein Schmelzofen der späten Bronzezeit aus dem sächsischen Vogtland. In: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 35. 1992. S. 51-82
- R. F. Tylecote: Casting copper and bronze into stone moulds. Bulletin of the Historical Metallurgy Group 7. 1973. S. 1-5
- G. Weber : Händler, Krieger, Bronzegießer. Bronzezeit in Nordhessen. (= Vor- und Frühgeschichte im Hessischen Landesmuseum in Kassel. Heft 3). Kassel 1992
- K.-H. Willroth: Metallversorgung und -verarbeitung. In: G. Wegner (Hrsg.): Leben - Glauben - Sterben vor 3000 Jahren. Bronzezeit in Niedersachsen. (= Begleithefte zu Ausstellungen der Abteilung Urgeschichte des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover. Heft 7). Oldenburg 1996. S. 67-81
[...]
1 s. A. Jockenhövel: Struktur und Organisation der Metallverarbeitung in urnenfelderzeitlichen Siedlungen Süddeutschlands. In: Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 20. 1986. S. 213-234
2 z.B. Rudna Glavna im ehem. Jugoslawien und Aibunar in Bulgarien 3
3 Dabei wurde das Gestein mit einem Feuer erhitzt und mit Wasser wieder abgekühlt. Da sich das Erz und das Nebengestein bei Hitze- und Kälteeinwirkung unterschiedlich ausbreiten und wieder zusammenziehen, platzte das Gestein und konnte dann mit Hilfe von gewässerten Holzkeilen, Schlägeln und Beilen abgebaut werden.
4 D. Jantzen: Versuche zum Metallguß der nordischen Bronzezeit. In: Experimentelle Archäologie. Bilanz 1991 (= Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland. Beiheft 6). Oldenburg 1991. S. 305-316
5 a.a.O.: S. 311
6 R.F. Tylecote: Casting copper and bronze into stone moulds. In: Bulletin of the Historical Metallurgy Group 7. 1973. S. 1-5
7 s.a. A. Götze: Bronzeguß. In: M. Ebert: Reallexikon der Vorgeschichte. Berlin 1925. S. 147-162 6
8 s.a. H. Drescher: Der Überfangguß. Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Metalltechnik. Mainz 1958
9 s.a. K. Goldmann: Guß in verlorener Sandform - das Hauptverfahren alteuropäischer Bronzegießer. In: Arch. Korrespondenzblatt 11. 1981. S. 109-116
10 A. Götze: Bronzeguß. S. 147
11 K. Goldmann: Guß in verlorener Sandform. Anm. 10
12 s.a. H. Janussen. Smärre meddelanden. Bronsålder bodplatsen vid Hallunda. In: Fornvännen 66. 1971.
S. 173-185
13 K.-P. Martinek: Archäometallurgische Untersuchungen zur frühbronzezeitlichen Kupferproduktion auf dem Buchberg bei Wiesing, Tirol. In: Fundberichte aus Österreich 34. 1996. S. 582
14 a.a.O.: S. 583
15 a.a.O.: S.577
16 a.a.O.: S. 579
17 H. Drescher: Die Gießereifunde der Siedlungsgrabung an der Walkemühle in Göttingen. In: Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 18. 1988. S. 147-166
18 a.a.O.: S. 155
19 a.a.O.: S. 161
20 ebd.
21 a.a.O.: S. 155
22 a.a.O.: S. 156
23 ebd.
24 G. Billig: Ur- und Frühgeschichte des sächsischen Vogtlandes. Plauen 1954
25 K. Simon: Ein Schmelzofen der späten Bronzezeit aus dem sächsischen Vogtland. In Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 35. 1992. S. 53
26 a.a.O.: S. 55
27 a.a.O.: S. 61
28 s.a. H.-G. Bachmann/B. Rothenburg: Die Verhüttungsverfahren von Site 30. In Antikes Kupfer im Timna-Tal. 4000 Jahre Bergbau und Verhüttung in der Arabah (Israel). Bochum 1989. S. 215-236
29 s.a. J.F. Merkel: Experimental Reconstruction of Bronze Age Copper Smelting Based on technological Evidence from Timna. In: The ancient metallurgy of copper: archeology-experiment-theory. London 1990.
S. 78-122
30 publ. v. D. Becker: Bronzezeitliche Schmelzofenreste von Parchim. In: Ausgrabungen und Funde 34. 1989.
S. 129-132
31 Simon: Ein Schmelzofen. S. 53
32 a.a.O.: S. 55
33 a.a.O.: S. 67
34 A. Pietzsch: Bronzeschmelzstätten auf der Heidenschanze in Dresden-Coschütz. In: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 19. 1971. S. 35
35 ebd.
36 a.a.O.: S.59
37 a.a.O.: S. 65
38 a.a.O.: S. 58
39 a.a.O.: S. 42
40 K. Simon: Ein Schmelzofen. S. 69
41 a.a.O.: S. 68
42 s.a. H. Dengler: Die Abdeckungen auf der Heidenschanze 1939-41. Fundbericht vom 12.2.1942. o.O.
43 A. Jockenhövel: Struktur und Organisation der Metallverarbeitung in urnenfelderzeitlichen Siedlungen Süddeutschlands. In: Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 20. 1986.
S. 213-234
44 a.a.O.: S. 219
45 a.a.O.: S. 223
46 C. Seewald: Die urnenfelderzeitliche Besiedlung der ehemaligen Rheininsel von Säckingen und ihrer Umgebung. In: Badische Fundberichte 21. 1958. S. 113
47 Jockenhövel: Metallverarbeitung. S. 219
48 ebd.
49 a.a.O.: S. 223
50 a.a.O.: S. 229
51 So meint JOCKENHÖVEL, daß Uferrand- und Höhensiedlungen überproportional gut ausgegraben seien. Zudem sei die Wahrscheinlichkeit höher, daß solche Siedlungen eher überstürzt aufgegeben worden sind als andere. Theorien, die die Bedeutung dieser Siedlung bezüglich des Metallhandwerks stärker herausstellen, schließt er sich daher nicht an. (Jockenhövel: Metallverarbeitung. S. 229)
52 Jockenhövel: Metallverarbeitung. S. 229
53 a.a.O.: S. 213
54 a.a.O.: S. 215
55 Jantzen: Versuche zum Metallguß. S. 213
56 s. a. K.Goldmann: Guß in verlorener Sandform.
57 a.a.O.: S. 115
58 Jockenhövel: Organisation der Metallverarbeitung S. 214
59 a.a.O.: S. 229
60 R. Krause: Vom Erz zur Bronze. Bergbau, Verhüttung und Bronzeguß. In: Goldene Jahrhunderte. Die Bronzezeit in Südwestdeutschland. (= ALManach 2) Stuttgart 1997. S. 40
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit über Metallurgie in der Bronzezeit?
Der Fokus liegt auf der archäometallurgischen Forschung zur Bronzezeit, insbesondere auf der Herstellung und Verbreitung von Bronze sowie den gesellschaftlichen Auswirkungen. Die Arbeit untersucht archäologische Hinweise auf bronzezeitliches Metallhandwerk in Siedlungen, einschließlich Metallstücke, Werkzeuge, Öfen, Wirtschaftsstrukturen und Handwerkstechniken.
Welche Aspekte des bronzezeitlichen Metallhandwerks werden betrachtet?
Die Arbeit gibt einen Überblick über das bronzezeitliche Metallhandwerk und konzentriert sich auf Siedlungsfunde und Beispiele. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Ofenfunden, da diese mit allen weiteren metallurgischen Funden in Verbindung stehen und methodisch interessant sind. Es werden auch die methodischen Probleme bei der Untersuchung dieses Themas behandelt.
Welche Themen umfasst der Überblick über das bronzezeitliche Metallhandwerk?
Der Überblick umfasst die Entwicklung der Bronze, bronzezeitlichen Bergbau und Kupferverhüttung sowie den Bronzeguss. Es werden auch die Techniken und Verfahren zur Herstellung von Bronze, ihre Verbreitung und die gesellschaftlichen Auswirkungen von Herstellung und Verbreitung behandelt.
Welche Siedlungsfunde werden in der Arbeit untersucht?
Es werden mehrere Beispiele für bekannte und publizierte Funde von Ofenanlagen vorgestellt, darunter Buchberg, Walkemühle, Taltitz und die Heidenschanze. Außerdem wird eine Übersicht über urnenfelderzeitliche Siedlungen Süddeutschlands gegeben.
Was wurde bei den Ausgrabungen in Buchberg gefunden?
In Buchberg wurden Schlacken, Rohkupferstücke, frühbronzezeitliche Keramik, eine Blasrohrdüse und ein Schmelztiegel gefunden. Analysen ergaben, dass das Kupfer aus dem Bergwerk Schwaz-Brixlegg stammte und das beim Schmelzen Kalkstein, Buntsandstein, Quarzphyllit sowie Schlacke bzw. Schlackensand zugeschlagen wurden.
Was wurde bei der Siedlungsgrabung in Göttingen Walkemühle gefunden?
In Göttingen Walkemühle wurden Schmelzschlacke, eine Wandungsscherbe eines Tiegels und Gießformfragmente aus gebrannten Lehm gefunden, darunter Gießformen für Stäbe, ein Tüllenbeil, eine Lanzenspitze und weitere Gegenstände. Es wurden auch Lehmbruchstücke gefunden, die möglicherweise als Herdeinfassung dienten.
Was wurde in Taltitz bei Plauen gefunden und wie wird der Fund interpretiert?
In Taltitz wurde eine mehrphasige Siedlung mit dazugehörigem Friedhof ergraben. Es wurde eine Ofenanlage gefunden, die aus zwei abgerundet-rechteckigen Gruben bestand, die durch einen flachen Kanal verbunden waren. Diese Anlage wird als ein hochgebauter Schachtofen interpretiert, wobei die Gruben als Gebläsegruben dienten.
Welche Kritik gibt es an der Interpretation der Funde auf der Heidenschanze in Dresden-Coschütz?
Die Interpretation der Funde auf der Heidenschanze als Bronzeschmelzstätte mit Kuppelbronzeschmelzofen und langem Windkanal ist umstritten. Kritiker bemängeln die Größe der Anlage und schlagen vor, dass der Befund eher einem Haus mit Backofenanlage entspricht. Es wird auf einen weiteren Fund in der Nähe verwiesen, der dem Ofen von Taltitz ähnlicher sein soll.
Welche Ergebnisse brachte die Untersuchung von urnenfelderzeitlichen Siedlungen Süddeutschlands?
A. Jockenhövel untersuchte 34 Fundstellen in Süddeutschland und fand Gußkuchen, Gußtiegelfragmente, Gußformen und Kannelurensteine. Die Funde deuten auf die Herstellung kleinerer Alltagsgegenstände im Bronzegußverfahren hin, während Qualitätserzeugnisse fehlen. Der Forschungsstand wird als ungenügend bewertet.
Welche Probleme erschweren die Forschung zum Bronzeguss in bronzezeitlichen Siedlungen?
Zu den Problemen gehören der niedrige Forschungsstand der bronzezeitlichen Siedlungsforschung, die schlechte Quellenlage und Befundsituation, die Erhaltungsbedingungen, das Problem der Beobachtungsmöglichkeiten und die Frage, ob die Metallverarbeitung ein Wander- oder ein ortsansässiges Handwerk war. Es wird auch diskutiert, wer das Handwerk kontrollierte und ob die Herstellung von Bronze in vielen Siedlungen als Hauswerk betrieben wurde oder von Spezialisten durchgeführt wurde.
- Citar trabajo
- Katrin Ulrich (Autor), 1999, Archäologische Nachweise bronzezeitlicher Metallverarbeitung in Siedlungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105685