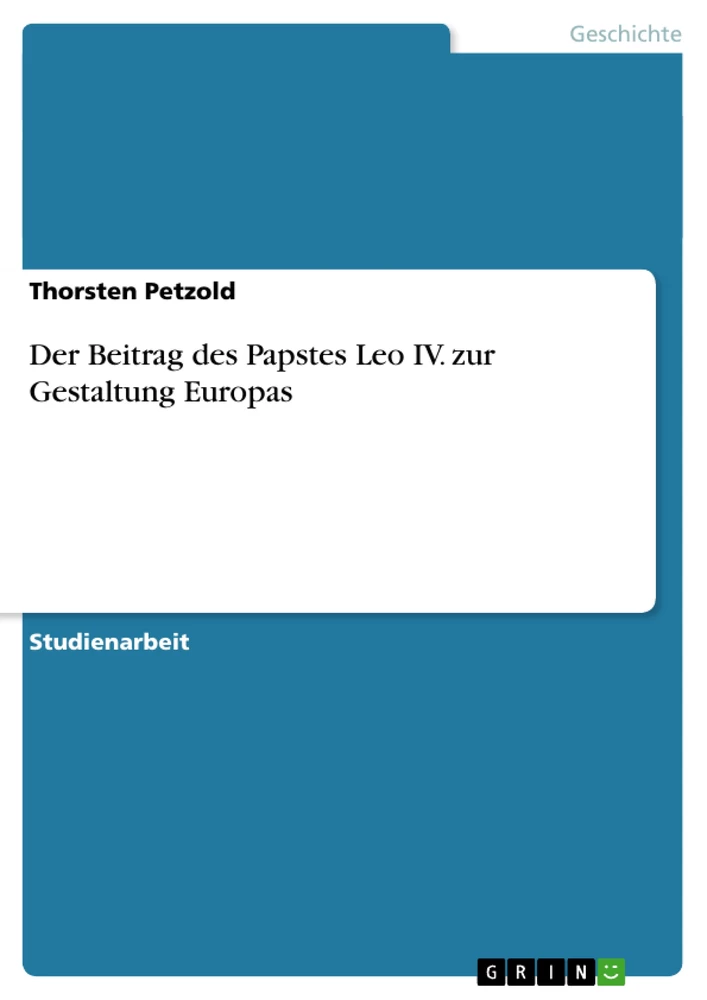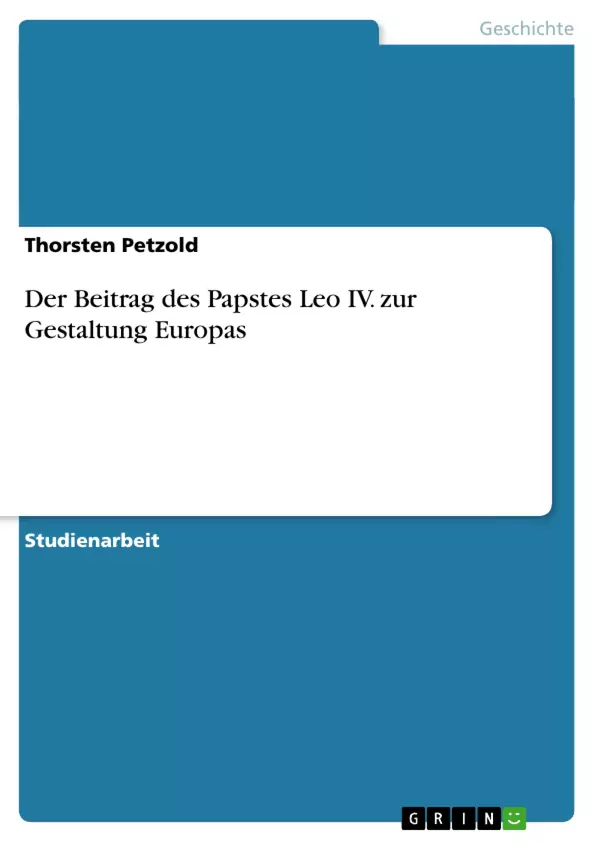Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Europa in der Mitte des 9. Jahrhunderts
2.2 Leo IV. und seine Beziehungen zu Lothar I. und Ludwig II
2.3 Leo IV. und seine Beziehungen zu Byzanz
2.4 Leo IV. und seine Beziehungen zu England
2.5 Leo IV. und seine Beziehungen zur Bretagne
2.6 Leo IV. und seine Beziehungen zu Reims und Westfranken
3. Resümee
Abbildungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Leo, natione Romanus, ex patre Radualdo1 . Von 847 bis 855 lenkte er als Leo IV. die Geschicke der römischen Kirche in Rom. Quellen sind sowohl die VitaLeonis im Liber pontificalis, als auch Briefe und Urkunden aus der CollectioBritannica bzw. den Abschriften in der Monumenta Germaniae Historica.
Die Erhebung Leos IV. erfolgte in der karolingischen Spätphase. Das fränkische Reich Karl des Großen war in drei Teile gespalten, im Osten drängte Byzanz auf Eigenständigkeit und vor den Toren Roms standen angriffsbereit die Sarazenen. Wie konnte ein Papst unter diesen Umständen wirken? Ziel dieser Seminararbeit ist es, einen Einblick in die Handlungen und Handlungsmöglichkeiten eines Papstes in der Mitte des 9. Jahrhunderts zu gewinnen. Schwerpunkt hierbei bilden die Kontakte Leos IV. zu Bischöfen, Königen und Kaisern außerhalb Roms. Konnte er die Geschicke der Herrscherhäuser beeinflussen und somit Europa mitgestalten?
Neben den Quellen sind Klaus Herbers Forschungen in ,,Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts" für eine Darstellung des aktuellen Forschungsstandes unverzichtbar. Es ist das mit Abstand umfangreichste Werk zu diesem Thema. Zwar erschienen auch diverse andere Publikationen, welche hier selbstverständlich ebenfalls Berücksichtigung finden, doch können diese in Art und Umfang nur als Ergänzung zu Herbers Werk gesehen werden. Seit der Veröffentlichung seiner Habilitationsschrift 1996 erschien kaum mehr ein deutschsprachiger Artikel über Leo IV., der nicht aus der Feder von Klaus Herbers stammt. Auch dies macht seine exponierte Stellung deutlich.
Die Verdienste Leos IV. um die Stadt Rom an sich, z.B. die Abwehr der Sarazenen oder seine Tätigkeit als Bauherr der Leostadt, sind nicht Thema dieser Arbeit.
2. Hauptteil
2.1 Europa in der Mitte des 9. Jahrhunderts
Wenn man nur wüsste, was Europa eigentlich ist2 ! Schon seit der Antike ist der Begriff Europa nicht richtig greifbar, findet sich keine eindeutige Definition. Europa war eine Tochter Agenors, des Königs der Phönizier. Eines Tages erschien ihr am Strand Zeus in Gestalt eines weißen Stieres. Der Stier schien sanft, so dass Europa auf seinen Rücken stieg. Zeus entführte sie daraufhin nach Kreta und zeugte drei Söhne mit ihr3. Der Kontinent Europa war geboren! In der Mozarabischen Chronik von 754 wird erstmals der europenses als kontinentale Gemeinschaft der Völker nördlich der Pyrenäen und der Alpen erwähnt4.
Der Begriff ,,Europa" wurde gerade zu Zeiten der Karolinger immer häufiger verwendet, hier jedoch meistens im Zusammenhang mit feierlichen Anreden an Päpste, kirchlichen Lobgesängen oder als Topos des Herrscherlobes5. So wurde schon Karl der Große als pater Europae besungen6. Europa ist jedoch nicht nur unter geographischen Gesichtspunkten zu betrachten, sondern gerade auch in kultureller und religiöser Abgrenzung. Gerade bei äußeren Bedrohungen durch Sarazenen, Türken oder Hunnen wurde die Einheit Europas beschworen. Allerdings verschwand diese Einheit wieder, sobald die Gefahr geschwunden war7. Auch Leo IV. benutzte den Begriff Europa: ,,...sed per totam Europam, ad qos delaegatum est tradere..."8 . Die Verwendung der Formulierung in einem Brief an den Patriarchen von Konstantinopel lässt darauf schließen, dass er zumindest Teile des oströmischen Reiches, evtl. sogar das gesamte Gebiet, als Europa zugehörig versteht. Allerdings ist es auch nachvollziehbar, dass der Papst und die römische Kirche als caput aller Kirchen die gesamte orbis christianus als Europa ansehen und aus ihrer Sicht folgerichtig auch in ihr den Herrschaftsanspruch sichern und ausbauen wollten.
2.2 Leo IV. und seine Beziehungen zu Lothar I. und Ludwig II.
Durch die Verträge von 817 (Pactum Hludowicianum) und 824 (Constitutio Romana) standen Rom, der Kirchenstaat und das Papsttum unter dem Schutz der fränkischen Herrscher. Hierbei war der Kaiser oberste Kontrollinstanz der päpstlichen Administration und nahm auch den Treueid des Papstes sowie der römischen Bürger entgegen9. Leo IV. wurde 847 ohne die sonst notwendige kaiserliche Zustimmung zum neuen Papst geweiht. Die Römer begründeten dies mit der drohenden Sarazenengefahr, doch wollten sie gleichzeitig fides und honor des Kaisers wahren: ,,... periculumque Romanae urbis maxime metuebant ne iterum ut olim aliis ab hostibus fuisset obsessa. Hoc timore et futuro casu perterriti, eum sine permissu principis praesulem sacraverunt, fidem quoque illius sive honorem post Deum per omnia et in omnibus conservantes." 10.
Wohl deshalb unternahm Kaiser Lothar I., Herrscher des die Stadt Rom verwaltenden Mittelreiches (s. Abbildung 1), diesmal nichts, ganz im Gegensatz zur Erhebung Sergius' II. 844, die ebenfalls ohne kaiserliche Mitwirkung erfolgte11. 850 erfolgte dann die Kaisersalbung und -erhebung Ludwigs II, welche auch Herbers als erste konstitutive Kaisererhebung durch einen Papst bezeichnete12. Zwar war Ludwig bis zum Tode seines Vaters Lothar I. im Jahre 855 lediglich Mitkaiser des Mittelreiches, doch da Lothar nördlich der Alpen stark beansprucht war, hatte Ludwig de facto die Macht über Italien in Händen.
Leo IV. suchte verschiedentlich die Unterstützung der Kaiser, u.a. auch in seiner Auseinandersetzung mit Anastasius Bibliothecarius. Diesen hatte Leo noch 847 zum Kardinalpresbyter von San Marcello geweiht13, bevor sich Anastasius gegen den Papst wendete und 850 wegen Pflichtvernachlässigung und Ungehorsam exkommuniziert wurde und im Dezember 853 auf einem Konzil anathematisiert wurde14. Anastasius hielt sich in dieser Zeit weitestgehend in der Diözese Aquileja auf, welche im Herrschaftsbereich von Ludwig II. lag15. In dieser Auseinandersetzung wurde deutlich, dass der Papst immer noch auf Herrscher der Gebiete angewiesen war, auf die er keinen direkten Zugriff hatte. Als Bischof von Rom war er nur in der Stadt Rom selbst handlungsfähig. Dies zeigt die gegensetige Abhängigkeit von Papst und Kaiser, aber auch ihre gegensätzlichen Interessen. So war Anastasius nach Leos Tod schnell der Kandidat Ludwigs II. für die Erhebung des neuen Papstes, konnte sich letztendlich jedoch nicht gegen Benedikt III. durchsetzen16.
2.3 Leo IV. und seine Beziehungen zu Byzanz
Auch in Byzanz wurde im Jahre 847 ein neuer Patriarch erhoben. Als Nachfolger des im Juni 847 verstorbenen Methodios wurde nach teilweise heftigen Auseinandersetzungen Ignatio bestellt17. Sein Widersacher, der Erzbischof Gregor Arbestas von Syrakus, wurde durch ein Synodalurteil verurteilt und abgesetzt. Hiergegen wandte sich Gregor mit einer Appellation an Leo IV., was den Papst in diese Auseinandersetzung zog18. Zielsetzung für den Papst musste es sein, den Vorrang Roms bei allen Glaubensfragen zu erhalten und letzte Instanz bei kirchlichen Streitigkeiten zu sein. Dementsprechend war auch seine Reaktion in einem Schreiben an Ignatios:
,,Ex quo unigenitus Dei filius sanctam in se fundavit ecclesiam caputque universorum apostolicis institucionibus sacerdotum perfecit, cuiuscumque contradictionis littigiique contentio vestre oriebatur vel accidebat ecclesie, Romano vestri predecessores pontifici ingenti eam studio procacique celeritate innotescere procurabant; et postmodum eius roborati consensu lucifluoque consilio cuncta, que necessitas provocabat, beatifico moderamine peragebant. Vos autem, predictorum ut fertis virorum [successores], sine conscientia nostra congregatis episcopis depositionem perpetrastis, quod absentibus nostris legatis vel litteris nullo debuistis explere modo."19.
Allerdings geht aus den Quellen nicht eindeutig hervor, ob Leo IV. der Absetzung letztendlich doch zustimmte. So wirkte Gregor Arbestas später wieder unter dem Patriarchen Photios20. Doch ist dieses Schreiben auch ein klares Indiz für den Machtanspruch des Bischofs von Rom, welcher durch Leo selbst und auch die folgenden Päpste sukzessive weiterverfolgt wurde.
Ein anderer Streitpunkt war die Übersendung eines Palliums von Konstantinopel nach Rom. Leo IV. antwortete unmissverständlich:
,, Vidimus animi puritate, et sola benivolentia pallium superhumerale a vestra dilectione dirctum, quod a nobis suscipi non potuit, quia non est mos istius ecclesie, cum magistra et caput omnium videatur aecclesiarum existere, aliunde pallium erogatum accipere, sed per totam Europam, ad quos delaegatum est tradere. Hoc ne dure accipiatis precamur, quia hac ratione illum suscipere nequivimus, sed vobis remandare previdimus." 21.
Lediglich die römische Kirche als Haupt aller Kirchen verteile somit das Pallium und könne selbst nicht Empfänger sein. Herbers verweist hierbei auf die unterschiedliche Vergabe des Palliums in Ost und West. Er hält es für möglich, dass Ignatio das Pallium lediglich als wertvolles Geschenk gesehen hat, während der Papst juristische Argumente in den Vordergrund rückte. Herbers nennt dies eine ,,diplomatische Ungeschicklichkeit" Ignatios22. Dies bezweifele ich allerdings, da der neue Patriarch durchaus über das Verfahren bei bei der Vergabe des Palliums durch die Westkirche informiert gewesen sein dürfte. Mir scheint es eher ein Versuch gewesen zu sein, die eigene Kirche zu stärken. Somit war Leos Reaktion nicht nur juristischer Natur, sondern auch eindeutig ein Zeichen von Machtpolitik gegen den Patriarchen aus Konstantinopel.
2.4 Leo IV. und seine Beziehungen zu England
Die Beziehungen zwischen Rom und England sind vor allem seit der Synode von Whitby im Jahre 664 gefestigt worden. Päpstliche Pallienverleihungen, Entsendung von Legaten und auf der anderen Seite Romreisen diverser englischer Könige (z.B. durch König Alfred 855) stützten das gute Verhältnis23. So kümmerte sich Leo IV. besonders um das sogenannte Sachsenviertel, indem er angeblich auch folgendes Wunder vollbrachte: Am Anfang seines Pontifikats wurde das Sachsenviertel von einer Feuerbrunst bedroht. Das liber pontificalis ,,berichtet" weiter:
,,Quo audito, ipse beatissimus pontifex illic celeri cursu profectus est, et obvius ante ignis impetum se praeparavit, Dominum deprecari caepit ut ipsius incendii flammas extingueret; et crucis propriis faciens signaculum digitis, amplius ignis extendere flammas non potuit;..." 24.
Vom Wahrheitsgehalt dieser ,,Beschreibung" abgesehen erscheint es jedoch nicht verwunderlich, dass der Papst dieses Wunder gerade zum Schutze englischer Einrichtungen erwirkt hat. Vielmehr bringt dies zum Ausdruck, wie eng die Verbindung zwischen Gott und denen sein kann, die ihm dienen. Auch diese Schilderung sehe ich daher als machtpolitisches Instrument, als Verdeutlichung der Abhängigkeit aller weltlichen Elemente von göttlichen Gnaden. Von besonderer Dankbarkeit der Engländer zeugte auch die Abgabe des sogenannten Peterspfennig an die römischen Kirche25. Die Reisen und sogar die Reisewege der englischen Könige nach Rom hatten jedoch auch diplomatische Gründe. So wurde z.B. König Edelwulf auf seiner Reise nach Rom im Reich der Westfranken von König Karl dem Kahlen begleitet und heiratete auf dem Rückweg dessen Tochter Judith26.
2.5 Leo IV. und seine Beziehungen zur Bretagne
Schon 830 versuchte der fränkische Kaiser Ludwig der Fromme die Bretagne zu integrieren, was jedoch ebenso wie bei fünf weiteren Feldzügen misslang. 836 machte Ludwig Nominoe zum missus in der Bretagne, wonach dieser die Herrschaft über das gesamte bretonische Reich beanspruchte27. Nominoe versuchte hierbei auch immer wieder, sich durch den Papst legitimieren zu lassen. Ein Beispiel ist die Entsendung des heiligen Abtes Conwoio nach Rom, der gegen die simonistische Häresie vor allem durch Bischof Susannus von Vannes intervenierte. Die bretonischen Bischöfe wurden auf einer Bischofssynode getadelt und Conwoio erhielt die Kasel des Papstes. Desweiteren wurde seiner Bitte nach Übersendung einer Reliquie stattgegeben und Nominoe erhielt den Leib des heiligen Papstes Marcellinus, welcher in das bretonische Kloster Redon gebracht wurde28.
Herbers vermutet, dass Nominoe nach der Rückkehr des Conwoio die Bischöfe auf einer Synode absetzen und sich selbst zum König salben ließ29. Dies erscheint schlüssig, da auch ein Brief des späteren Papstes Nikolaus I. die Absetzung der Bischöfe durch Laien tadelte30. Allerdings bestätigte Leo IV. ihm nicht wie gewünscht die Königswürde, sondern lediglich die Herzogswürde, da sich aus den römischen Archiven die Existenz von bretonischen Königen nicht nachweisen ließ. Vielmehr sei die Bretagne den fränkischen Königen untergeben31. Dieses Beispiel zeigt die bereits entstandene Macht des Papstes. Der fränkische König hätte wohl kaum eine Legitimation für eine Unterwerfung eines päpstlich anerkannten bretonischen Königs gehabt. Ebenso verhinderte Leo IV. eine unabhängige Kirchenprovinz der Bretagne, indem er dem neugegründeten bretonischen Erzbistum Dol befahl, sich dem Metropoliten Herard von Tours unterzuordnen32. Eine eigenständige Kirchenprovinz wäre sicherlich ein erster Schritt zu einem souveräne n Königreich gewesen.
2.6 Leo IV. und seine Beziehungen zu Reims und Westfranken
Seit 833 herrschten in Reims Streitigkeiten bei der Benennung des Bischofs. Von 845 an war dort Hinkmar von Reims Bischof, der sich mit seinem Vorgänger Ebo und den von ihm eingesetzten Klerikern auseinandersetzen musste. Auch Hinkmar wandte sich früh an Leo IV., um sich von ihm Maßnahmen gegen seine Gegner absegnen zu lassen33. Doch ist der erhaltene Briefwechsel nicht eindeutig. Vielmehr ist er von Fälschungen durchzogen, welche die Interessen der jeweiligen Parteien in den Vordergrund stellen. So erhält Hinkmar von Reims nach einer Quelle das Pallium zu dessen täglichen Gebrauch, während er in einem anderen Brief exkommuniziert wird34. Auch Leo IV. hatte sich mit den unterschiedlichen Darstellungen auseinander zu setzen, da sich beide Parteien um die päpstliche Entscheidung bemühten. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Schilderungen den jeweiligen Interessen angepasst waren, sodass Leo IV. keine schnelle Entscheidung zu Gunsten einer Partei möglich war. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er sowohl Hinkmar als auch Ebo, welcher die Protektion Ludwigs II. genoß, Zugeständnisse machte, ohne jedoch einen von beiden gänzlich auszuschalten. So sind die Briefe Leos IV. mit dem Vorbehalt versehen, von dem jeweiligen Adressaten richtig informiert worden zu sein. Die Absetzung der unter Ebo geweihten Kleriker auf einer Synode 853 war wohl Hinkmars größter Erfolg, wodurch seine Macht gestärkt wurde35.
3. Resümee
Leo IV. hat es sehr gut verstanden, den ihm zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum zu nutzen. Er pflegte Kontakte zu den bekannten und wichtigen Herrscherhäusern und stärkte die Macht der Kirche nachhaltig.
Auch verstand er es, sich gegen Feinde innerhalb der Institution Kirche durchzusetzen. Wie am Beispiel von England, der Bretagne und Byzanz gezeigt wurde, hatte der Papst bereits Mitte des 9. Jahrhunderts erheblichen Einfluss auf die Politik großer Teile des christlichen Europas. Wenn er auch nicht überall selbst Handlungsvollmachten besaß, so war doch in allen wichtigen Angelegenheiten die Legitimation durch den Papst erwünscht oder sogar erforderlich. Auch hieran ist die Stärke der römischen Kirche zu ermessen, welche in den folgenden Jahrhunderten noch wachsen sollte.
Abbildungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1:
Die karolingischen Teilreiche nach dem Vertrag von Verdun (843), aus: Angenendt, S. 383
Quellenverzeichnis
Vita Leonis, in: Liber pontificalis, ed. Louis Duchesne, tome second, Paris 1892, S. 106 - 126
Epistolae selectae ex registro Leonis IV., in: Monumenta Germaniae Historica, Epistolae Karolini aevi, Epistolarum tomus V, Berlin 1899, S. 585 - 612
Ex gestis Conwoionis abbatis rotonensis, in : Monumenta Germaniae Historica , Scriptores, Band XV.1, Hannover 1887, S. 455 - 460
Literaturverzeichnis
Angenendt, Arnold, Das Frühmittelalter - Die abendländische Christenheit von 400 bis 900, Stuttgart 1990
Borgolte , Michael, Vor dem Ende der Nationalgeschichten?, in: Historische Zeitschrift, Band 272, München 2001, S. 561 - 578
Bosl, Karl, Europa im Mittelalter - Weltgeschichte eines Jahrtausends, Wien 1970
Fried, Johannes, Die Formierung Europas 840 - 1046, erschienen in der Reihe: Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Band 6, München 1993
Fuhrmann, Horst, Das Papsttum und das kirchliche Leben im Frankenreich, in: Nascita dell'Europa ed Europa Carolingia: un'equazione da verificare, tomo primo, hrsg. vom Centro Italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1981, S. 419 - 456
Herbers , Klaus , Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts- Möglichkeitenund Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karolingerzeit, erschienen in der Reihe: Päpste und Papstum, Band 27, Stuttgart 1996
Schmale , Wolfgang, Geschichte Europas, Wien 2000
Schulze , Hagen, Europa als historische Idee, in: Europa-Philosophie, hrsg. von Werner Stegmaier, Berlin / New York 2000, S. 1 - 13
Seppelt, Franz Xaver, Das Papsttum im Frühmittelalter - Geschichte der Päpste vom Regierungsantritt Gregors des Grossen bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, Leipzig 1934
Vollmer, Wilhelm, Wörterbuch der Mythologie, Digitale Bibliothek Band 17, hrsg. von Directmedia, Berlin 1999
[...]
1 Duchesne, S. 106
2 Schulze, S. 1
3 Vollmer, S. 3453
4 Bosl, S. 12, Schulze S. 4; Borgolte, S. 567 f., Schmale, S. 29
5 Borgolte, S. 567; Bosl, S. 12
6 Fuhrmann, S. 420; Bosl, S. 13
7 Schulze, S. 5
8 MGH Epist. V S. 607 Nr. 41, vgl. Kapitel 2.3
9 Angenendt, S. 378 u. 395, Fried, S. 88
10 Duchesne, S. 107
11 Herbers, S. 208
12 Herbers, S. 210 f., Seppelt, S. 227
13 Seppelt, S. 230
14 Herbers, S. 217 f.
15 Seppelt, S. 230
16 Herbers, 218
17 Herbers, S. 303
18 Herbers, S. 304
19 MGH, Epist. V S. 589 Nr. 9
20 Herbers, S. 305
21 MGH Epist. V S. 607 Nr. 41
22 Herbers, S. 308
23 Herbers, S. 312 f.
24 Duchesne, S. 111
25 vgl. hierzu Herbers, S. 313 ff.
26 Herbers, S. 317
27 Herbers, S. 321
28 MGH,ßXV.1, S. 457
29 Herbers, S. 323 ff.
30 Herbers, S. 328
31 Herbers, S. 331
32 Herbers, S. 333
33 Herbers, S. 339
34 Angenendt, S. 394 f., Herbers, S. 341 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments über Leo IV.?
Dieses Dokument ist eine Seminararbeit, die sich mit den Handlungen und Handlungsmöglichkeiten von Papst Leo IV. in der Mitte des 9. Jahrhunderts beschäftigt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf seinen Beziehungen zu Bischöfen, Königen und Kaisern außerhalb Roms und der Frage, ob er die Geschicke der Herrscherhäuser beeinflussen und somit Europa mitgestalten konnte.
Welche Quellen werden für diese Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Vita Leonis im Liber pontificalis, Briefe und Urkunden aus der Collectio Britannica bzw. den Abschriften in der Monumenta Germaniae Historica sowie auf die Forschungsergebnisse von Klaus Herbers.
Welche historischen Kontexte werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Europa in der Mitte des 9. Jahrhunderts, die karolingische Spätphase, die Spaltung des fränkischen Reiches, die Bestrebungen von Byzanz nach Eigenständigkeit und die Bedrohung durch die Sarazenen.
Wie waren die Beziehungen von Leo IV. zu Lothar I. und Ludwig II.?
Leo IV. stand aufgrund der Verträge von 817 und 824 unter dem Schutz der fränkischen Herrscher. Er suchte deren Unterstützung, u.a. in seiner Auseinandersetzung mit Anastasius Bibliothecarius. Die Kaisersalbung von Ludwig II. im Jahr 850 wird als erste konstitutive Kaisererhebung durch einen Papst bezeichnet.
Wie war das Verhältnis von Leo IV. zu Byzanz?
Leo IV. mischte sich in den Streit um die Besetzung des Patriarchenamtes in Byzanz ein und betonte den Vorrang Roms in Glaubensfragen. Er lehnte die Übersendung eines Palliums von Konstantinopel nach Rom ab, da er die römische Kirche als Haupt aller Kirchen ansah.
Wie gestalteten sich die Beziehungen von Leo IV. zu England?
Die Beziehungen zwischen Rom und England waren gefestigt. Leo IV. kümmerte sich um das Sachsenviertel in Rom und wurde durch die Abgabe des Peterspfennigs geehrt. Reisen englischer Könige nach Rom hatten auch diplomatische Gründe.
Wie waren die Beziehungen von Leo IV. zur Bretagne?
Nominoe, der Machthaber in der Bretagne, versuchte, sich durch den Papst legitimieren zu lassen. Leo IV. bestätigte ihm jedoch nur die Herzogswürde, nicht die Königswürde, und verhinderte eine unabhängige Kirchenprovinz der Bretagne.
Wie gestalteten sich die Beziehungen von Leo IV. zu Reims und Westfranken?
In Reims gab es Streitigkeiten bei der Benennung des Bischofs. Leo IV. musste sich mit unterschiedlichen Darstellungen der beteiligten Parteien auseinandersetzen und traf vorsichtige Entscheidungen, um keine Partei gänzlich auszuschalten.
Was ist das Resümee der Arbeit?
Leo IV. verstand es, seinen Handlungsspielraum zu nutzen, pflegte Kontakte zu den wichtigen Herrscherhäusern und stärkte die Macht der Kirche. Er hatte erheblichen Einfluss auf die Politik großer Teile des christlichen Europas und die Legitimation durch den Papst war in vielen Angelegenheiten erwünscht oder erforderlich.
- Citar trabajo
- Thorsten Petzold (Autor), 2002, Der Beitrag des Papstes Leo IV. zur Gestaltung Europas, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/105968